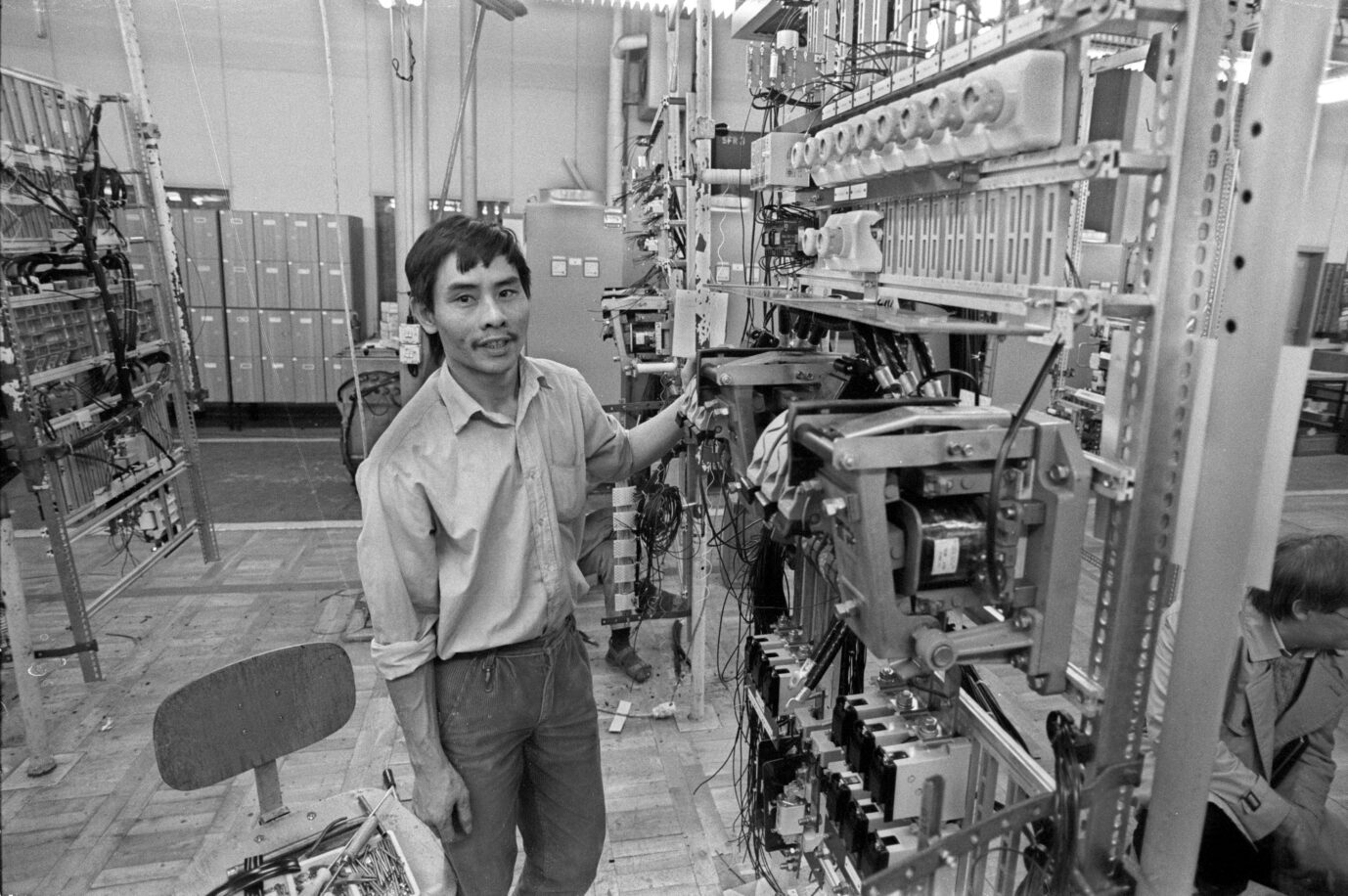Von Peter Fechter habe ich zum ersten Mal 1974 gehört. Damals nahm ich an einer jener routinemäßigen Berlin-Fahrten teil, die die Schulklassen der Bundesrepublik wahrnehmen mußten. Teil des Pflichtprogramms waren Vorträge im alten Deutschlandhaus, und da sprach einer der Referenten auch über Mauerbau und in dem Zusammenhang über die „Mauertoten“. Während meine Kameraden vor sich hindösten, war ich in Bann geschlagen von zwei Schwarz-Weiß-Dias. Das eine zeigte den „Springer“, jenen DDR-Grenzsoldaten, der am 13. August 1961, während der „Antifaschistische Schutzfall“ hochgezogen wurde, entschlossen Anlauf nahm und über die noch provisorische Absperrung aus Stacheldraht setzte.
Das andere war diese groteske Pieta mit den Uniformierten, die den verbluteten Fechter bargen. Das Bild führt die Einzelheiten des Geschehens noch einmal zusammen: den Entschluß zur Flucht, die Schüsse ohne Vorwarnung, der Sturz auf das DDR-Gebiet, das zynische Abwarten im Osten, das hilflose im Westen, der absurde Versuch, dem Sterbenden Verbandsstoff zuzuwerfen, zuletzt die Bergung durch „bewaffnete Organe“, die ohnmächtigen und wütenden Proteste im freien Teil Berlins.
Davon war Mitte der siebziger Jahre nichts mehr geblieben, kaum mehr eine Erinnerung an die ungeheure Erbitterung, die der Mauerbau ausgelöst hatte: über die Alliierten, allen voran die Amerikaner, die doch keine Besatzer, sondern unsere Verbündeten und „Schutzmacht“ der „Frontstadt“ sein sollten, über Adenauer, dessen „Politik der Stärke“ offenbar zu nichts, jedenfalls nicht zur Befreiung der DDR und zur Wiedervereinigung, geführt hatte. Vergessen waren aber auch die großen Aufmärsche, die Jahre hindurch an der „Schandmauer“ (Willy Brandt) von Junger Union, Jungsozialisten und Jungdemokraten durchgeführt worden waren, die Aktionen der tollkühnen Tunnelbauer und Fluchthelfer.
Deutsche Gesellschaft pflegt Fernstenliebe
Man könnte das damit erklären, daß die Westdeutschen getan hatten, was ihnen seit 1945 beigebracht worden war: sich arrangieren. Aber das ist nur ein Teil der Wahrheit, denn im Nachwuchs gab es ja nach wie vor jede Menge Empörungsbereitschaft: im Hinblick auf Biafra und den Kongo und Vietnam, im Hinblick auf den US-Imperialismus (und manchmal den Panzersozialismus) und die Gefahr des Atomtods, im Hinblick auf den Neo-Faschismus, der vor der Machtergreifung stand, den „Leistungsterror“, die Klassenherrschaft des Großkapitals, die Unterdrückung von Frauen, Homosexuellen und sonstigen Minderheiten. Man protestierte gegen alles mögliche, und man solidarisierte sich mit allen möglichen. Allerdings mußte das Böse möglichst weit weg und abstrakt sein, und derjenige, an dessen Seite man trat, möglichst fremd oder minoritär.

Das war eine ganz andere „Fernstenliebe“ als die, die Nietzsche meinte: Letztlich ein Ausdruck der Ablehnung des Eigenen, des Konkreten, des Natürlichen und damit Symptom einer seelischen Beschädigung, die Individuum wie Gemeinschaft erlitten hatten. Es ist hier nicht der Ort, auf deren tiefere Ursachen einzugehen. Festzuhalten bleibt aber, daß sie seitdem nicht therapiert wurde. Als es an der Zeit schien, mit der Kur zu beginnen – nach der „Maueröffnung“, dem Zusammenbruch der DDR und der Wiedervereinigung des „kleinsten Deutschlands, das es je gab“ (Vernon A. Walters) –, wurde das mit allen zu Gebote stehenden Mitteln verhindert. Denn die Politische Klasse betrachtete die unerwartet zustande gekommene „Berliner Republik“ immer nur als Provisorium, ein Notbehelf, der sich im Zuge von Europäisierung, Verwestlichung, Globalisierung schnellstens in den Weltstaat auflösen sollte.
Den Toten gebührt Respekt
Sah man sich zugleich gezwungen, die gewohnte und das heißt eher wohlwollende Sicht auf Teilung und DDR-Regime aufzugeben und eine gewisse Neubewertung vorzunehmen, geschah das immer in diesem Horizont. Was den Zungenschlag bei den offiziösen Veranstaltungen zum Mauerbau seit 1989 erklärt und die Sicht auf Peter Fechter, der da als eines der vielen, aber im Grunde austauschbaren, Opfer von Unrecht und Gewalt erscheint.
Ein framing, auch geeignet, davon abzuhalten, die Frage nach den eigentlichen Umständen seines Todes zu stellen: das Interesse der Sieger des Zweiten Weltkriegs an der Teilung Restdeutschlands, die Ohnmacht der Deutschen, die sie zwang, sich deren Willen zu unterwerfen, die Barbarei des Kommunismus und die kollektive Verdrängung dieser unerfreulichen Tatsachen, indem man sie sich schöndachte und -redete. Eine Übung, so gut trainiert, daß sie bis heute funktioniert. Weshalb die einen auf die Erfolgsgeschichte der Bundesrepublik und darauf verweisen, daß es zuletzt doch gut gegangen ist, und die anderen auf irgendwelchen „Errungenschaften“ der DDR beharren, während sie ihre Ostalgien pflegen.
Was dadurch unmöglich gemacht wird, ist, jene Kraftquelle freizulegen, die das Leben einer Nation speist: das Bewußtsein ihrer Zusammengehörigkeit, das aus der Kontinuität erwächst, die von den Vorfahren über die Heutigen zu den Ungeborenen reicht. Denn am Anfang steht nicht, daß wir die Erde von unseren Kindern geborgt, sondern daß wir sie von unseren Toten geerbt haben. Deshalb gebührt ihnen Respekt, vor allem dann, wenn ihr Tod über ihr persönliches Schicksal hinaus zeichenhafte Bedeutung hatte. In diesem Sinne sollte die Nation an Peter Fechter erinnern. Ehre seinem Andenken!