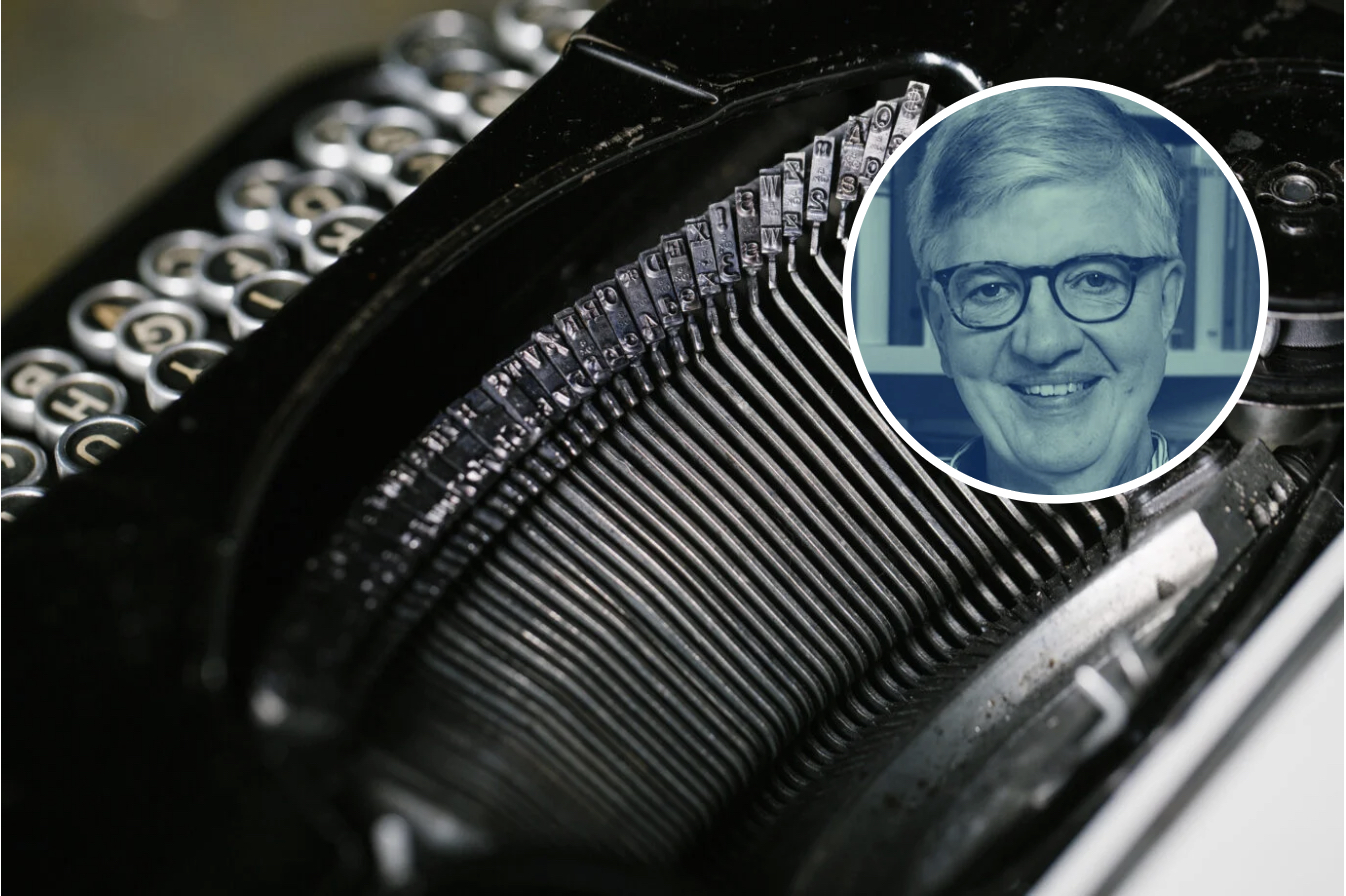Was sich derzeit über Caracas entlädt, ist weniger der Beginn eines regionalen Krieges als vielmehr die sichtbare Manifestation einer strategischen Neuordnung amerikanischer Machtpolitik. Der militärische Zugriff der Vereinigten Staaten auf Venezuela ist kein isoliertes Ereignis, keine spontane Strafaktion und auch keine bloße Reaktion auf Menschenrechtsverletzungen oder Drogenhandel. Er ist Ausdruck eines umfassenderen Paradigmenwechsels: der faktischen Wiederbelebung einer amerikanischen Monroe-Doktrin im 21. Jahrhundert, nur roher, expliziter und weniger rhetorisch verkleidet als in früheren Phasen. Auf die internationale, regelbasierte Ordnung, kann sich Washington in Zukunft wirklich nur noch mit einem dicken Augenzwinkern berufen.
Die ursprüngliche Monroe-Doktrin des 19. Jahrhunderts formulierte den Anspruch, daß der amerikanische Doppelkontinent außerhalb europäischer Einmischung zu stehen habe. Was damals als Schutzbehauptung gegen Kolonialmächte begann, entwickelte sich im Laufe der Jahrzehnte zu einem Instrument hegemonialer Ordnungspolitik. Lateinamerika war nie einfach nur Nachbarschaft, sondern stets strategischer Raum. Dieser Grundsatz war zeitweise überdeckt von multilateraler Rhetorik, Freihandelsabkommen und dem Anspruch liberaler Weltordnung. Unter Donald Trump fällt diese Verkleidung weg. Er tut es im Grunde ähnlich wie sein Pendant Wladimir Putin in Rußland und überfällt im strategischen Hinterhof des eigenen Staates einen fremden Staat mit der Absicht das Regime zu stürzen. Zwar kommen bei Moskau noch einige andere, schwerwiegendere Absichten wie territoriale Zugewinne hinzu. Aber im Kern ähnelt sich der Ansatz mit dem Unterschied nur, daß Washington erfolgreich ist und zeigt, wie es gemacht wird.
Der Schlag ist aus der US-Sicht eine Korrektur
Man lehnt sich wohl kaum zu weit aus dem Fenster, wenn man sagt: Trumps Außenpolitik folgt keiner universalistischen Mission. Sie zielt nicht auf Demokratieexport, Wertegemeinschaft oder internationale Normsetzung. Sie ist machtzentriert, raumbezogen und interessengeleitet. Sicherheit wird nicht mehr primär durch globale Präsenz an fremden Küsten gedacht, sondern durch Kontrolle des eigenen geopolitischen Vorfelds. Die westliche Hemisphäre wird dabei nicht als gleichberechtigter Raum souveräner Staaten betrachtet, sondern als sicherheitspolitischer Kernbereich der Vereinigten Staaten. Wer hier offen gegen Washington opponiert, wird nicht länger toleriert, sondern behandelt – mit Hellfire-Raketen und Gatling-Guns.
Der Angriff auf Venezuela fügt sich exakt in dieses Muster. Dessen Hauptstadt Caracas ist aus Sicht Washingtons kein peripheres Problem, sondern ein systemischer Störfaktor. Ein ölreicher Staat, politisch instabil, wirtschaftlich ruiniert, offen vernetzt mit Rußland, Iran und anderen Gegenspielern der USA – und zugleich geografisch Teil jenes Raumes, den Trump als unverhandelbare Einflußsphäre betrachtet. In dieser Logik ist ein Regimewechsel keine Eskalation, sondern eine Korrektur.
Dabei ist bemerkenswert, wie offen diese Politik inzwischen formuliert wird. Die nationale Sicherheitsstrategie der Vereinigten Staaten hat den Fokus deutlich verschoben. Weg von globaler Ordnungssicherung, hin zur Absicherung konkreter Räume. Europa verliert dabei an Priorität, Ostasien wird neu bewertet, während Nord- und Südamerika als zusammenhängender Sicherheitskomplex definiert werden. Grönland, der Panamakanal, Kanada und all diese scheinbar disparaten Themen folgen derselben inneren Logik. Kontrolle der westlichen Hemisphäre wird zur Voraussetzung nationaler Sicherheit erklärt. Wer Widerstand leistet, kann getilgt werden.
Der Zusammenbruch in Caracas zeigt, wie morsch das System Maduro war
In diesem Rahmen erscheint Venezuela nicht als Sonderfall, sondern als konsequenter Schritt. Die militärische Vorgehensweise spricht ebenfalls dafür. Massive Luftschläge gegen Kommando- und Infrastrukturziele, gleichzeitiger Einsatz von Transporthubschraubern, mutmaßlich Spezialeinheiten am Boden – das deutet auf ein klassisches Enthauptungsszenario hin. Keine langfristige Besatzung, keine Nation-Building-Illusion, sondern ein schneller, entschlossener Zugriff auf das Machtzentrum, verbunden mit der Erwartung, daß das Regime unter Druck kollabiert. Und das tut es allem Anschein nach auch.
Für Maduro, einen unbeliebten Diktator, scheint kein Venezolaner mit viel Inbrunst in den Kampf ziehen zu wollen. Hier drängt sich der Vergleich mit Rußlands Vorgehen in der Ukraine auf – nicht moralisch, sondern strukturell. Auch dort wurde auf einen schnellen Wechsel in Kiew gesetzt, auf die Annahme, daß das politische System innerlich hohl sei und bei entschlossener Gewaltanwendung zusammenbreche. Der entscheidende Unterschied liegt bislang nicht in der Methode, sondern in den Bedingungen. Während Rußland auf eine Gesellschaft traf, die sich als widerstandsfähig erwies, deutet in Venezuela vieles darauf hin, daß Loyalität eher behauptet als vorhanden war.
Gerade deshalb lohnt der Blick auf die Diskrepanz zwischen Propaganda und Realität. In der pro-russischen Informationssphäre und in regimetreuen venezolanischen Medien wurde über Monate das Bild eines bevorstehenden amerikanischen Fiaskos gezeichnet. Venezuela, so hieß es, werde ein neues Vietnam, ein urbanes Minenfeld, ein Albtraum für jede Intervention. Die Streitkräfte seien kampfbereit, die Milizen motiviert, der Widerstand fanatisch. Der bisherige Verlauf widerspricht diesem Narrativ deutlich. Die Luftkampagne scheint effektiv, der Widerstand fragmentiert, koordinierte Gegenangriffe bleiben aus. Das legt nahe, daß Teile des militärischen Apparats ihre Loyalität bereits neu kalkulieren. Solche Prozesse sind selten sichtbar, aber strategisch entscheidend. Kein Regimewechsel dieser Art erfolgt ohne stille Absprachen, ohne das Wissen, wer neutral bleibt, wer abtaucht, wer im entscheidenden Moment nicht eingreift. Die relative Ruhe am Boden spricht weniger für amerikanische Allmacht als für die innere Erosion des Maduro-Systems.
Trump macht die US-Politik ehrlicher
An dieser Stelle lohnt ein Blick weit zurück in die politische Theorie. Im Melier-Dialog, überliefert von Thukydides, formulieren die Athener gegenüber der kleinen Insel Melos eine nüchterne Wahrheit der Machtpolitik: Die Starken tun, was sie können, und die Schwachen erdulden, was sie müssen. Moral ist kein Maßstab zwischen Ungleichen. Dieses Prinzip wirkt bis heute fort. Trumps Venezuela-Politik ist keine Abweichung von der internationalen Ordnung, sondern deren entkernte Essenz. Die Regeln gelten, solange sie durchsetzbar sind. Daß diese Politik vielen als Rückfall in Imperialismus erscheint, ist nicht falsch, aber auch nicht neu. Neu ist lediglich die Offenheit, mit der sie betrieben wird.
Wo frühere US-Administrationen ihre Eingriffe moralisch aufluden, verzichtet Trump weitgehend auf diese Verpackung. Er spricht von Interessen, Sicherheit, Einflußzonen. Das macht die Politik nicht harmloser, aber ehrlicher. Mit dem Ende von Maduro fällt auch innerhalb der globalen „Achse des Widerstands“, rund um Peking, Moskau und Teheran, der südamerikanische Baustein dieses Gebildes, das sich eigentlich in Position gebracht hatte, um die US-amerikanische Hegemonie anzufechten. Während Venezuelas Regime fällt, wankt das in Teheran und auch Moskau kommt mit seinem Debakel in der Ukraine nicht voran. Bleibt nur noch Peking als letzter verbliebener Spieler auf dem Brett, der vollumfänglich handlungsfähig erscheint.
Ob der Zugriff der USA in Caracas langfristig stabilisierend wirkt oder neue Instabilitäten erzeugt, bleibt offen. Kurzfristig spricht vieles für einen erfolgreichen Regimewechsel. Mittelfristig hängt alles davon ab, ob Washington bereit ist, Verantwortung über den militärischen Moment hinaus zu übernehmen, oder ob Venezuela lediglich neu sortiert, nicht aber neu aufgebaut wird. An die Debakel Irak und Afghanistan dürften sich die Amerikaner noch erinnern. Sicher ist nur eines: Die Zeit, in der die USA ihre Macht in der westlichen Hemisphäre indirekt ausübten, scheint vorbei. Die Schwachen erdulden, was sie müssen. Die Starken tun, was sie können. Venezuela ist derzeit das Lehrbeispiel dieser alten, unbequemen Wahrheit. Aber die meisten Einwohner Venezuelas dürfte es freuen, daß Maduro nun weg ist.