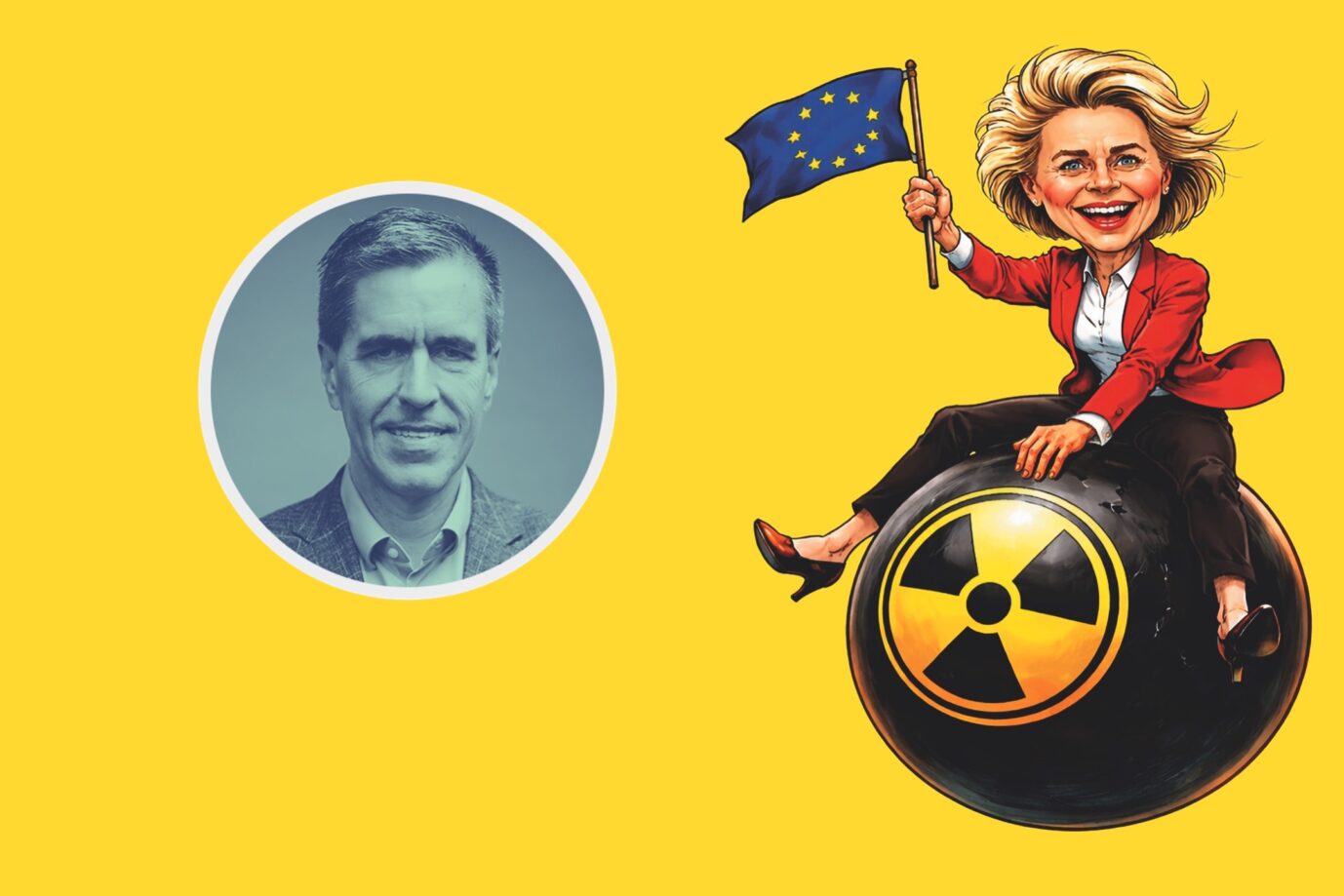Gut lassen sich die Grenzen der DDR auf wahlgeographischen Karten erkennen – früher an den Stimmenanteilen der PDS, jetzt der AfD. Das hat nicht nur äußerlich miteinander zu tun. Den Verständnisschlüssel bietet die Beobachtung, daß die AfD dort besonders stark ist, wo früher die CDU dominierte. Sie war jene „das westdeutsche System aufzwingende“ Partei, gegen die einst die PDS ostdeutschem Protest seine Stimme verschaffte. Jetzt spielt die AfD diese Rolle, weil sich zwar die Umstände geändert haben, doch wiederum die CDU als jene Partei gilt, die Ostdeutschland unwillkommene Zustände beschert hat.
Jahrelang gab es freilich wenig zu protestieren, weil Ostdeutschlands Landschaften eben doch zu blühen begannen, wenngleich mit etlichem Unkraut durchsetzt. Im Zug solcher Veralltäglichung des 1989/90 Ersehnten verlor die CDU an Anziehungskraft – zunächst im Norden der ehemaligen DDR, allmählich auch im Süden. An ihrer Statt rückte die PDS beziehungsweise die Linkspartei in so manche Landesregierung ein. Somit fehlte es jahrelang nicht nur an aktuellen Ursachen für Systemprotest, sondern auch an einer sprungbereiten Protestpartei.
Das änderte sich, als die in Sachsen und Thüringen weiterhin starke CDU sich im Zug ihres Generationenwechsels zu einer selbstgefälligen Funktionärspartei wandelte. Zugleich führte die große Popularität der langjährigen CDU-Vorsitzenden und Kanzlerin vielfach zur Arroganz ihrer Paladine. Jedenfalls schien vielen CDU-Landespolitikern ihr Ansehen am Berliner Hof wertvoller als die Verwurzelung ihrer Partei im vorpolitischen Raum ihrer Länder oder als das Mitfühlen mit der Stimmungslage in den gerade nicht tonangebenden, doch am Wahltag mitbestimmenden Reihen der Gesellschaft.
Anderes geschichtlich-kulturelles Profil
Doch Angela Merkel gründete ihre Popularität auf Demoskopie und auf spitzenjournalistisches Wohlwollen. Dadurch koppelte sie die von ihr geprägte CDU-Politik an mehrheitlich westdeutsche sowie an großstädtische Befindlichkeiten. Ostdeutschland hat aber ein anderes geschichtlich-kulturelles Profil als die westdeutschen Länder, und andere Großstädte grün-linker Prägung als Berlin oder Leipzig gibt es im Osten kaum. Also ging das Abheben der CDU vom Lebensgefühl der dort in überwiegend ländlichen Gebieten lebenden Bevölkerung nur so lange gut, wie Merkels Politik nicht in einen klaren Widerspruch zu den ostdeutschen Befindlichkeiten geriet.
Das begann unscheinbar, als Angela Merkel 2013 beim Jubel über einen Wahlsieg ihrem Generalsekretär ein Deutschland-Fähnchen wegnahm und es beiseite legte wie einen ungehörigen Gegenstand. Doch in Ostdeutschland wollte man ja nicht deshalb los von Moskau, um dann die eigene Nationalität in der EU loszuwerden.
Diesbezügliche Uneinsichtigkeit nicht nur der CDU-Führung wuchs sich aus zu einer die Partei nach unten ziehenden Vertrauenskrise, als Merkels Migrationspolitik von vielen (Ost-)Deutschen als grobe Verletzung ihrer Interessen wahrgenommen wurde, sie aber zu hören bekamen: Die Flüchtlinge sind nun einmal da, weitere werden kommen, und wer das kritisiert, erweist sich als Rassist oder Nazi. Diese Position machte sich – gemeinsam mit SPD und Grünen – aber die ganze offizielle CDU zu eigen. Das erlaubte es der AfD, sich als einziger Gegenpol zur CDU aufzubauen. Bald lagerte sie um das Migrationsthema alles nur Erdenkliche an Systemprotest. Das gelang, weil der sozialdemokratisierende und vergrünende Kurs der Merkel-CDU gar nicht wenige nicht-linke und nicht-mittige Leute politisch heimatlos machte, also rechts von der CDU eine Repräsentationslücke aufreißen ließ.
Nachdenken vermieden
Wie groß diese war, zeigten im Frühjahr 2016 die spektakulären Wahlerfolge der AfD bei ostdeutschen Landtagswahlen. Sie zogen auch im Westen die AfD merklich nach oben. Gemäß den Wählerwanderungsanalysen kamen jene AfD-Stimmen in sehr großem Umfang aus den Reihen früherer CDU-Wähler und Nichtwähler. In dieser Lage hätte die CDU überlegen können, warum sie – im Osten heftig, im Westen immerhin fühlbar – an die AfD verlor. Doch aus drei Gründen vermied die CDU solches Nachdenken.
Erstens glaubte man: Wenn der politische Kurs der Kanzlerin mit Stimmenverlusten einherging, dann lag das daran, daß politisch zurückgebliebene Ostdeutsche dessen Weisheit einfach nicht verstanden. Also war nicht der Kurs zu ändern, sondern die Kritik abzuweisen. Zweitens machte man sich das bequeme Deutungsschema zu eigen, daß der große Zuspruch für die AfD in den neuen Bundesländern nicht auf diskutable Einwände gegen Merkels Politik zurückgehe, sondern auf weitverbreiteten Rassismus und Faschismus. Den „bediene“ die AfD, weshalb man ihr am besten mit einem entschlossenen „Kampf gegen rechts“ entgegentrete. Also setzten sich ostdeutsche CDU-Politiker nicht nur scharf ab von der AfD als Partei, sondern auch von ihren Wählern.
Drittens glaubten CDU-Landespolitiker fest, sie könnten durch „stabiles Regieren“ – notfalls eben mit Sozialdemokraten oder Grünen – die Wählerschaft davon überzeugen, die CDU wäre eigentlich der politische Stabilitätsanker „in der Mitte“. Man wollte einfach nicht glauben, daß die CDU von großen Teilen ihrer abwandernden ostdeutschen Wählerschaft inzwischen als Partei der linken Mitte wahrgenommen wird. Den Aufstieg der AfD erkannten sie deshalb nicht als Warnsignal an die eigene Adresse. Für solche Uneinsichtigkeit wurden sie nun bestraft.
Gegen die CDU gerichteter Protest fand so in Ostdeutschland seine neue, wohl dauerhafte Partei – gerade dort, wo man der CDU früher geradezu kindlich vertraut hatte. Und nachdem die CDU so unbedarft einen Großteil ihrer Stammkundschaft verprellt hatte, wurde sie nun auch noch von jener Laufkundschaft verlassen, die Angela Merkel aus den Reihen sozialdemokratisch und grün Gesinnter angezogen hatte. Man wählte nämlich lieber das Original als die CDU-Kopie. Tatsächlich ist dieses für die Union üble Ende einer grandiosen politikstrategischen Fehlleistung längst vorhergesagt worden. Doch wer nicht hören will, muß eben fühlen.
————
Werner J. Patzelt ist emeritierter Lehrstuhlinhaber für Politikwissenschaft an der TU Dresden.
JF 40/21