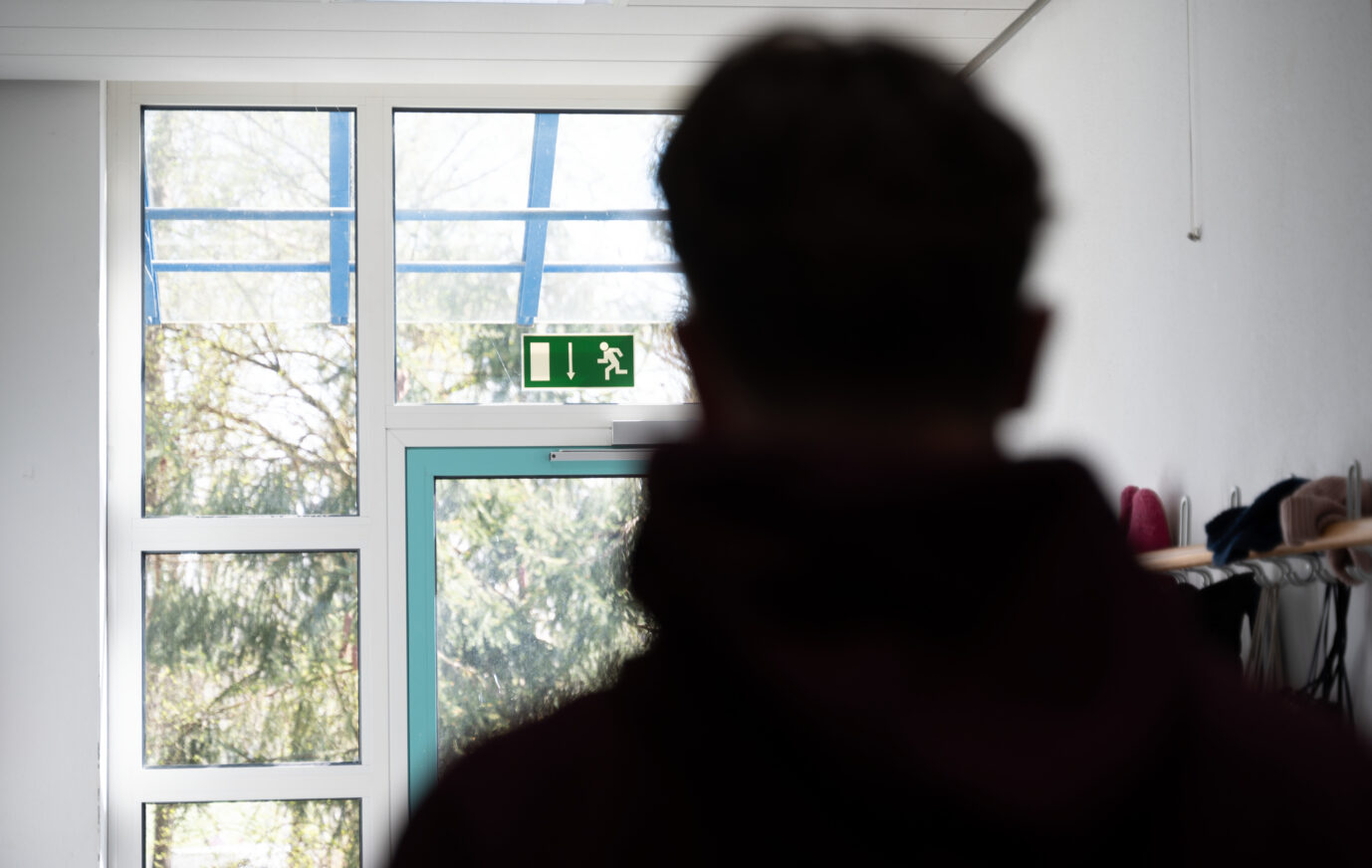Herr Professor Bolz, sind wir im Krieg gegen die Normalität?
Norbert Bolz: Ein klares Ja. Ich sehe sie sogar einem regelrechten Zangenangriff ausgesetzt.
Von wem?
Bolz: Der Wokeness einerseits – und dem Alarmismus andererseits: Die eine stellte das Verhältnis von normal und pathologisch auf den Kopf – der andere unser Verständnis von normal und extrem.
Konkret?
Bolz: Auf der einen Seite gilt das, was früher pathologisch war, heute als normal und das was früher als normal galt – oder wenn Sie so wollen, als bürgerlich – heute als pathologisch beziehungsweise „toxisch“, wie es heißt. Auf der anderen Seite werden wir ständig mit vorgeblichen Extremen konfrontiert: extremen Wetterlagen, einem kollabierenden Klima, Pandemien, dem angeblichen Ende unserer Demokratie etc. Kurz, es gibt im Grunde nur noch Extremsituationen und Ausnahmezustände – was den Übergang in eine despotische Politik sehr erleichtert.
Bolz: „Es droht nicht die Abschaffung, aber die Aushöhlung der Demokratie“
Also warnen Sie selbst vor dem Ende der Demokratie?
Bolz: Ich fürchte, das ist wohl der harte Kern, um den es in diesem Krieg geht. Wobei ich nicht sehe, daß die Abschaffung der Demokratie bevorsteht, wohl aber ihre immer weitere Aushöhlung: vergessen Sie nicht, daß Demokratie im wesentlichen Formsache ist, zum Beispiel freie Wahlen.
Daran wird man wohl auch festhalten, jedoch Seitenwege der Machtergreifung beschreiten, etwa in Gestalt einer Dauerpropaganda der etablierten Parteien, der Medien – vor allem der öffentlich-rechtlichen –, der Institutionen und der NGOs, die alle enormen Druck ausüben, um jeden Bereich der Gesellschaft zu ihren Gunsten zu politisieren.
Denken Sie zum Beispiel an die Politisierung der Justiz, dem vielleicht wichtigsten Schleichpfad zur Macht. Denn mit ihr kann man Politiken durchsetzen, die von der Mehrheit der Bevölkerung niemals mitgetragen werden würden, wie ja mittlerweile ganz offen ausgesprochen wird: Gerichte, so etwa die SPD-Verfassungsrichterin Ann-Katrin Kaufhold, „eignen sich zunächst besser, unpopuläre Maßnahmen anzuordnen“, da sie nicht wie Parlamente auf Wiederwahl angewiesen sind.
Womit wir wieder beim Thema Normalität wären.
Bolz: Richtig, sie ist es, die damit überwunden werden soll.
Warum?
Bolz: Weil sie die Stabilitätsbasis unserer Gesellschaft ist – während die große Transformation, von der inzwischen alle reden, alles umkrempeln will. Das begann schon mit den Jakobinern der Französischen Revolution. Danach entstand Mitte des 19. Jahrhunderts die Bohème: großstädtische Künstler und Intellektuelle, die herabblickten auf alles Bürgerliche, die sogenannten Spießbürger sowie die Bourgeoisie, und die neue Lebensformen ausprobierten.
Das nahm immer mehr zu und schließlich wurde es regelrecht schick, die Bürgerlichen zu kritisieren, ja lächerlich zu machen. So schick, daß die Bürgerlichen selbst davon angetan waren – und sogar dafür bezahlten, denn sie waren es, die der Bohème ihren Lebensstil finanzierten. Denken Sie zum Beispiel später an Peter Handkes Stück „Publikumsbeschimpfung“ von 1966, in dem das Theater seine zahlenden Besucher brüskiert.
Diese Faszination der Bürgerlichen für die, die ihre Werte und Lebensweise verachten, begegnet uns heute etwa bei den „Bobos“. Ein Begriff des US-Journalisten David Brooks, zusammengesetzt aus der jeweils ersten Silbe von Bourgeoisie und Bohème. Er bezeichnet wirtschaftlich extrem erfolgreiche Leute, die sich nach außen hin aber bohèmehaft geben – was heute heißt, in T-Shirt und Jeans herumzulaufen. Also ein Typ wie zum Beispiel Facebook-Gründer und Meta-Chef Mark Zuckerberg, den man, wenn man nicht weiß, wer er ist, äußerlich für einen kleinen Angestellten oder gar den Praktikanten halten würde.
Bei uns ist es aber vor allem umgekehrt: hierzulande tut das „Lumpenproletariat“, um Karl Marx Lieblingsausdruck zu verwenden, der Bohème so, als sei es das neue Bürgertum. Was etwa die Grünen für sich beanspruchen beziehungsweise die Linke, die behauptet, sie sei die neue Mitte der Gesellschaft.
Aber?
Bolz: In Wahrheit sind sie keine Bürgerlichen, sondern nichts anderes als Loser: Leute, die nichts können, nichts leisten und nichts sind, aber so auftreten, als wären sie „die“ Gesellschaft.

In Ihrem neuen Buch „Zurück zur Normalität. Mit Augenmaß und gesundem Menschenverstand“ sagen Sie allerdings, daß der Kampf gegen die Normalität nicht an sich falsch ist, sondern auch seine Berechtigung habe.
Bolz: Richtig, ein sehr wichtiger Punkt! Wir hatten schon geklärt, daß Normalität die Sicherheitsbasis der Gesellschaft ist. Doch wenn Sie immer auf Nummer Sicher gehen, nichts riskieren und nie etwas Neues ausprobieren, kommt es nicht zu Innovationen. Was es also braucht, ist ein Spannungsverhältnis von Normalität und Neuem.
Wenn das Neue aber, wie heute, die Normalität vernichten will, dann ist das ebenso verhängnisvoll, wie wenn die Normalität versucht, jede Neuerung zu unterbinden. Deshalb habe ich mich auch bemüht, im Buch einen modernen Konservativismus zu skizzieren, der dieser Dialektik Rechnung trägt und kein Festhalten an allem Alten um jeden Preis ist.
Das führt zur Frage, wie man unterscheiden kann, was destruktive – „irre“, wie Sie es nennen – Kritik an der Normalität ist und was legitime?
Bolz: Das muß eine Gesellschaft aushandeln – eben dazu brauchen wir aber eine funktionierende Demokratie, also das Gegenteil der Denk- und Sprechverbote, die immer weiter ausgebaut werden. Und die Änderungen müssen sich evolutionär vollziehen, nicht revolutionär, wie das die woke Linke erstrebt.
„Bunt und divers? Geistig leben wir in einer Art ‘Burka-Gesellschaft’“
Dieser gehe es, so die Analyse Ihres Buches, in Wahrheit einzig und allein darum, die bürgerliche Normalität zu zerstören und gar nicht um die Werte, die sie ständig im Munde führt. Inwiefern das?
Bolz: Nehmen Sie nur die Werte Diversität und Buntheit. Tatsächlich aber war unsere Gesellschaft noch nie so wenig bunt und divers wie heute. Geistig müßte man sie vielmehr als eine Art „Burka-Gesellschaft“ bezeichnen. Nein, Sie können all das, was sich hinter der Wokeness versammelt, nicht von seinem Pro her verstehen, also von den offiziellen Zielen, die verkündet werden.
Zum Beispiel „Queers for Palestine“: was für ein kompletter, weil in sich widersprüchlicher Schwachsinn! Vielmehr erschließt es sich nur von seinem Anti aus: Denn das ist es, was alle miteinander verbindet – in unserem Beispiel Queere, Linke und islamistische Hamas-Anhänger –, nämlich ihre Verachtung und Wut auf die bürgerliche Gesellschaft. Keiner der Woken interessiert sich wirklich für die Menschen in Gaza. Wofür sie sich interessieren, ist der Antikapitalismus und der Antisemitismus. Weil die Juden zum Westen gehören, weil sie eine enorm erfolgreiche Gesellschaft in einem ansonsten stagnierenden Umfeld sind und eine Art Vorposten der westlichen Welt.
Aus dem gleichen Grund hat übrigens die Linke auch ihre riesigen Umfragezuwächse von Anfang des Jahres, die sie bis heute hält: Nicht weil sie Sozialismus will – so ein Quatsch, die Leute wissen gar nicht wirklich, was das ist, und kein Mensch nimmt das ernst.
Nein, es geht um das Anti: gegen die Leistungsgesellschaft, die Mitte, die Normalität. Ebenso jene, die die Massenmigration befördern, auch ihnen geht es nicht um das Schicksal der Afrikaner, Afghanen oder Syrer. Alles was sie interessiert ist, diese Menschen zu instrumentalisieren, um die Verhältnisse hier zu destabilisieren.
Noch immer ist aber nicht klar, warum? Liberale Revolutionen richteten sich einst gegen die objektiv vorhandene Unterdrückung durch Adel und Kirche, die soziale Bewegung bis zum Ersten Weltkrieg gegen Not und Ausbeutung der Arbeiter. Woher aber heute der Haß auf die Normalität des Lebens?
Bolz: Anders als in den vorgenannten Fällen folgt es weniger einem Zweck, sondern ist vor allem Ressentiment: das Ressentiment von Verlierern, die mit den Leistungsanforderungen einer modernen Gesellschaft nicht klarkommen. Die aber in ihr Wege gefunden haben, um an etwas zu kommen, ohne etwas zu leisten, durch extra für sie präparierte Stellen und Ämter.
Mittlerweile gibt es ein massives Beschäftigungsprogramm etwa für junge Akademiker, die der Markt nicht braucht, die heute aber massenhaft in den sogenannten Geisteswissenschaften produziert werden. All ihre Beratungsstellen in NGOs, beim Staat oder für eine Wirtschaft, die sich wokewaschen will, leben vom Ressentiment gegen die bürgerliche Gesellschaft, das sie daher fleißig befeuern.
Die jüngere Wurzel all dessen sehen Sie in der Achtundsechziger-Bewegung. Damals, sagen Sie, seien „bereits all die Bomben gebaut worden, die nun in der Wokeness hochgehen“. Zugleich räumen Sie ein, selbst ein wenig von 1968 angekränkelt gewesen zu sein.
Bolz: Eigentlich bin ich für die Achtundsechziger zu jung, aber ja, als eine Art später Zaungast habe ich eine Zeitlang am Rande dazugehört. Warum? Weil Achtundsechzig noch analysieren und argumentieren konnte – im Gegensatz zu heute. Das ist der entscheidende Punkt: anders als damals steckt nun kein Gedanke mehr dahinter, sondern es geht nur noch um Emotionen: Ich fühle mich verletzt! Ich habe Angst! Ich bin beleidigt! Mehr kommt da nicht.
„Man kann ein Intellektueller und dennoch ein Idiot sein“
Achtundsechzig hat ja auch tiefe und kluge Gedanken beigetragen, aber zugleich auch viel Weltfremdes, Ideologisches, Verschwörungstheoretisches sowie vor allem viel Neurotisches. Kurz, war Achtundsechzig im Grunde nicht bereits ebenso „irre“ wie die Wokeness heute?
Bolz: Dem widerspricht meine Argumentation gar nicht. Der Finanzmathematiker Nassim Nickolas Taleb hat es schön auf den Punkt gebracht: „Intellectual yet idiot“ – man kann ein Intellektueller und dennoch ein Idiot sein. So war Achtundsechzig. Völlig verblasene Ideen, aber auch intellektuell anspruchsvoll, argumentativ gut, rhetorisch geschickt.
Von 1968 aus ist der Irrsinn immer weiter in die Gesellschaft vorgedrungen. Die Weichen für das Gleis, auf dem wir heute fahren, wurde also schon vor Jahrzehnten Stück um Stück falsch gestellt. Hätten Sie ergo nicht schon viel früher protestieren müssen?
Bolz: Ja, absolut richtig. Ich bin ein langsamer Lerner. Vor allem aber habe ich als junger Mensch Tag und Nacht nur Adorno, Walter Benjamin und ähnliche Autoren gelesen. Ich kam aus proletarischen Verhältnissen, und sie erschienen mir als Offenbarung. Erst später erkannte ich, vor allem durch meine Zeit als Assistent des Religionsphilosophen Jacob Taubes, was für ein Mist das ist und wurde angehalten, anderes zu lesen.
Es dauerte dann, um auf einen angemessenen intellektuellen Stand zu kommen, etwa Freud, Nietzsche, Carl Schmitt oder Hans Blumenberg zu lesen, und zwar komplett und am besten mehrfach. Dazu kommt, daß es Mut braucht, um aus der Mainstream-Blase auszusteigen. Und letztlich hatte ich diesen Mut erst mit meiner Pensionierung 2018.
„Am Ende wird die Normalität diesen Krieg gewinnen“
Im Grunde ist Ihr Buch zu einhundert Prozent eine Zusammenfassung der Gedanken, Werte und Weltanschauung, die diese Zeitung seit ihrer Gründung 1986 vertritt. Wie haben Sie bis 2018 auf all jene geblickt, die damals schon diese Inhalte vertreten haben?
Bolz: Mir war ja schon lange klar, daß in dieser Gesellschaft einiges falsch läuft. Aber wie gesagt, aus Gründen der Taktik konnte ich das nur bedingt äußern. Erlauben Sie mir statt einer weiteren Antwort eine Leseempfehlung: „Persecution and the Art of Writing“, also „Verfolgung und die Kunst des Schreibens“, ein Aufsatz, in dem der Philosoph Leo Strauss darlegt, daß man, wenn man in einer Welt lebt, in der kritisches Denken verfolgt wird, entweder im Gefängnis landet oder lernt, geschickt zu schreiben. Es gibt wohl leider kaum einen Text, der wichtiger für unsere Zeit ist als dieser.
Das klingt pessimistisch, dabei sagen Sie in Ihrem Buch, die größte Falle, in die man gehen könne, sei die der Resignation.
Bolz: Richtig, und mein ganzes Buch zielt darauf, nicht in diese zu tappen! Und zwar auch deshalb nicht, weil ich zuversichtlich bin, daß die Vernunft den Krieg um die Normalität am Ende gewinnen wird. Mein Buch verstehe ich dabei als Beitrag dazu, all jene, die diesen Kampf führen, aufzumunitionieren. Denn nach meiner Erfahrung gibt es sehr viele Menschen, die die Entwicklung ebenso kritisch erkennen, die das aber nicht so gut ausdrücken können. Diesen Leuten will ich helfen, ihre Gedanken in Worte zu fassen.
Resignation kann aber übrigens auch deshalb nicht in Frage kommen, weil es um zu viel geht. Denn man darf nicht vergessen, daß die bürgerliche Gesellschaft historisch gesehen etwas extrem Unwahrscheinliches ist. Und daß wir uns unendlich glücklich schätzen können, daß dieses unwahrscheinliche Ergebnis der gesellschaftlichen Evolution bei uns im Westen auf seinen Höhepunkt gekommen ist. Nirgendwo sonst in der Welt ist das passiert, und wir sollten uns dessen bewußt sein, gerade weil wir gewöhnt sind, es fälschlich für selbstverständlich zu halten. Und deshalb müssen wir auch alles tun, um unsere bürgerliche Gesellschaft zu bewahren.
__________
Prof. Dr. Norbert Bolz. Der Medien- und Kommunikationswissenschaftler, geboren 1953 in Ludwigshafen, lehrte bis zu seiner Emeritierung 2018 an der TU Berlin. Rüdiger Safranski würdigte ihn als einen „herausragenden philosophischen Zeitdiagnostiker“, dessen Bücher „die Gegenwart reflektieren, zum Widerspruch reizen und Vergnügen bereiten“.
Zu Bolz’ bekannten Titeln zählen „Die Helden der Familie“ (2006), in dem er den schleichenden Trend zu deren Auflösung durch Hedonismus, Gesellschafts- und Sozialpolitik aufzeigte. Zudem „Zurück zu Luther“ (2016), „Die Avantgarde der Angst“ (2020) und „Keine Macht der Moral!“ (2021). Zuletzt erschienen „Der alte weiße Mann. Sündenbock der Nation“ (2023), „Christentum ohne Christenheit“ (2025) sowie jetzt aktuell „Zurück zur Normalität. Mit Augenmaß und gesundem Menschenverstand“.