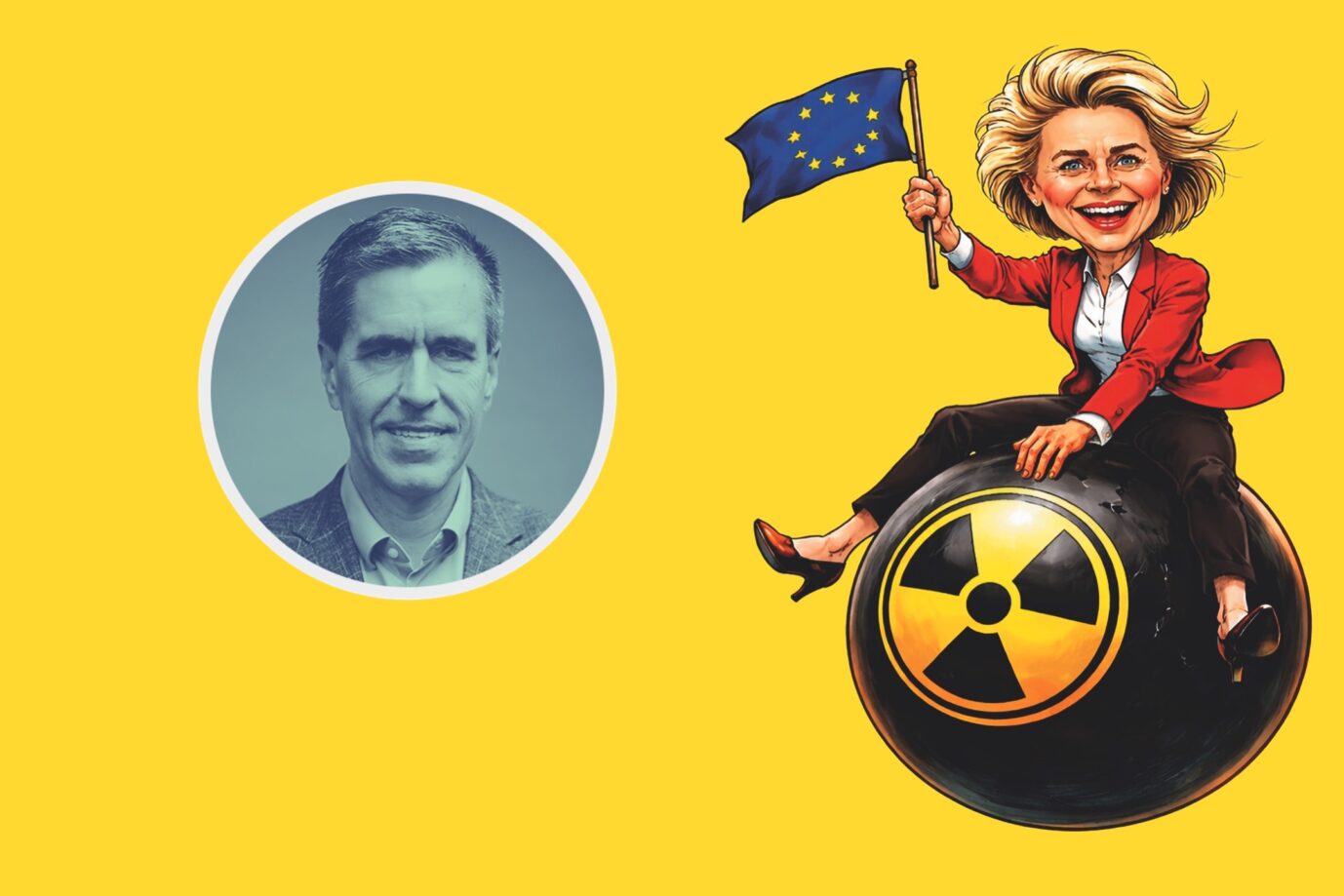Die Debatte um die Nachfolge von Angela Merkel ist entbrannt. Es geht dabei zuerst um eine Personaldebatte. Wird es Jens Spahn? Wird es Annegret Kramp-Karrenbauer? Wird es Friedrich Merz? Wird es irgendein anderer, der seinen Hut noch nicht in den Ring geworfen hat?
Zum gegenwärtigen Zeitpunkt kann auf diese Fragen niemand eine sichere Antwort geben. Spahn war schon als Reservekanzler gehandelt worden und hat sich als Halboppositioneller ein gewisses Renommee verschafft. Aber endlich an den Kabinettstisch gelangt, lief der Prozeß der Entzauberung in atemberaubendem Tempo ab. Dasselbe wird man von Kramp-Karrenbauer nicht sagen können.
Kramp-Karrenbauer stünde für Kontinuität
Aber wenn sie an die Spitze der CDU und dann auch einer Regierung träte, stünde das für Kontinuität. Sie gehört zu jenem Frauentyp, der seit den 1980er Jahren in der Partei stark geworden ist, als man die „weichen Themen“ entdeckte und sich auf diese Weise neue urbane Wählerschichten erschloß.
Dagegen gab es innerhalb der Union immer eine latente Opposition, und diejenigen, die jetzt Merz auf den Schild heben möchten, glauben, daß der Widerstand über die Zeit stark genug geblieben ist, um die Christdemokraten noch einmal auf Inhalte zu verpflichten, die lange Zeit als ihr „Markenkern“ galten: Patriotismus, Marktwirtschaft, Innere Sicherheit, militärische Westbindung.
Das Problem mit diesem „Markenkern“ ist allerdings, daß er kaum noch dieselbe Wählerzahl binden dürfte wie ehedem. Denn der schon in der Ära Kohl angebahnte Kurswechsel der Union war ja nicht nur das Ergebnis von Einflußnahmen der „Eierköpfe“ aus dem Adenauer-Haus, sondern auch eine Reaktion auf den Generationenwechsel, die Macht des progressiven Zeitgeistes und das Versagen älterer Konzepte.
Die CDU wurde zum „Kanzlerwahlverein“
In den Nachkriegsjahren wurde etwas boshaft, aber nicht ganz falsch gesagt, daß die CDU die „Dauerkoalition von Zentrum und Deutschnationalen“ sei. Was bedeutete, daß die Erosion derjenigen Milieus, auf die sie sich bis dahin verlassen konnte – der katholische Bevölkerungsteil, das kirchlich gebundene Bürgertum, eine Mehrheit der Vertriebenen und der Konservativen – zu einem Strategiewechsel führen mußte.
Nur für einen Moment hat man daran gedacht, den Schritt nach rechts zu machen, etwa zwischen der Diskussion über die „Formierte Gesellschaft“ und dem Kampf um die „Ostverträge“. Dann verwarf man diese Option und besann sich auf etwas, das für die Union immer eine ungleich wichtigere Rolle gespielt hat als die ideologische Ausrichtung: der Erfolg als „Kanzlerwahlverein“.
In den fast siebzig Jahren ihres Bestehens ist die Bundesrepublik fast immer durch einen Vertreter der CDU regiert worden. Ein derartiger Erfolg ist nur um den Preis einer gewissen Flexibilität zu haben. Parteien, die sich weniger durch ihre Prinzipientreue, sondern eher dadurch leiten lassen, daß sie günstige Gelegenheiten wahrnehmen, nannte man zuerst in Frankreich „opportunistisch“.
Populisten bewirken Reideologisierung
Der Begriff war nur feststellend gemeint, erhielt aber einen immer stärker negativen Beigeschmack. Das hatte seinen Grund darin, daß die Entscheidungen der Opportunisten oft nichts mit Sacherwägungen zu tun hatten und insofern „pragmatisch“ waren, sondern mit Vorteilsnahme, individueller oder kollektiver.
Sobald die Aussicht auf irgendeine Art von Prämie für die Parteizugehörigkeit oder -unterstützung schwindet, verlieren die Opportunisten ihren Rückhalt. Das Schicksal des traditionellen Parteiensystems in Italien, Frankreich und Spanien ist ganz wesentlich durch diesen Vorgang gekennzeichnet.
Allerdings spielte hier auch noch ein anderer Faktor mit: der Aufstieg des Populismus. Der hat einen Prozeß eingeleitet, den man als Reideologisierung bezeichnen könnte. Das heißt politische Stellungnahmen der Bevölkerung haben immer weniger mit Kalkül zu tun, dafür immer mehr mit grundsätzlichen Erwägungen. Die überraschenden Zugewinne der Grünen wie der AfD sind dadurch genauso zu erklären wie die Verluste der alten Volksparteien, etwa der CDU.
Merz war jahrelang nur Beobachter
Die ist von ihrer ganzen Struktur kaum fähig, auf die neue Situation zu reagieren. Über einen langen Zeitraum hat ihr Apparat Funktionäre in Spitzenpositionen befördert, die bestimmt das tägliche Geschäft verstehen und sich im Gestrüpp des parlamentarischen Kleinkampfes zurechtfinden. Aber ob ein Spahn oder eine Kramp-Karrenbauer in der Lage wären, eine Kurskorrektur zu vollziehen, die die Linie Merkels grundsätzlich ändern würde, darf man bezweifeln.
Im Falle von Merz ist das nicht so leicht zu sagen. Er besitzt zweifellos Intelligenz, Führungsstärke und Konfliktfähigkeit sowie einen Sinn für Programmatik. Aber ob sein Politikstil in der heutigen Union noch mehrheitsfähig wäre, bleibt fraglich. Die Kommentatoren, die schon frohlocken, ein Parteivorsitzender und dann Kanzler Merz würde die CDU zu neuer Stärke führen und die AfD von der Bildfläche verschwinden lassen, vergessen, was in den vergangenen zehn Jahren geschehen ist, in denen Merz nur Beobachter des Berliner Geschehens war, und sich vieles, sehr vieles verändert hat.