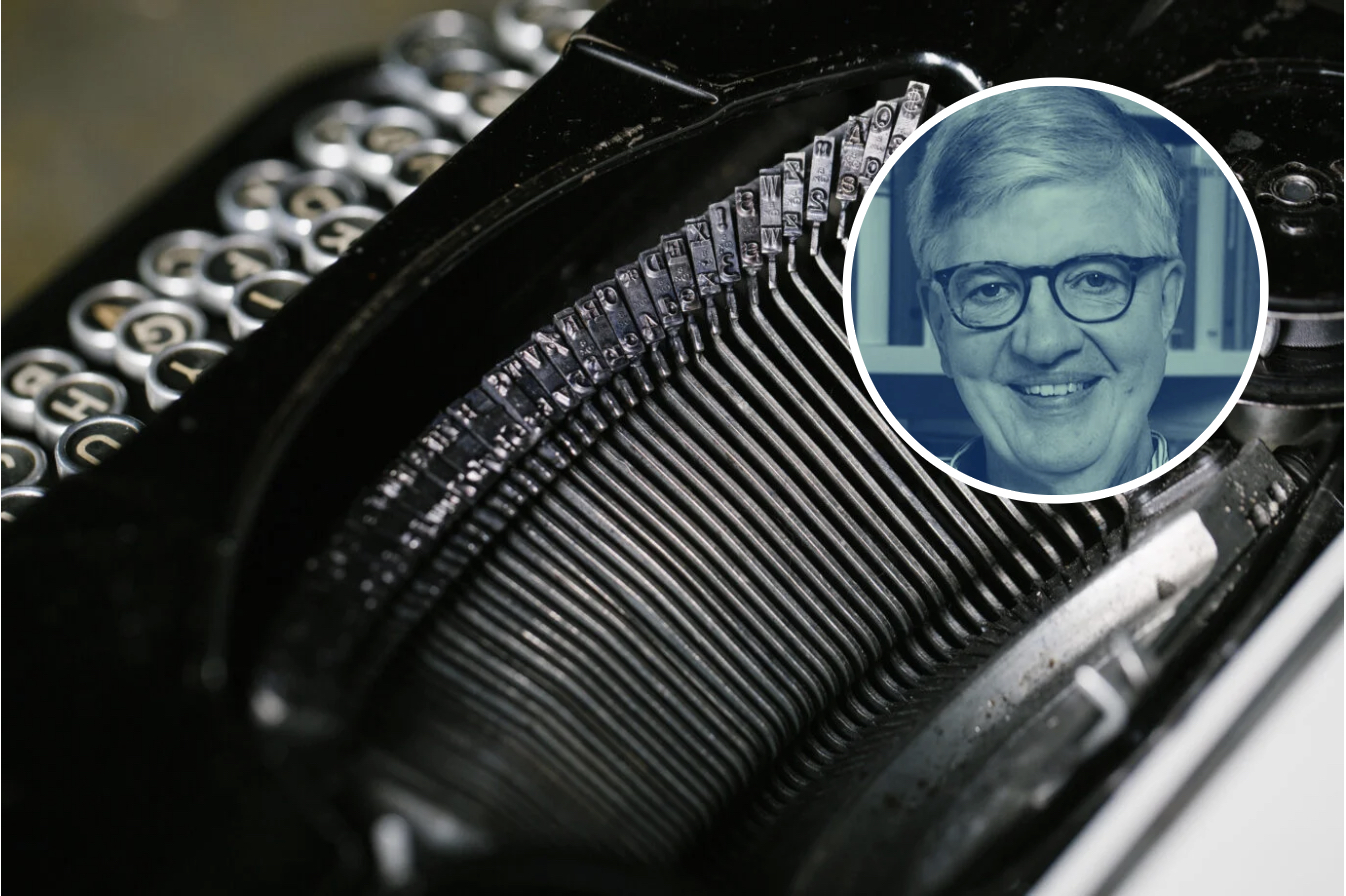Bernard Lugan ist in Deutschland ein Unbekannter. Keines seiner Bücher, nicht einmal die voluminöse „Geschichte Afrikas“, wurde bisher übersetzt. Das ist bedauerlich, umso bedauerlicher, als es sich bei Lugan um einen Afrikanisten handelt, der ein ausgewiesener Fachmann ist und gleichzeitig Widerstand gegen jene Mischung aus Ideologie und Niveauverfall leistet, die im Namen der „Dekolonialisierung“ auftritt.
Lugans neueste Veröffentlichung Pour répondre aux „Decoloniaux“, aux Islamo-gauchistes et aux Terroristes de la Repentance, Panissières ist eine fulminante Abrechnung mit dieser Ideologie. Im Zentrum steht dabei die These, daß alles, was wir in der letzten Zeit an wokeness, „Black Lives Matter“, Denkmalssturz, Antirassismus und Diversity-Propaganda erlebt haben, zu den Folgewirkungen eines Kulturkrieges gehört, der seit den 1960er Jahren nur ein Ziel kennt: die Auslöschung all dessen, was weiß und männlich ist und irgendwie auf die europäische Hochkultur zurückgeht.
Der Angriff war nach Lugan deshalb so erfolgreich, weil er mit der Durchsetzung des Egalitarismus als Leitideologie einerseits, mit der Bildungsexpansion andererseits zusammenging. In seinem Land, das bereits eine Abiturientenrate von mehr als 80 Prozent aufweist, haben immer mehr junge Leute eine Studienberechtigung, deren Intelligenz und Kenntnisstand aber weder für die mathematischen und naturwissenschaftlichen Disziplinen ausreicht, noch für das Bestehen der Eingangsprüfungen an einer renommierten Universität. Trotzdem strömen die Betreffenden an die Hochschulen zweiten und dritten Ranges und dort vor allem in die Geistes-, Sozial- und Pseudowissenschaften wie „Gender“ oder „Postcolonial Studies“.
„Man muß alle Weißen vergasen“
Während der vergangenen zehn Jahre hat es nach Lugan in letzterem „Fach“ mehr als 1.000 Promotionen gegeben, die für nichts anderes qualifizieren, als die Tätigkeit in irgendeiner Lobbygruppe irgendeiner Minderheit, in der immer weiterwachsenden Betreuungsindustrie oder dem Politisch-Medialen Komplex. Nichts davon ist produktiv, was auch eine Ursache für die besondere Aggressivität der „Postkolonialisten“ sein dürfte, die auf Kosten der Allgemeinheit leben, die sie zum Dank nach Kräften beschimpfen.

So zitiert Lugan die Aktivistin Afsa Aksar aus ihrer Zeit als Vizepräsidentin des größten französischen Studentenverbandes, der UNEF (Union national des étudiants de France), mit den Sätzen: „Man muß alle Weißen vergasen, diese Unter[menschen]rasse“ – „Alles, was ich gesagt habe, ist: Weiße hört auf, Euch fortzupflanzen.“ – „Nein zur Vermischung mit den Weißen“ – „Die Welt wäre besser ohne die Weißen“.
Kaum maßvoller erscheint die Einlassung von Houria Bouteldja, der Vorsitzenden der Migrantenpartei Parti des Indigènes de la République (PIR), die die Zerstörung des „ewigen und gallischen Frankreich“ mittels Bevölkerungsaustausch zum politischen Hauptziel erklärt; es gehe darum, „die älteste Tochter der Kirche, das vor langer Zeit weiße“ Frankreich, „zu afrikanisieren, zu arabisieren, zu berberisieren, zu kreolisieren, zu islamisieren, einzuschwärzen“.
Frankreichs Festhalten an Kolonien sei ein Fehler gewesen
Wenn auf solche Unverschämtheiten kaum reagiert wird, führt Lugan das auf den Beifall der progressiven Intelligenz, auf die notorische Feigheit der Bürgerlichen, die Sondergesetze zur Unterdrückung der Meinungsfreiheit und auf eine methodisch betriebene Verfälschung der Geschichte zurück. Die beginnt im Fall Frankreichs damit, daß man vergessen zu machen sucht, welchen Ursprung der eigene Kolonialismus hatte. Denn der war ein Projekt der Linken, die im Namen von Aufklärung und Fortschritt die Überzeugung vertrat, daß es das „Recht“ der „überlegenen Rassen“ sei, die „unterlegenen Rassen“ – gemeint waren die Farbigen – auf den richtigen Weg zu bringen.
Die Formulierung stammte von Jules Ferry, einem der einflußreichsten Politiker der Dritten Republik, der am Ende des 19. Jahrhunderts neben afrikanischen Territorien auch Teile Vietnams dem Empire einverleibte. Wenn Ferry bei den Liberalen für Unterstützung warb, indem er die Kolonien zu einem „guten Geschäft“ erklärte, verschwieg er allerdings, daß dieses Geschäft nur auf Kosten der Allgemeinheit lukrativ sein konnte. Minutiös rechnet Lugan vor, welche immense finanzielle Last die Überseeterritorien für das Mutterland bedeuteten. Dabei ging es nicht nur um die Investitionen in Infrastruktur, Bildung, Erziehung und Gesundheitswesen, sondern auch um eine Wirtschaftsordnung, die Waren aus den Kolonien eine Abnahme garantierte, obwohl deren Preis regelmäßig über dem des Weltmarktes lag. Gleichzeitig wurde die Zuwanderung aus den europäischen Nachbarländern drastisch beschränkt, um den Bevölkerungsüberschuß vor allem Algeriens (eine Folge „weißer“ Medikation) aufzunehmen.
Die Zähigkeit, mit der die Vierte Republik an den Kolonien festhielt, war aus Lugans Sicht ein Fehler, die Brutalität, mit der de Gaulle sie abstieß, eine Notwendigkeit. Ein Glück für Frankreich, fügt er hinzu, aber ein Unglück für das nordafrikanische Gebiet. Lugan betrachtet die Entkolonialisierung als dritte Großkatastrophe in der Geschichte Afrikas: die erste war jener Klimawandel, der die „grüne Sahara-Zeit“ im ersten Jahrtausend vor Christus beendete und weite Gebiete unbewohnbar werden ließ, die zweite der Siegeszug des Islam, der nach einer langen Unterbrechung in jüngster Zeit wieder Tempo gewinnt, die dritte der Entschluß der Europäer, sich zurückzuziehen.
Europäer beendeten die Sklaverei
Dieser letzte Punkt dürfte die Leser am stärksten überraschen. Aber Lugan führt detailliert aus, in welcher Verfassung Afrika sich bei der Entlassung in die Unabhängigkeit befand und wie Unfähigkeit, Verblendung, Korruption und der „demographische Selbstmord“ in Folge ungehemmten Bevölkerungswachstums alles zunichtemachten, was von den Weißen aufgebaut worden war.
Die außerordentlichen Leistungen, die die Europäer für Afrika erbrachten, macht Lugan nicht nur daran deutlich, daß dessen subsaharischer Teil vor der Ankunft der Weißen weder Rad noch Flaschenzug kannte, sondern auch daran, daß es bis dahin keine funktionierende Vorratshaltung oder Schädlingsbekämpfung gab, kein Verfahren zur Brunnenbohrung und Hunger wie Seuchen als gottgegebene Plage galten. Die von den Dekolonialisten ins Feld geführte Behauptung, der Kolonialismus habe Afrika an einer selbstbestimmten „Entwicklung“ gehindert, sei aber vor allem deshalb absurd, weil im Grunde jede differenzierte Sozialordnung des Kontinents auf Sklaverei beruhte. Es sei festzuhalten, daß allein Europa die Sklaverei aufgegeben habe und die Sklaverei außerhalb Europas nur da beseitigt werden konnte, wo Europäer die Macht übernahmen.

Die von dem amtierenden französischen Staatspräsidenten geäußerte Meinung, daß Kolonialismus als „Verbrechen gegen die Menschlichkeit“ zu betrachten sei oder die von den Meisterdenkern der Postkolonialisten in die Welt gesetzte These, es habe sich um eine Entsprechung zu „Auschwitz“ gehandelt, müßten schon deshalb als Ausdruck von Ignoranz oder Böswilligkeit betrachtet werden. Wenn sich trotzdem kein Protest erhebt, führt Lugan das auf das Versagen seiner eigenen Disziplin, der Afrikanistik, zurück, aber auch auf die Folgen jener Gehirnwäsche, der der Westen unterworfen wurde, um in Köpfen und Herzen Selbsthaß, Hinnahme von Ausplünderung und die Vergötzung des „edlen Wilden“ zu verankern.
Quotenregelungen führen zu absurden Doppelbesetzungen
Als dessen letzten Repräsentanten betrachtet Lugan Nelson Mandela. Im Schlußteil seines Buches geht es deshalb um die Frage, welchen Weg Südafrika, dieser letzte weiße Vorposten auf dem schwarzen Kontinent, nach dem Ende der Apartheid genommen hat. Heute gehört Südafrika, trotz seiner enormen Vorkommen an Bodenschätzen, zu den fünf leistungsschwächsten Staaten Afrikas. Nach offiziellen Angaben liegt die Arbeitslosigkeit bei 28 Prozent, realistisch dürften 40 Prozent sein. Das Realeinkommen der ärmsten Bevölkerungsgruppen hat sich gegenüber der Zeit des alten Regimes halbiert; ein Drittel der Einwohner bleibt dauernd auf staatliche Hilfe angewiesen. Das Bruttoinlandsprodukt ist im freien Fall. Der für den Reichtum des Landes entscheidende Bergbausektor kollabiert, da die Mittel zur notwendigen Modernisierung nicht aufgebracht werden können.
Gleichzeitig hat man in den Minenarbeitern – einst besonders treue Anhänger des ANC – eine sich zunehmend radikalisierende politische Klientel, die auf Erfüllung der Versprechen beharrt, die während der „Kampfzeit“ gemacht wurden. Die Idee einer permanenten „Wiedergutmachung“ bestimmt auch das Black Economic Empowerment mit seinen Rassenquoten, das für die Unternehmen zu immer bizarreren Konsequenzen führt (etwa die Doppelbesetzung von Leitungspositionen mit einem Quotierten und einem, der die Arbeit macht).

Im Grunde funktioniert lediglich die nach wie vor von Weißen dominierte Landwirtschaft. Die verbliebenen Farmer, meistens burischer oder britischer Herkunft, sind allerdings nicht nur der permanenten Drohung mit Enteignung, sondern auch schutzlos gewalttätigen Anschlägen ausgeliefert. In mancher Hinsicht ähnelt ihr Schicksal dem anderer – schwarzer – „Fremder“, die in Südafrika regelmäßig das Opfer von Pogromen und Vertreibungen werden.
Der weiße Mann kann die Last nicht schultern
Aber beide Vorgänge können auch in einen noch größeren Kontext eingeordnet werden, den Lugan als Überantwortung des Landes an das „Gesetz des Dschungels“ bezeichnet: Statistisch gesehen werden in Südafrika an jedem Tag 58 Menschen ermordet, das sind im Jahr 36 von 100.000 Einwohnern. Der weltweite Durchschnitt liegt bei 7 von 100.000. Das Land bewegt sich damit auf dem Niveau von Kolumbien (31,8) oder El Salvador (39,8), in denen latenter Bürgerkrieg herrscht. Faktisch haben seit dem Ende der Apartheid in Südafrika mehr als eine halbe Million Menschen ihr Leben als Folge eines Gewaltakts verloren, hinzu kommen 1,5 Millionen Vergewaltigungen und 11 Millionen tätliche Angriffe.
Julius Malema, ein führender Kopf der südafrikanischen Linken und ausgesprochener Burenhasser, kam schon zu der bemerkenswerten Einsicht: „In Südafrika ist die Situation schlimmer als unter der Apartheid. Die einzige Sache, die gewechselt hat, ist, daß eine weiße Regierung durch eine Regierung von Schwarzen ersetzt wurde.“
Lugan könnte das mit Genugtuung aufnehmen, was er aber nicht tut. Seiner Darstellung der Verhältnisse ist die Trauer anzumerken, die sicher auch auf seine Herkunft aus dem ehemaligen Französisch-Marokko und darauf zurückzuführen ist, daß er einen Teil seines Lebens in Afrika verbracht hat. Lugan sieht allerdings keine Lösung des Problems und schon wegen des gefährlichen Unsinns, der regelmäßig über den Kolonialismus und die Rolle der Europäer verbreitet wird, keine Möglichkeit, „the white man’s burden“ (Rudyard Kipling), „des weißen Mannes Last“, noch einmal zu schultern.
———————————————–
Bernard Lugan: Pour répondre aux „Decoloniaux“, aux Islamo-gauchistes et aux Terroristes de la Repentance, Panissières: Lugan, kartoniert, 264 S., mehrere farbige Karten und Tafeln, € 25.00, zu beziehen über www.bernard-lugan.com