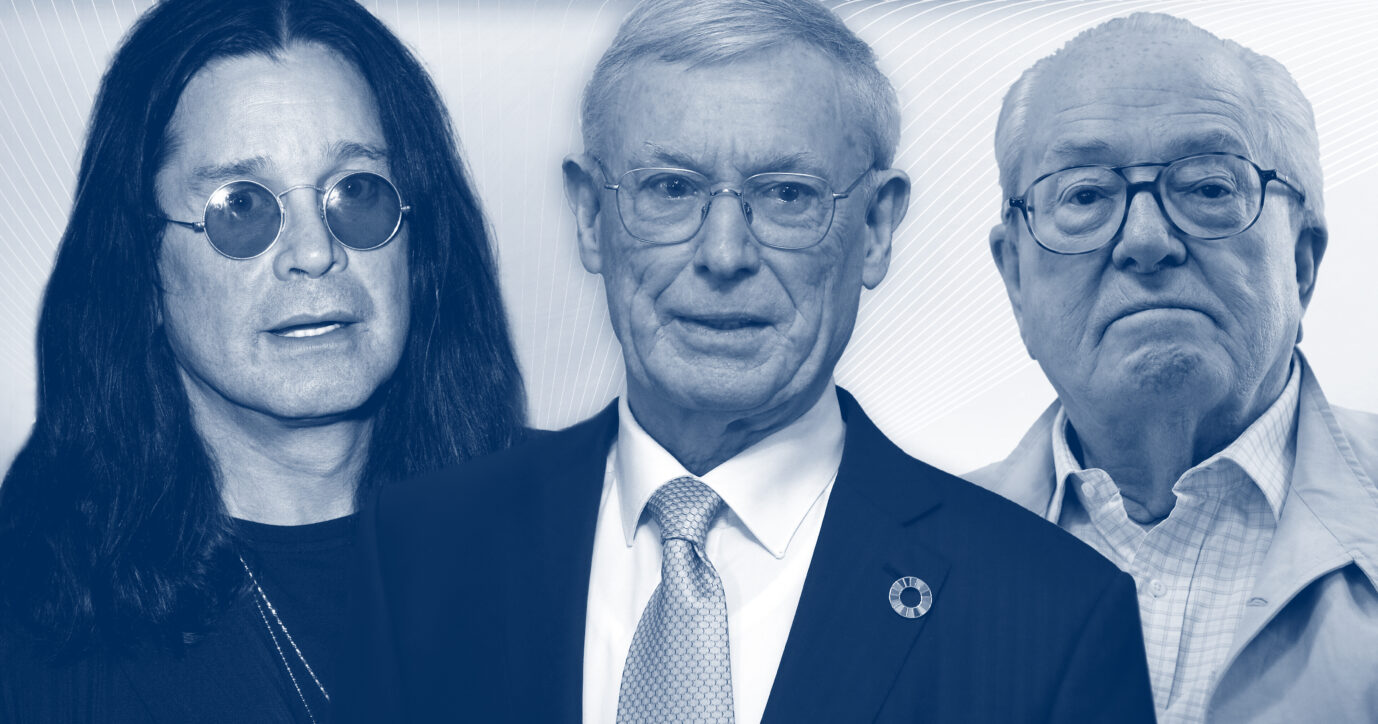Eigentlich hatte es der britische Ambient-Musiker Brian Eno bereits Mitte der 1990er Jahre perfekt in Worte gefaßt: „Was auch immer Sie an einem neuen Medium seltsam, häßlich, unangenehm und widerwärtig finden, wird sicherlich zu seinem Markenzeichen werden.“ Seien es die Verzerrungen von CDs, das Flimmern und Krisseln von Digitalvideos, der schlechte Klang von 8-Bit-Sounds – „es ist der Klang des Scheiterns: So viel moderne Kunst ist der Klang von Dingen, die außer Kontrolle geraten, von einem Medium, das an seine Grenzen stößt und auseinanderbricht“, schrieb Eno damals in seinem Buch „A Year With Swollen Appendices“.
Das verzerrte und übersteuerte Dröhnen elektrischer Gitarren, das „ausgebleichte Schwarz-Weiß“ körniger alter Filme – es gehe um die „Faszination, Ereignisse mitzuerleben, die zu bedeutend sind für das Medium, das sie aufzeichnen soll“. Mit anderen Worten: Ein „schlechter“ Klang oder ein „schlechtes“ Bild sind manchmal intensiver als ein sauberer Klang und ein glattes Bild. Wer vielleicht noch Schallplatten sein eigen nennt und bei dem geheimnisvollen Knistern des Nadelauflegens in nostalgische Schwärmerei verfällt, mag verstehen, was Brian Eno damals meinte.
Musik, die zu klar und zu akkurat produziert ist, kann dementsprechend manchmal mehr verlieren als dazugewinnen. Töne, die roh und ungeschliffen klingen, wirken plötzlich glatt. Unbestimmbare, mysteriöse Polyphonien werden mit einem Mal aufgelöst, einordbar. Im Zweifelsfall können ganze Musikgenres darunter leiden, unter professionellen Bedingungen produziert zu werden.
Gitarre und Bass vermischen sich zu einem Surren
Keine allzu kontroverse Behauptung ist dies etwa innerhalb der Black-Metal-Szene. Der rauhe, verwaschene Klang der meisten frühen Genre-Veröffentlichungen, von Mayhem’s Deathcrush aus dem Jahr 1987 über die ersten Alben der norwegischen Ein-Mann-Band Burzum, bei dem die Gitarren und der Baß zu einem gemeinsamen undefinierbaren Surren verschwammen und die Schreie derart dumpf hallen, als drängten sie aus einem schlecht gelüfteten Keller an die Oberfläche, läßt augenblicklich Bilder im Kopf entstehen, für die sich Bands mit deutlich ausgefuchsterem Aufnahmeequipment vergeblich abstrampeln. Deutlich machte das der Mann hinter Burzum, Varg Vikernes, sogar selbst, als er im Jahr 2011 seine eigenen alten Stücke nochmal in besserer Qualität aufnahm – und sie dabei ihrer eigentlichen Atmosphäre fast völlig beraubte.
Einige Protagonisten trieben das Spiel um den Klang sogar so weit, daß sie beinahe eigene Sub-Genres schufen. Bei den Demos und Alben des russischen Kollektivs Blazebirth Hall von einem „rohen Sound“ zu sprechen, wäre etwa eine maßlose Untertreibung. Gitarre, Baß, Schlagzeug und das ständig präsente analoge Rauschen irgendwelcher drittklassiger Kassettenbänder, auf denen die Musik ursprünglich aufgenommen wurde, formen hier einen klirrenden Brei, frei von jeder üblichen Liedstruktur. In seiner monotonen ständigen Wiederholung einzelner simpler Riffs erinnern die Aufnahmen weniger an Metal als an halbzerstörte Ambient-Aufnahmen.
Wer Shoegaze begreifen will, muß sich frühe Demos anhören
Auch im Shoegaze hat man das Prinzip mittlerweile verstanden. Was das nun wieder ist? Es handelt sich um ein zu Beginn der 1990er Jahre entstandenes Unter-Genre des Alternative Rock. Das Prinzip: Auf die Gitarre werden gefühlt 200 Hall- und Echoeffekte gelegt, die Melodien sind verträumt und warm, die Lieder bewegen sich vorwärts wie Kumuluswolken an einem Sommertag, sie schweben mehr, als daß sie einer Struktur folgen.
Wer sich das in seiner ganzen Magie anhören will, greift zu dem Debütdemo Mayfield der Gruppe Drop Nineteens aus dem Jahr 1991. In dem gleichnamigen Titelstück groovt eine Baßmelodie vor sich hin, das Schlagzeug groovt mit – und die Gitarren wabern. Ein Sound wie Wasser, Klänge, die nach allen Seiten ausgreifen. Es läßt sich kaum entziffern, was Gitarre, was möglicherweise ein Keyboard oder ein menschlicher Chor ist.
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Als Shoegaze in den frühen 2010ern ein Revival erlebte, schien es hingegen eine Weile zu dauern, bis die neuen Musiker den eigentlichen Reiz des Genres so ganz begriffen hatten. Ja, auch die Alben von Bands wie The Fauns oder Fear of Men hatten ein paar knuffige Lieder. Aber sie waren eben zugleich zu brav und vorhersehbar, jede Note saß an ihrem Punkt und jeder Gitarrenanschlag klar erkennbar, statt den Hörer vor ein Rätsel zu setzen.
Auch im Hip-Hop hat man mittlerweile verstanden
Das änderte sich erst mit dem Aufkommen des Grungegaze-Genres – welches Shoegaze-Elemente mit den härteren und düstereren Riffs der Grunge-Ära mischt. Deren Musiker konzentrieren sich auf einen dröhnenden, nebulösen Wall-of-Sound-Gitarrenklang, der eigentlich zwar nicht sonderlich kreativ sein mag – das Genre lebt eigentlich vollständig von seiner nostalgischen Fixierung auf das Ineinandermischen von Stilen, die um die Jahrtausendwende herum populär waren – aber wenigstens hervorragend versteht, wie dieser Sound funktioniert.
Auch Hip-Hop-Musikern ist mittlerweile ein Licht aufgegangen. Nicht ganz freiwilligerweise gehörte frickeliger Lo-Fi-Sound bereits in den 1ß90ern zum Erkennungszeichen der Szene in Memphis, Tennessee, wo Rap-Combos wie Triple Six Mafia oder DJs wie Mack D.L.E. lieber Horrorfilmsoundtracks und verlangsamte Syntheziserloops sampelten statt auf die groovigen Funk-Samples ihrer Kollegen in New York und Los Angeles zu setzen. Die Tatsache, daß die Szene buchstäblich Underground war, anfangs keine Anbindung an große Plattenlabels vorweisen konnte und sich die Musik durch hin und hegehandelte Kassetten verbreitete, tat ihr übriges um den typischen dumpfen und übersteuerten Memphis-Style zu kreieren.
Und kaum ein Stil hat die letzten Jahre Rap-Musik, zumindest außerhalb der Charts, derart stark geprägt. Besonders in Osteuropa erlebt derzeit ein Stil seine frühe Blüte, der sogar gleich zwei Lo-Fi-Stile vermengt: Dungeon Rap klingt, als hätte man die Musik eines uralten Pixel-Computerspiels mit Fantasy-Setting genommen und, nun ja, Memphis-Rap-Beats darüber gelegt. Je kratziger, dumpfer, verrauschter und übersteuerter, desto besser. Gerade so, als wären die Lieder nicht frisch entstanden, sondern seien aus den Untiefen irgendwelcher obskurer Archive hervorgeholt worden.
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.