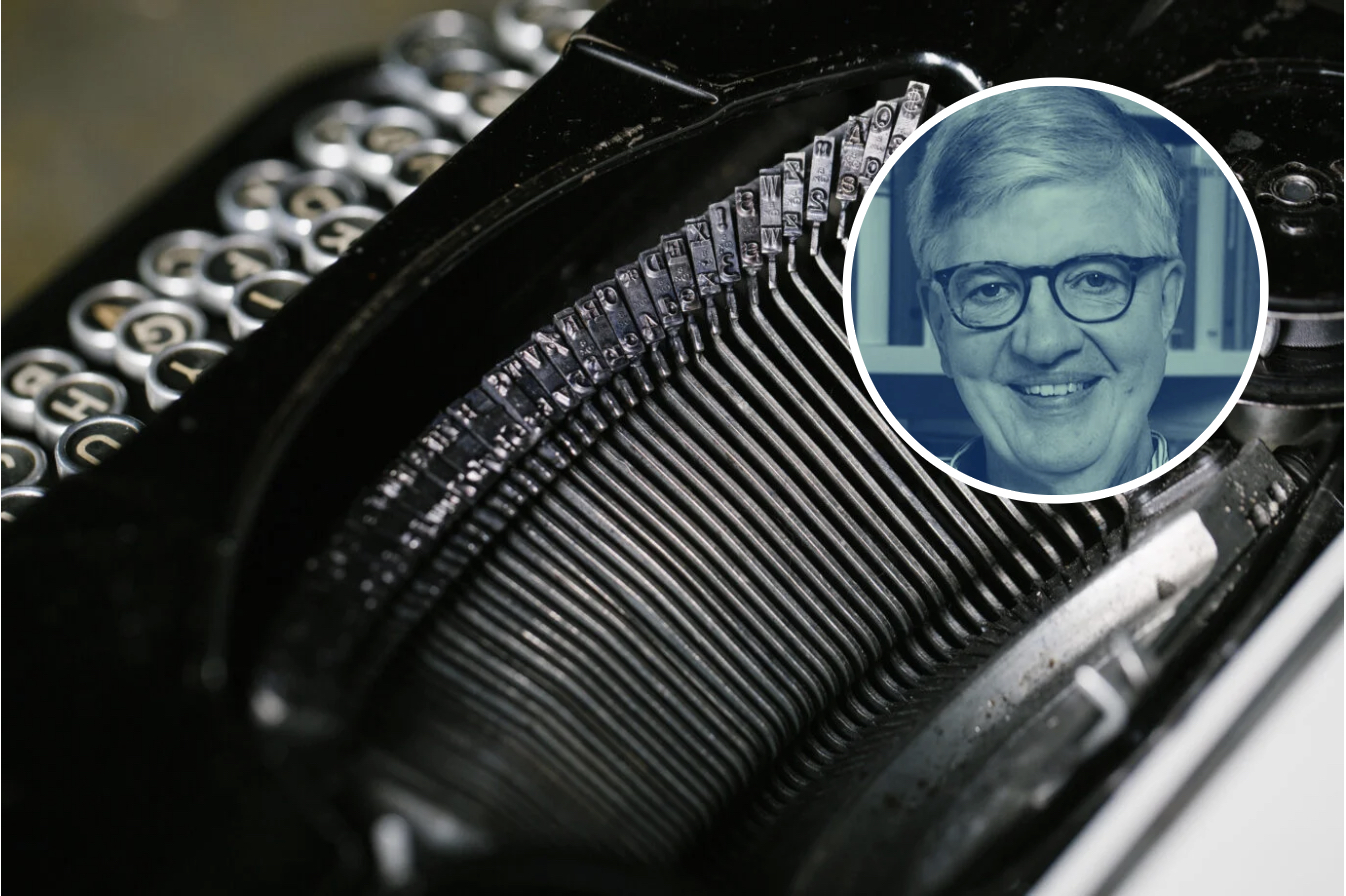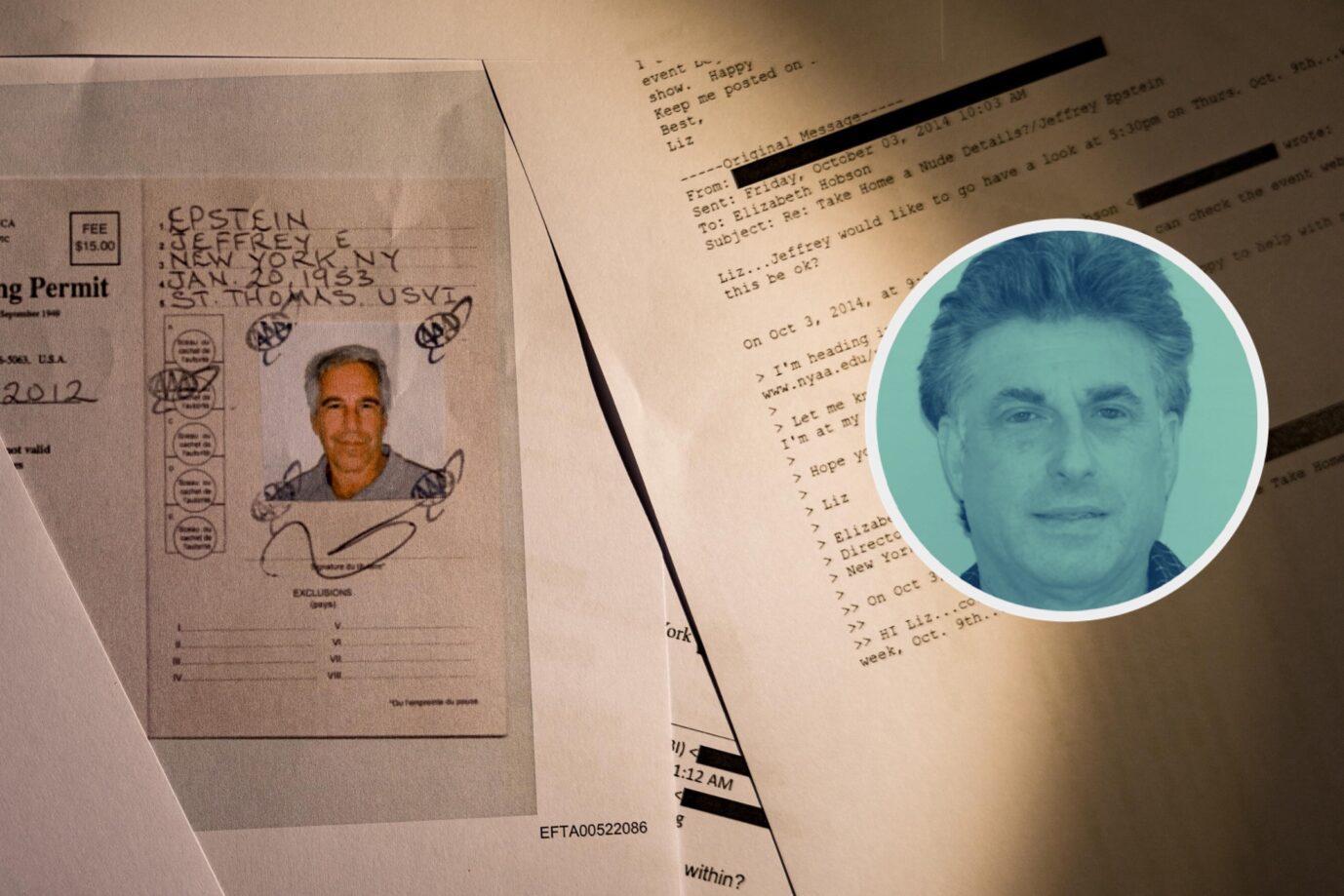Es sind schockierende Bilder, die aus den USA herüberdringen. Zuerst die Aufnahmen des gefesselt am Boden liegenden schwarzen Kleinkriminellen George Floyd in Minneapolis, dem ein weißer Polizist die Luft abdrückt. Dann die Bilder von den Ausschreitungen, vom buchstäblichen Flächenbrand der Gewalt, der das große Land ereilt und seine öffentliche Ordnung außer Kraft setzt.
In keiner Weise gehe es mehr um den Tod von Floyd, sagte Gouverneur Tim Walz, der den minderheitenaffinen Demokraten angehört. „Es geht darum, die Zivilgesellschaft zu attackieren, Furcht einzuflößen und unsere großartigen Städte zu sprengen.“ Ein vornehmlich schwarzer Mob agiert als revolutionärer Stoßtrupp und bestätigt genau das, was vielen Weißen als rassistisches Vorurteil vorgeworfen wird. Auch weiße Gewalttäter sind dabei, anscheinend linke Anarchisten, die versuchen, ihr Umsturz-Süppchen zu kochen. Der Polizist, der Floyds Tod mutmaßlich verursacht hat, ist allerdings mit einer Asiatin verheiratet, was dem schlichten Rassismus-Klischee widerspricht.
Die Berichterstattung stellt die rassistische Polizeigewalt gegen Schwarze in den Vordergrund und rechnet sie auf die USA unter Trump hoch. Der Historiker Lukas Mihr – Autor dieser Zeitung – kommt nach Sichtung von US-Statistiken zu einem anderen Befund. Tatsächlich werden Schwarze von der Polizei mit zweieinhalbmal größerer Wahrscheinlichkeit erschossen als Weiße, die wiederum dreimal häufiger als Asiaten getötet werden. Demnach würde die Polizei gegenüber Weißen eine größere Abneigung hegen als gegen ethnische Chinesen, Japaner oder Koreaner. Was jedoch der weißen Suprematie widerspricht, die angeblich die Wurzel allen Übels ist.
Realität einer ethnisch fragmentierten Gesellschaft
Was unterschlagen wird: Es gibt viermal mehr schwarze Polizistenmörder als weiße. Außerdem werden Schwarze von weißen und schwarzen Polizisten mit gleicher Wahrscheinlichkeit erschossen. Eine Praxis offenbar, die sich aus der Gefahrenabwägung ergibt, die wiederum auf Erfahrung beruht. Wenn Schwarze fünfmal häufiger inhaftiert werden als Weiße, läßt sich das nicht mehr mit der rassistischen Voreingenommenheit der Behörden erklären, sondern mit überdurchschnittlicher Delinquenz.
Der Bürgermeister von Minneapolis sprach zunächst von „aufgestauter Wut und Traurigkeit, die in unserer schwarzen Gemeinde nicht nur wegen der fünf Minuten des Grauens, sondern seit 400 Jahren tief verwurzelt ist“. Aus der Fokussierung auf historische Schuld – eine in Deutschland vertraute Übung – bezieht auch die aggressive Organisation „Black Lives Matter“ ihre Energie. Schwarze Geschäftsinhaber versuchten sich vor Plünderern zu schützen, indem sie die Aufschrift „black owned business“ anbrachten und eine rassische Trennlinie zu weißen und asiatischen Inhabern zogen.
Das ist die Realität einer ethnisch fragmentierten Gesellschaft, die auch Europa längst erreicht hat. Zuwanderer-Krawalle in den französischen Banlieues oder in den britischen Vorstädten werden regelmäßig auf soziale Ursachen zurückgeführt. Daß die einen bessere, andere schlechtere Startbedingungen haben, ist in einer ausdifferenzierten Gesellschaft jedoch normal. Ein kluger Staat wird, wo nötig und aussichtsreich, Hilfe zur Selbsthilfe anbieten. Denn es sind überwiegend die sozialen Aufsteiger, die einer Gesellschaft Schwung verleihen.
Sogar islamische Fundamentalisten schlüpfen unter den Schirm der Antidiskriminierung
 Begriffe wie „Benachteiligung“ oder „Diskriminierung“ suggerieren hingegen, daß eine latent rassistische Gesellschaft bestimmte ethnische oder religiöse Gruppen daran hindere, ihre Talente zu entfalten. Es fällt auf, daß Ostasiaten sich so gut wie nie auf diese Erklärung zurückziehen. Wenn sie auffällig werden, dann durch Fleiß und Wissen. Es braucht eben Voraussetzungen, die durch keine Sozialtechnik zu ersetzen sind.
Begriffe wie „Benachteiligung“ oder „Diskriminierung“ suggerieren hingegen, daß eine latent rassistische Gesellschaft bestimmte ethnische oder religiöse Gruppen daran hindere, ihre Talente zu entfalten. Es fällt auf, daß Ostasiaten sich so gut wie nie auf diese Erklärung zurückziehen. Wenn sie auffällig werden, dann durch Fleiß und Wissen. Es braucht eben Voraussetzungen, die durch keine Sozialtechnik zu ersetzen sind.
Als 1989 das Sozialismus-Projekt in Europa bankrott ging, glaubten viele an das Ende der politischen Ideologien. Das war ein Irrtum. Die Linke erkannte sehr rasch das kulturrevolutionäre Potential der „Differenz“ und „Diversität“. Einerseits wurden die Rechte von Minderheiten in den Mittelpunkt gerückt, andererseits die tradierten Strukturen und kollektiven Verbindlichkeiten: Nation, Staat, Kultur, Geschlecht usw., als Konstrukte oder hegemoniale „weiße“ Diskurse diffamiert und dekonstruiert.
Der Vorwurf des Rassismus, der Islamo- oder Homophobie verhindert gleichzeitig, daß der Widerspruch zwischen der strikten Identitätspolitik der Minderheiten und dem faktischen Identitätsverbot der Mehrheitsgesellschaft thematisiert wird. Sogar islamische Fundamentalisten und kriminelle Clans schlüpfen so unter den Schirm der Antidiskriminierung.
Es ist ungemütlich im freien Westen
Es gibt Bestrebungen, den Tod des George Floyd dafür zu nutzen, das Dogma einer weißen Rassismus-Schuld nach Deutschland zu importieren und hier zu verankern. Das würde die Atmosphäre weiter vergiften und zu vergleichbarer „antirassistischer“ Gewalt anspornen. Die afrikanischstämmige Grünen-Politikerin Aminata Touré, Vizepräsidentin im Landtag von Schleswig-Holstein und Expertin für „Migration, Antirassismus, Frauen, Queer & Jugend“, bekundete auf Twitter, sich einer Gemeinde aus „Schwestern und Brüdern weltweit“ zugehörig zu fühlen, deren identitätsstiftendes Merkmal ihr „Schwarzsein“ ist. Ähnliche Verlautbarungen gibt es aus den Reihen der „Neuen Deutschen Medienmacher“-NGO, deren Leistung sich darin erschöpft, ihre angebliche Benachteiligung zu beklagen.
Für die großen Medien stellte 2018 nicht die Ermordung eines Deutschen in Chemnitz durch einen Ausländer den Skandal dar, sondern die öffentliche Empörung darüber; sie verbreiteten die „Hetzjagd“-Lüge. Das Toben des brandschatzenden Mobs in den USA indes nennen sie „Protest“. Es ist ungemütlich im freien Westen.