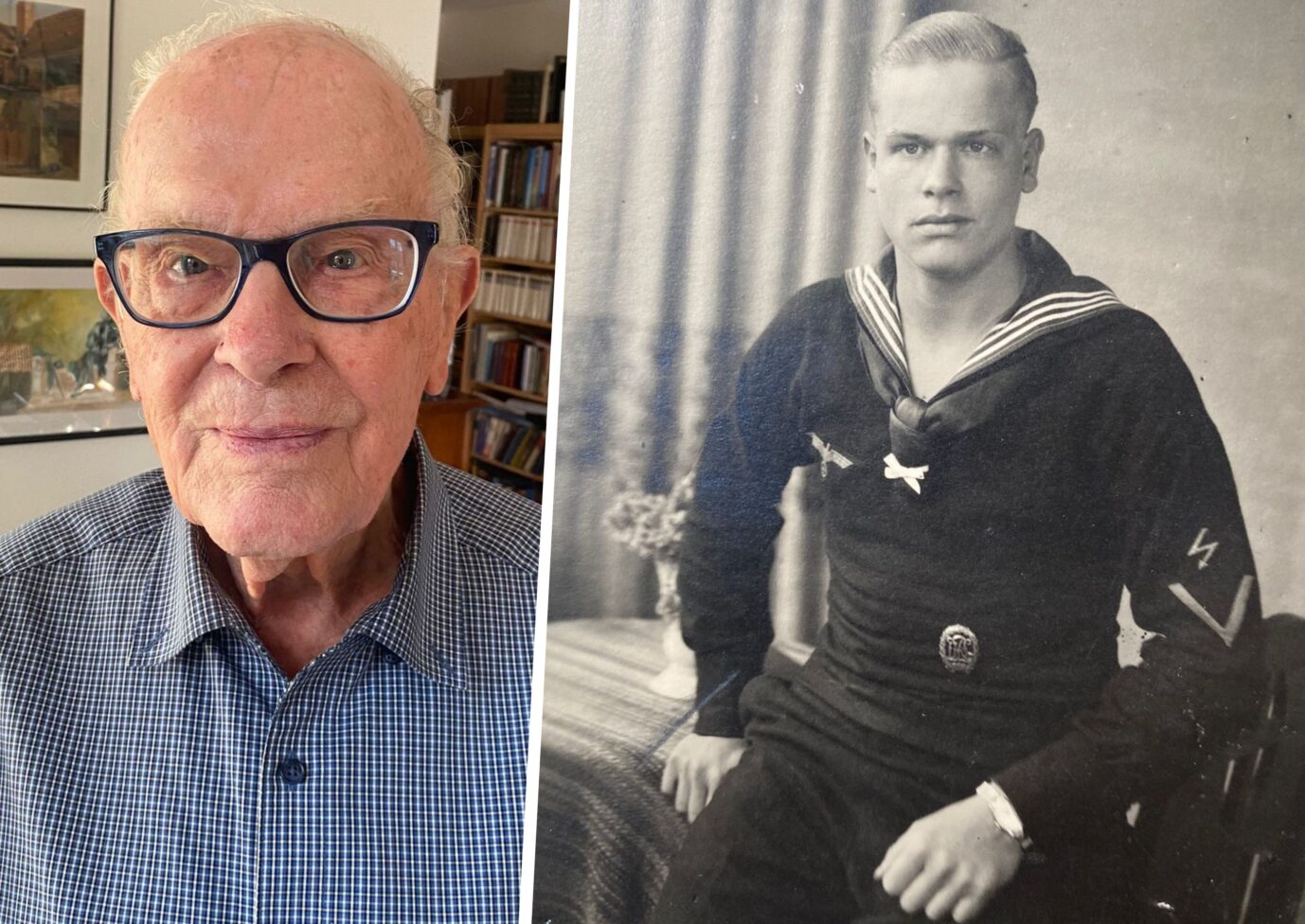Henrik Schulze sieht aus wie ein englischer Landedelmann. Das karierte Jackett, der gestutzte Bart. Er steht vor dem Jüterboger Rathaus und begrüßt mit einem Handkuß. Schulze ist kein Lord, sondern der ehrenamtliche Stadtchronist. Und das seit 40 Jahren. Jeden, oder fast jeden Stein des Rathauses, könnte er kommentieren. Doch geboren wurde Schulze ganz woanders: 23 Kilometer Luftlinie entfernt weiter im Osten. In Halbe. Die Geschichte um diesen Ort hat ihn geprägt. 80 Jahre nach den Abwehrkämpfen von der Oder bis zur Elbe veröffentlicht er – klar – eine Chronik der letzten 23 Tage des Zweiten Weltkriegs.
„Ich habe sozusagen die Gnade der späten Geburt“, sagt er lächelnd. „Den Krieg kannte ich nur noch vom Hörensagen, bin 1950 geboren, aber das Schlachtfeld in Halbe war mein Kinderspielplatz“, sagt Schulze. Die Kiefernwälder rund um die kleine Stadt sind noch voller Kriegsschrott und verlorenem Hausrat der Flüchtlinge. Aus dem Fenster des Elternhauses sieht der kleine Henrik heraus, als er Schreie hört. Ein Nachbar, bricht mitten auf der Straße zusammen und brüllt: Achtung! MG-Feuer von links! Da! Von vorn – russische Panzer.“
So beschreibt er später einen Nachbarn, der als Jugendlicher traumatisiert vom Krieg, immer wieder die Geschehnisse durchleben muß – wenn er betrunken durch den Ort torkelt. „Mit 13 Jahren, ich vergesse das niemals, saß ich auf einem Baumstamm und entdeckte einen Schädel.“ Erlebnisse, die Schulze prägen. Sein Vater ist erst in Halbe Bahnhofsvorsteher, Mitte der 1970er zieht die Familie nach Jüterbog.
„Hier wurde ich vergewaltigt“
Der Buchhändler beginnt zu forschen, wird zu DDR-Zeiten, 1985, Stadtchronist. Er spricht mit Zeitzeugen und Einwohnern, die den Wahnsinn überlebten, auch mit Frauen. „Es gibt keinen Ort im Kampfgebiet, wo nicht vergewaltigt wurde“, sagt Schulze. Bei einer Rathausbegehung erzählt ihm unvermittelt eine Frau, als sie im Flur stehen: „Hier wurde ich vergewaltigt“ und zeigt auf einen Raum im Erdgeschoß.
Schulze sammelt diese Zeitzeugenberichte, schreibt Archive an, vergleicht Sekundärliteratur. Das Ergebnis sind zwei Bücher, der erste Teil mit dem Titel „Unbekannt April 1945“ liegt vor. Ziel ist eine tägliche Darstellung der militärischen Lage ab dem 16. April 1945 bis zur Einnahme Berlins. Der erste Band stellt die Lage zum Beginn der sowjetischen Offensive bis zur Entstehung des „Halber Kessels“ dar.
„Bei der Sichtung der Literatur fiel mir auf, daß Veröffentlichungen aus dem Westen enorm detailreich waren, der Iwan allerdings kein Gesicht hatte“, sagt Schulze. „Im Osten hatten es die sogenannten Faschisten nicht.“ Auch die Auswertung der Truppenstärken wird nach Musterung der Quellen schwierig. „Vorsicht ist angeraten bei den russischen Zahlen. Hätten wir auf deutscher Seite so viele Panzer gehabt, wie die behaupten, dann hätten wir nicht den Krieg verloren.“
Sowjets machen kaum Gefangene
Die Zivilbevölkerung leidet enorm. Wer nicht geflüchtet ist, gräbt sich bloße Erdlöcher. Ganze Familien begehen in Cottbus Selbstmord. Latrinengerüchte am 23. April an der Front: „Angeblich hätte der Deutschlandfunk die Nachricht verbreitet, daß mit den Westmächten ein Waffenstillstand vereinbart worden sei, der schon am nächsten Tag in Kraft treten würde.“ In Teurow, seit dem 21. April besetzt, stirbt unter ungeklärten Umständen ein Rotarmist. Alle Männer aus dem Dorf werden nach Freidorf geführt, einige kommen nicht zurück. Gisela Arndt flieht aus Lübben, ist schon mehrere Tage unterwegs, als sie mit Funkern der Wehrmacht in einem Keller vor den Angriffen Schutz sucht. Deren Durchsage: „Schickt Ersatz, die machen uns hier zur Sau!“
Feldwebel Fritz Koal, vom Jagdgeschwader 27 am Stadtrand von Berlin: Überall brennende Dörfer, auf den Straßen Flüchtlingstrecks und Truppenverbände der Roten Armee, Pferdewagen von Panzern überrollt. Er greift die Sowjets nicht an, „um unsere flüchtenden Frauen und Kindern und Alte nicht der Rache des Feindes auszusetzen.“ (Seite 481). Geholfen hat es nichts. Zum 22. April ist beispielweise vermerkt: Bei Neupetershain sterben schätzungsweise 7.000 deutsche Frauen, Kinder und Soldaten. Tausende sind verwundet oder verletzt.
Die Sowjets nehmen 1.300 Deutsche gefangen. „Diese geringe Zahl läßt verschiedene Schlüsse zu, einerseits, daß die deutschen Verbände buchstäblich bis zum letzten Mann kämpften, und zum anderen, daß vom Sieger zum Ende nur selten Pardon gewährt wurde.“
Soldatenfriedhof Halbe ist ein Politikum
Dieser Haß setzt sich auch nach dem Tod fort. „Es gab ein Verbot, russische und deutsche Gefallene gemeinsam zu bestatten“, sagt Schulze. „Ich habe den Förderkreis Gedenkstätte Halbe mitgegründet.“ Den Grundstock des Friedhofes Halbe bilden über 4.400 von den Sowjets im Lager Ketschendorf getötete und ermordete deutsche Frauen, Männer und Soldaten, die ab 1952 in Halbe beigesetzt wurden. Rund 18.000 Menschen waren ab März 1945 im Speziallager 5 des NKWD eingepfercht. Wer überlebte, kam im April 1947 unter anderem in die Konzentrationslager Sachsenhausen und Buchenwald oder nach Sibirien.
Am 30. April 2025 wurden auf dem Waldfriedhof Halbe 100 deutsche Soldaten zur letzten Ruhe gebettet – 80 Jahre nach der Schlacht von Halbe. Vertreter von Politik, Bundeswehr und Gesellschaft erinnerten an die Soldaten und Schüler legten Blumen auf die Särge. pic.twitter.com/lcnf4YnJZb
— JUNGE FREIHEIT (@jungefreiheit) May 2, 2025
Der Friedhof war immer ein Politikum. „Bis 1989 war er das Feigenblatt der DDR“, sagt Schulze. Nach der Wende pilgerten Rechtsextremisten wie Christian Worch nach Halbe. Die Antwort der SPD-Landesregierung? „Die SPD machte ein Volksfest daraus, mit Straßenblockaden.“ Und auch heute ist Halbe den Linken ein Dorn im Auge.
Seit Jahren werden Grablichter auf den Soldatenfriedhof aufgestellt. Auch 2024 spazieren die Bewohner von Halbe nach dem Weihnachtsgottesdienst auf den Friedhof, um die „einzigartige Kunstaktion mit dem romantischen Bild des mit tausenden Kerzen illuminierten Gräberfeld in sich aufzunehmen“, berichtet Schulze im zweiten Band seines Buches. Doch am 27. Dezember werden sie Zeuge, wie auf dem Friedhof, unter Aufsicht der Polizei, die teils noch brennenden Grabkerzen eingesammelt und in Müllcontainer geworfen werden.
Ein Skandal, über den bundesweit berichtet wird (JF berichtete). Am Neujahrstag 2025 wollen 300 Besucher auf den Friedhof. Das versucht die Polizei zu verhindern, berichtet die Preußische Allgemeine tags darauf unter dem Titel: „Eine Schande“. Schulze versucht eine Stellungnahme der Polizei einzuholen. Bis zur Drucklegung vergebens, schreibt er.