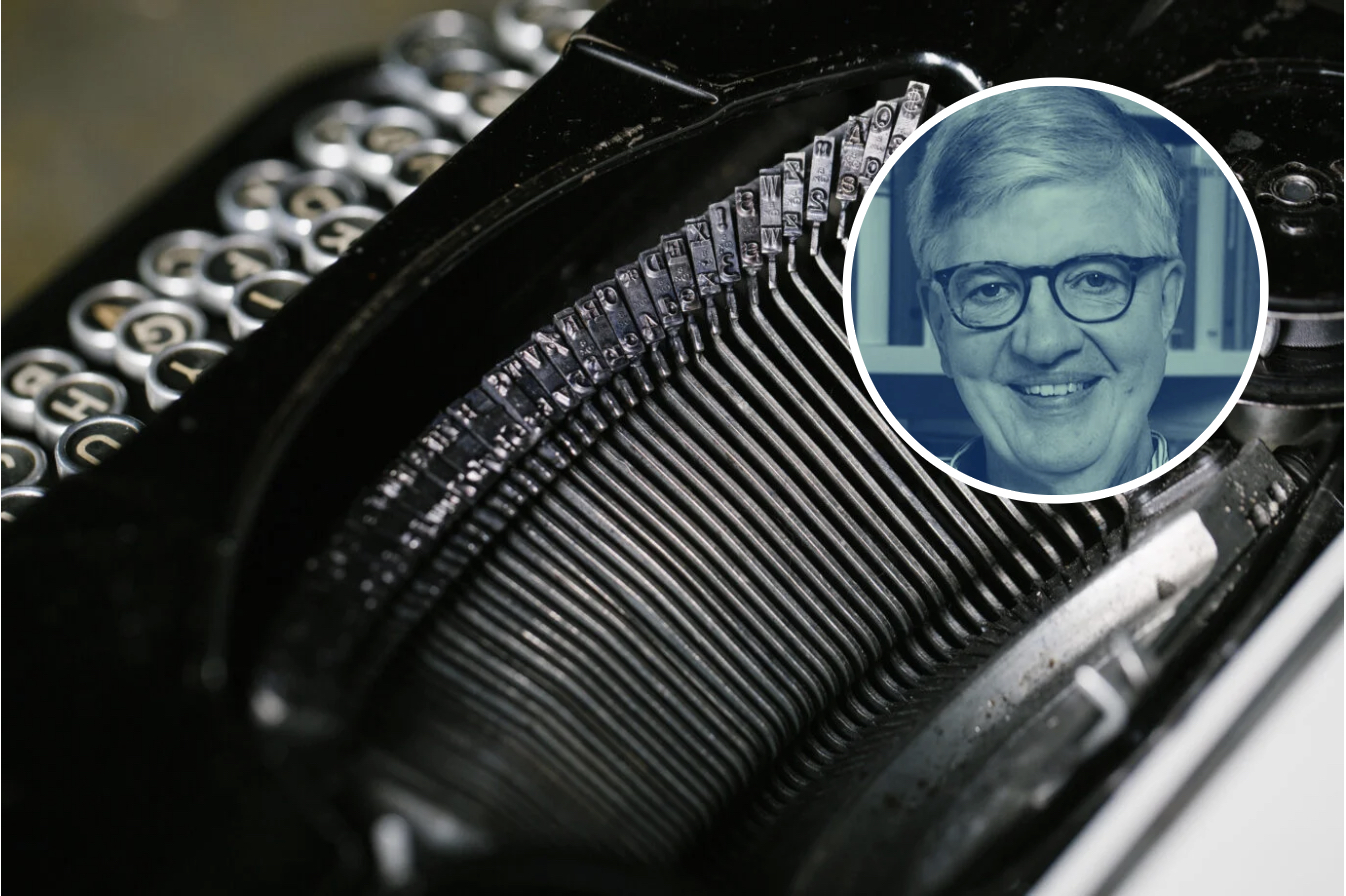Zu den Stereotypen der „multikulturellen“ Argumentation gehört, daß „Rassismus“ und „Fremdenfeindlichkeit“ vor allem dort stattfänden, wo wenige Fremde anwesend wären. Die logische Konsequenz daraus ist klar: Packt man ordentlich Fremde in einen Ort, verschwindet der „Rassismus“ offenbar sukzessive. Wieder hat man also ein weiteres gutes Argument dafür gefunden, die „Vielfalt-Gesellschaft“ auch in versteckteste Winkel Vorpommerns tragen zu müssen. Aber abgesehen von der durchsichtigen Absicht könnte man die Argumentation dennoch hinterfragen. Sie lässt nämlich meist unbeantwortet, weshalb der „Rassismus“ eigentlich verschwinden sollte, wenn man die Leute nur mit möglichst vielen Menschen anderer Rassen oder Kulturen konfrontiert.
Die „christliche“ Antwort-Variante würde vermutlich lauten: Die Einheimischen bemerken, daß da eigentlich ganz nette Menschen zu ihnen gekommen sind und erkennen deshalb, dass ihre vorher geäußerten Ressentiments gegen das Fremde falsch waren. Die „antifaschistischere“ Antwort-Variante dürfte hingegen lauten: Indem mehr Fremde hinzuziehen, wächst das Risiko für „Rassisten“ einmal „aufs Maul“ zu bekommen, wenn sie weiterhin ihre Klappe aufreißen. Hier wäre also kein geistiger Lernprozess Ursache der Veränderung, sondern ein durch latente Drohung entstandener Verstummungsvorgang.
Die „antideutsche“ Variante der Erklärung dürfte noch einen Schritt weitergehen: Wo keine Deutschen mehr leben, da finden endlich auch kein „Rassismus“ und keine „Fremdenfeindlichkeit“ mehr statt. Das stimmt zwar nicht, wie ein Blick auf die Welt zeigt, aber darum geht es ja auch gar nicht. Es geht der neuen Weltordnung schließlich um das, was im Wilden Westen des 19. Jahrhunderts bereits eingeprobt wurde. Sind erst einmal die (indianischen) Eingeborenen beseitigt, steht nichts mehr der allein auf Produktion und Konsum basierenden Gesellschaft aus entwurzelten Einwanderern entgegen.
Antifaschismus benötigt keinen Faschismus
So weit, so bekannt. Eine andere Betrachtung ist aber nun wirklich viel interessanter: So wie „Antifaschismus“ keinen Faschismus für seine Existenz benötigt, so wenig bedarf der „Antirassismus“ einer realen rassistischen Bedrohung. Die dahinter stehenden Denkstrukturen sind autonom, das heißt, sie bedürfen keiner konkreten Anlässe, sondern dienen unabhängig von allen Gegebenheiten allein dazu, die Hirne weich zu halten. Schließlich gilt es zu verhindern, dass sich zu viel Skepsis an der neuen, globalistischen Weltordnung herausbilden könnte. Man hat das in der Vergangenheit bereits gesehen.
Seit dem „Aufstand der Anständigen“ ist bekannt, dass es keiner realen „rechtsextremen“ Straftaten bedarf, um die „antifaschistische“ bzw. „antirassistische“ Massen- und Medien-Inszenierung auszulösen. Es reichten dazu beispielsweise ein anonymer Rohrbombenanschlag (2000 in Düsseldorf), die hysterischen Behauptungen einer Mutter (2000 in Sebnitz), eine Wirtszeltschlägerei (2007 in Mügeln)
oder eine ominöse Lebkuchenmesser-Attacke auf einen Polizeidirektor (2008 im Landkreis Passau). Finden einmal reale „rechtsextreme“ Gewalttaten statt, so fungieren sie allenfalls als Zusatzerhitzer, da sich nun selbst ansonsten reserviert haltende Skeptiker verpflichtet fühlen, in den Chor des „Kampfes gegen rechts“ mit einstimmen zu müssen. Nötig sind diese Taten aber nicht.
Opferausstellung ohne Opfer
So finden „antirassistisch“ motivierte Aktivitäten und Veranstaltungen faktisch unabhängig davon statt, ob es reale Probleme mit Rassismus gibt. Zwei Beispiele mit ganz unterschiedlichen Ausgangslagen seien genannt: Im hessischen Offenbach haben die Schüler selbst der guten Gymnasien mittlerweise mehrheitlich einen so genannten „Migrationshintergrund“ (oder sind kurz davor, die Mehrheit zu werden). In einigen Grundschulen dürfte die Quote originärer Deutscher längst unter 10 Prozent liegen. Eine örtliche „rechtsextreme“ Szene existiert faktisch nicht, sie bestand lange Zeit aus einem einzigen NPD-Kauz. Relevanter „Rassismus“ findet – abgesehen von gelegentlichem Gemecker einiger Rentner nicht statt, da es keine „Rassisten“ gibt. Doch das hindert keinesfalls an „antirassistischen“ Aufklärungsmaßnahmen.
So war nun beispielsweise im Rahmen der „Wochen gegen Rassismus“ im Rathaus die Ausstellung „Opfer rechter Gewalt“ zu sehen, und der taz-Journalist Kai Budler konnte in der städtischen Bücherei zu dem Thema „Das Hauptproblem heißt Rassismus“ vortragen. Zwar ist wohl fast jedem Einheimischen augenfällig, daß dies zumindest vor Ort sicher nicht das Hauptproblem darstellt, doch das beirrt die dafür Verantwortlichen keinesfalls. So lautete die offizielle Erklärung, dass trotz des friedlichen Zusammenlebens der Kulturen in der Stadt es dennoch wichtig sei, „immer wieder ein deutliches Zeichen gegen Rassismus und Fremdenfeindlichkeit zu setzen“. Man wird dies also vielleicht so lange tun, bis der letzte Deutsche ausgestorben oder ausgewandert ist.
Die erwähnte Ausstellung wurde übrigens konzipiert von dem Verein „Opferperspektive e.V.“ in Kooperation mit der Friedrich-Ebert-Stiftung und gefördert unter anderem von der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Das erklärt, dass sie wie ein UFO aus unbekannten Welten auftaucht, landet, um dann wieder weiter durch das Land zu schwirren.
Dessau ist manchen zu weiß
Die unfreiwillige Komik des verengten Blickwinkels auf „rechte Gewalt“ und „Rassismus“ mag manchem auffallen, wenngleich darüber geschwiegen wird. Denn eine solche einseitige Straftatenschau ausgerechnet in einer Stadt, in deren Polizeibericht täglich von Gewalttaten mit dem Täterprofil „Südländer“ zu lesen ist, hat natürlich eine mindestens bizarre Note.
Gegenbild Dessau, Sachsen-Anhalt: Hier besteht die exakt entgegengesetzte Situation. Dennoch wird auch hier die faktisch gleiche „antirassistische“ Argumentation gebraucht. Dessau ist noch eine fast rein deutsche Stadt, also fast ohne „Migrationshintergrund“. Das allerdings stört offenbar den aus Köln zugezogenen Schulleiter des Liborius-Gymnasiums Benedikt Kraft, der gegenüber der Presse äußerte: „Dessau ist eine unglaublich weiße Stadt.“
In seiner Argumentation vereinen sich alle Irrationalismen des „Antirassismus“. Anlass seiner jetzigen Aktivität war eine geplante Demonstration zum Gedenken an die Zerstörung Dessaus durch alliierte Bomber im zweiten Weltkrieg. Kraft störte sich vor allem daran, dass die „Rechten“ alljährlich „ausschließlich an die deutschen Opfer erinnern“. Deutsches Opfergedenken darf also nur im relativierenden Verweis auf die „deutsche Schuld“ stattfinden. So weit die historische Lektion. Der Schulleiter zog dann aber eine Linie vom deutscher Opfergedenken zu den Opfern fremdenfeindlicher Attacken in Mölln (23. November 1992) und im nordrhein-westfälischen Solingen (29. Mai 1993), die zum Mitauslöser der so genannten „Lichterketten-Bewegung“ wurden.
Ins Nichts reproduziert
Dieser im Vergleich zum Bombenkrieg zahlenmäßig wenigen Opfer darf jedenfalls wohl ohne Relativierungen und Kontext-Einordnungen gedacht werden. „Gott hat uns Menschen geschaffen – egal, welcher Herkunft und welcher Hautfarbe“, so Kraft. Doch der Schulleiter wollte nicht nur gedenken, sondern er beschwor den „antifaschistischen“ Konsens jener Tage vor 20 Jahren, das „Arsch hu – Zeng auseinander“-Konzert, mit dem er offenbar positive Jugenderinnerungen verbindet. Diese Zeit möchte Kraft wiederbeleben und betätigt sich deshalb als eine zentrale Instanz im örtlichen „Kampf gegen rechts“, die man immer wieder in kommunalen Strukturen finden kann (oft sind es Pfarrer, Lehrer oder Kommunalpolitiker mit Selbstdarstellungsambitionen).
Laut will Kraft werden und forderte somit: „Die demokratische Mitte dieser Stadt muss aus ihrer Lethargie herauskommen und den Nazis lauthals entgegen treten“. Aus diesem Grund hatte er am 9.3. eine Menschenkette initiiert. Schülervertretung, Schulelternrat, Lehrerrat und Schulleitung hatten sich an Schüler und deren Eltern gewandt, die Kirche läutende Unterstützung zugesichert. Diese Aktion reihte sich in eine ganze Reihe ähnlicher Aktionen für „Toleranz und Gerechtigkeit“, gegen „Geschichtsklitterung“. Und ständig werden dabei die NS-Zeit und die heutige Situation kunterbunt vermengt. Dessaus aktuelle Probleme sind zwar ganz anderer Natur, wie in diesem Video erahnbar, aber auch hier liegt der „antirassistische“ Fokus nicht auf den realen Sachlagen, sondern auf der Wiederholung der immer gleichen Floskeln.
Fazit: Es ist also egal, ob es faktisch gar keinen real begründeten Anlass gibt („Aufstand der Anständigen“), es faktisch keine Rassisten gibt (Situation Offenbach) oder keine möglichen Opfer von Rassismus vor Ort leben (Situation Dessau). Das „antirassistische“ Argumentationsmuster kann losgelöst von jeder realen Lage immer wieder aus dem Nichts produziert werden.