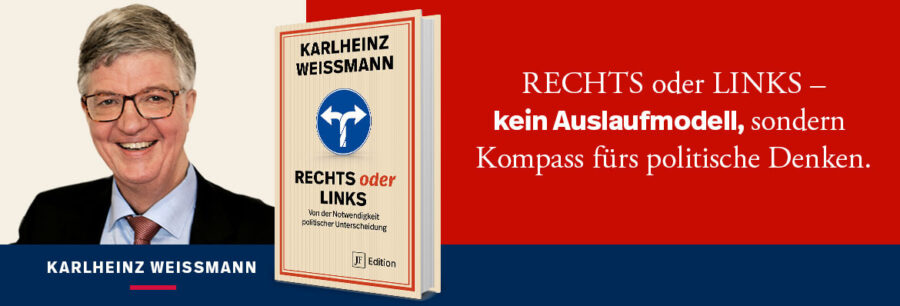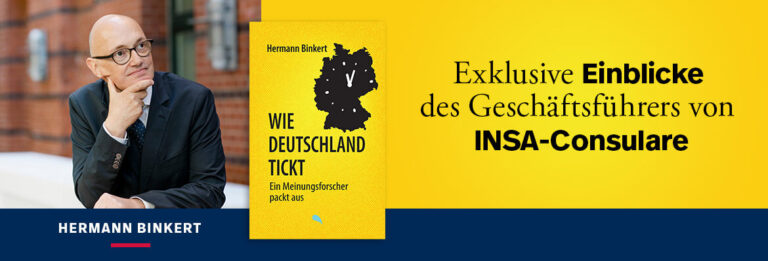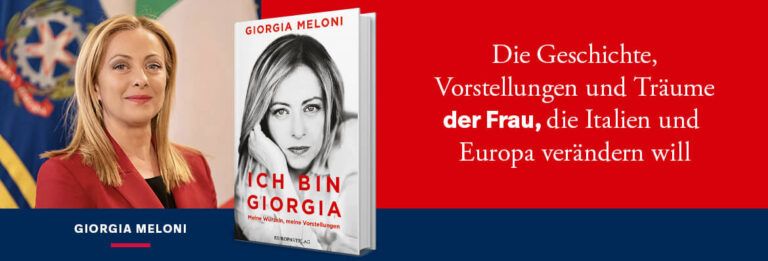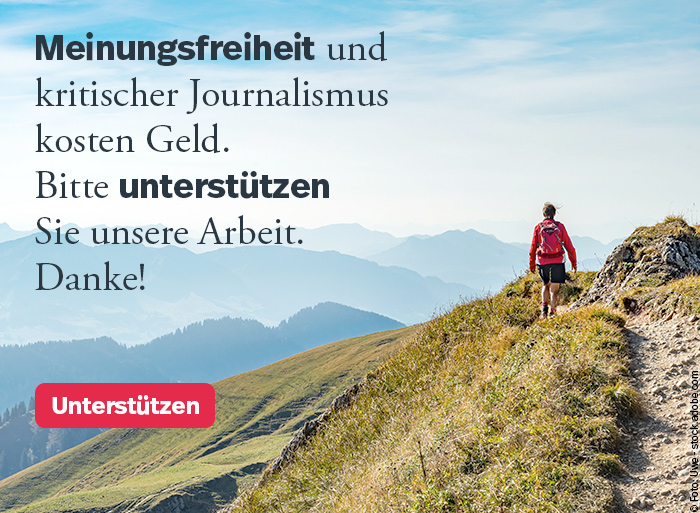Herr Pfarrer, soeben hat Ihre Landeskirche anläßlich ihrer Synode den Beschluß, AfD-Mitglieder von Leitungsämtern* auszuschließen, nochmal bekräftigt.
Martin Michaelis: Und damit eine Chance vertan, denn dieser Vorgang ist ein politischer und ein religiöser Skandal.
Warum ein „religiöser“?
Michaelis: Weil der Zugehörigkeit oder auch nur der Nähe zur AfD geradezu Bekenntnisrang zugemessen wird. Man mißbraucht also den Glauben für politische Zwecke. Übrigens genau davor bewahren sollte uns die „Zwei Reiche“-Lehre Martin Luthers – in dessen Nachfolge sich ja die Evangelische Kirche und also auch die EKM, die Evangelische Kirche in Mitteldeutschland, sieht.
Nun haben Sie Strafanzeige gegen die EKM gestellt. Warum?
Michaelis: Weil ich Opfer eines eklatanten Willküraktes bin.
Ihrer eigenen Landeskirche?
Michaelis: Ja.
Inwiefern?
Michaelis: Der Kreiskirchenrat hat mir den pfarramtlichen Auftrag entzogen. Hintergrund ist, daß ich bei den Kommunalwahlen in Sachsen-Anhalt im Mai als Parteiloser auf der Liste der AfD in Quedlinburg kandidiert habe.
Michaelis: „Kirche geht über demokratisches Votum hinweg“
Mit Erfolg, Ihnen ist nicht nur der Einzug in den Stadtrat gelungen, sondern Sie haben auch 33 seiner 36 Mitglieder in punkto Stimmenzahl überholt.
Michaelis: Ja, doch leider scheint meine Kirche auch über dieses demokratische Votum bewußt hinweggehen zu wollen.
Warum?
Michaelis: Gute Frage, zumal ich mir nichts habe zuschulden kommen lassen. Denn laut dem Pfarrdienstgesetz der EKM ist die Kandidatur für ein solches Mandat weder ausgeschlossen noch an Bedingungen geknüpft oder etwa zu beantragen und zu bewilligen. Vielmehr ist es sehr einfach: Alles was man zu tun hat, ist seine Absicht dem Landeskirchenamt mitzuteilen. Dieses hat das dann zur Kenntnis zu nehmen und das Schreiben mit zwei Löchern zu versehen, um es in die Personalakte zu heften.
Klingt einfach.
Michaelis: Eben. Danach hat man noch über den Ausgang der Wahl und die Annahme des Mandats zu informieren. Das ist dann aber alles. Doch obwohl ich all das sorgfältig erledigt habe, wurde mir bereits nach der Mitteilung, daß ich zur Wahl anzutreten beabsichtige, ohne jede Anhörung der Beschluß des Entzugs meines pfarramtlichen Auftrages mitgeteilt.
„Gegen Landesverfassung, Pfarrdienst- und sogar das Grundgesetz“
Also, daß Sie Ihre Aufgabe als Pfarrer Ihrer Gemeinde Gatersleben bei Quedlinburg nicht mehr wahrnehmen dürfen – kurz gesagt, man hat Sie abgesetzt?
Michaelis: Richtig. Doch meine Behandlung läuft dem Pfarrdienstgesetz entgegen und übrigens auch der Verfassung des Landes Sachsen-Anhalt sowie dem Grundgesetz.
Dem Grundgesetz?
Michaelis: Ja, denn dessen Artikel 3 besagt: „Niemand darf wegen seines Geschlechtes, seiner Abstammung, Rasse, Sprache, Heimat und Herkunft, seines Glaubens, seiner politischen oder religiösen Anschauungen benachteiligt oder bevorzugt werden.“ Die Maßnahmen gegen mich sind also Unrecht! Und als Pfarrer im öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnis darf ich mich an Unrecht nicht beteiligen, auch nicht durch Gehorsam.
Also blieb mir im Frühjahr eigentlich gar nichts anderes übrig, als die Kandidatur für die Kommunalwahl anzunehmen. Dazu muß man wissen, daß es gar nicht meine Idee war, auf der AfD-Liste anzutreten, sondern zwei ebenfalls parteilose Bekannte, die für die Partei aktiv sind, hatten mich darum gebeten.
Doch daraufhin bekam ich vom Personaldezernenten meiner Kirche, Michael Lehmann, die Aufforderung, meine Kandidatur binnen vier Tagen zu widerrufen. In Erinnerung an den verweigerten Widerruf Martin Luthers 1521 in Worms habe ich mir aber gesagt: „Keine Widerrufe – das mache ich nur auf einem Reichstag.“
Bitte?
Michaelis: Das war Ironie, eine Anspielung.
„Die Kirche will staatsbürgerliche Rechte streitig machen“
Martin Luther ging es in Worms allerdings um die Frage, ob seine Schriften der Heilige Schrift entsprechen.
Michaelis: Nicht nur. Er sagte Kaiser Karl V. ins Gesicht, wenn er widerriefe, so würde er der päpstlichen Tyrannei, unter der Deutschland leide, nicht nur die Fenster, sondern auch die Türen öffnen. Ein Widerruf hätte ergo zur Folge, daß sich die Tyrannen sicherer fühlten und noch gewalttätiger handelten als je zuvor.
Es ging also auch um Politik?
Michaelis: Genau, und um sehr viel Geld und ganz klar auch um die Machtbegrenzung kirchlicher Amtsträger. Das, was damals erkämpft wurde, ist ein großes Verdienst Martin Luthers! Ich halte es für meine Pflicht, das zu verteidigen, und empfinde den Verstoß dagegen als Tyrannei. Wie inzwischen vielen anderen Gläubigen auch, will mir meine Kirche die bürgerlichen Rechte streitig machen. Es geht also nicht nur darum, daß man, wie das Grundgesetz sagt, wegen seiner Religion nicht benachteiligt werden darf. Das habe ich übrigens in jungen Jahren in der DDR massiv ertragen müssen, dem ich mich aber schon damals nicht gebeugt habe. Warum also sollte ich das jetzt tun?
Wie haben Sie sich gewehrt?
Michaelis: Nach dem erfreulichen Wahlergebnis und meiner Wahl zum stellvertretenden Stadtratsvorsitzenden – wohlgemerkt mit einer Zweidrittelmehrheit –, gab es seitens der Kirchenleitung kein Einlenken, sondern eine Verschärfung, sowohl im laufenden Disziplinarverfahren gegen mich, wie auch kirchenpolitisch. Es geht also offenbar keineswegs nur um meine unbedeutende Person. Deshalb finde ich, daß eine außerkirchliche Betrachtung zur Klärung hilfreich sein könnte.
Und daher hat mein Anwalt einen Strafantrag wegen Nötigung gestellt sowie wegen politischer Verfolgung und wegen Wählernötigung. Die Antwort kam schnell: Es gäbe kein öffentliches Interesse, denn es sei „kein gegenwärtiges Anliegen der Allgemeinheit“, weshalb keine Ermittlungen aufgenommen werden würden – womit aber nichts über die Erfolgsaussichten gesagt sei. Mir stünde der privatrechtliche Weg offen.
Und?
Michaelis: Na, dem haben wir widersprochen, denn das öffentliche Interesse war in den Medien unübersehbar, es wurde ja zum Teil deutschlandweit berichtet. Außerdem, sollten Wahlen wirklich nicht mehr von öffentlichem Interesse sein, dann stünde es um die Demokratie nicht gerade gut.
Diesmal dauerte es mit der Antwort schon etwas länger: Es sei zwar nun ein Ermittlungsverfahren eröffnet, aber wieder eingestellt worden. Jetzt mit der Begründung, die Taten seien den Beschuldigten nicht zuzurechnen und ihr Verhalten weder verwerflich noch sozialwidrig. Es bestünde kein Abhängigkeitsverhältnis und überdies könnten „christliche Grundwerte nachweislich nicht mit den Positionen der AfD in Einklang gebracht werden“. Keines der Argumente war zutreffend.
Gegen die Einstellung könnte ich bei der Generalstaatsanwaltschaft Beschwerde erheben. Das haben wir getan. Nun hat die Staatsanwaltschaft die Gelegenheit zum Recht auf freie Wahlen Stellung zu beziehen.
„Persönliches Gespräch mit dem Landesbischof: angeregt-autoritär“
Müßten Sie als Pfarrer nicht auf solche Mittel verzichten und um eine friedliche Lösung ringen, ja im Zweifel „die andere Wange hinhalten“?
Michaelis: Das wird von im kirchlichen Raum Tätigen oft unausgesprochen erwartet. In zweieinhalb Jahrzehnten als Pfarrvertretungsvorsitzender, zum Teil deutschlandweit, habe ich aber hinreichend Erfahrungen gesammelt, daß es nicht hilfreich ist, dieser Erwartung zu entsprechen.
Bezüglich der von Ihnen angesprochenen berühmten Bibelstelle bei Matthäus mit der anderen Wange habe ich einmal eine sehr interessante jüdische Auslegung des Autors Pinchas Lapide gelesen.
Danach solle man genau hinsehen: Es heißt, „wenn dich jemand auf deine rechte Backe schlägt …“ das geht, einen Rechtshänder vorausgesetzt, nur mit dem Handrücken – und das sei in diesem Kulturkreis eine Beleidigung. Dagegen mit der Innenfläche der Hand zu schlagen, bedeutet eine, wenn auch handfeste, Auseinandersetzung. Und genau diese inhaltliche Auseinandersetzung fordere ich ein!
Ich habe das auch schon in der Corona-Debatte mit mehreren Texten getan, auf die mir anfangs gesagt wurde, die Kirchenleitung habe sich entschlossen, das totzuschweigen. Also lutherisch disputationsfreudig sind sie nicht gerade.
Nun, mein Vorgehen ist friedlich, denn der Rechtsweg steht jedem als legitimes Mittel offen, damit es friedlich bleibt. Im Übrigen hat die Kirchenleitung zuerst und bereits zweimal zum Mittel des Disziplinarverfahrens gegriffen.
Ihr Landesbischof Friedrich Kramer, der auch schon vor „den Totschlägern bei der AfD“ gewarnt hat, hat nun, wie Eingangs schon angedeutet, auf der EKM-Synode Ende November die Ausschlußpolitik gegen Kirchenamtsträger aus dem AfD-Umfeld bekräftigt. Hatten Sie ernstlich gehofft, er würde noch einlenken?
Michaelis: Es wäre gut gewesen, wenn er sehr viel bedachter mit dieser Frage umgegangen wäre, denn sie ist zu komplex, wenn man allein die Außenwirkung betrachtet. Auch die Rechtsfragen sind nicht mittels Bischofsbericht zu klären beziehungsweise beiseitezuschieben. Ich finde es geradezu tragisch, was für ein Rechtsverständnis sich hier offenbart.
Normalerweise muß man entlang dem geltenden Recht den möglichen Handlungsrahmen begrenzend abstecken. Hier wird nun aber ideologisch das Recht den Zielen nachgeordnet. Das Recht dient nicht mehr der Abwehr des Einzelnen gegen übergriffige, die Freiheit einschränkende Maßnahmen, sondern verkommt zu einer Herrschaftsform, die Menschen wegen ihrer unliebsamen Auffassungen vom gesellschaftlichen Diskurs auszuschließen versucht.
Der Zugehörigkeit oder auch nur der Nähe zur AfD wird geradezu ein Bekenntnisrang zugemessen, der dann Mittel der Kirchenzucht rechtfertigt – womit in früheren Zeiten zum Beispiel Ehebruch geahndet wurde. Damals sind ebenfalls Kirchenglieder ihrer kirchlichen Rechte enthoben worden oder Pfarrer des Dienstes. Es fehlt nur noch, daß AfD-Mitglieder außerhalb kirchlicher Friedhöfe beerdigt werden müssen.
Um auf die Frage zurückzukommen, haben Sie ein Einlenken für möglich gehalten?
Michaelis: Nein, damit habe ich nach den Erfahrungen nicht gerechnet. So bekam ich etwa im Fall meiner Kommunalwahlkandidatur am Karsamstag einen überraschenden Telefonanruf des Landesbischofs mit dem Ziel, mich davon abzubringen. Ich denke, ich übertreibe nicht, wenn ich es als angeregt-autoritär bezeichne.
Was wurde denn besprochen?
Michaelis: Fast eine Stunde lang ging es um Coronamaßnahmen, diverse politische Banner an Kirchen, Fragen des Wahlrechts, der bürgerlichen Rechte und um das Pfarrdienstrecht – wir haben einiges durchdiskutiert. Ich habe mit meiner Meinung nicht hinter dem Berg gehalten. Die von ihm vorgebrachten Argumente waren aus meiner Sicht weder rechtlich noch theologisch stichhaltig. Schlußendlich sollte ich dennoch den Bischöfen gehorchen, weil sie sich miteinander und mit dem Landesverfassungsschutzpräsidenten beraten und von diesem haben überzeugen lassen.
Dazu aber hatte ich wirklich keine Lust. Ich habe mich auf die Augsburgische Konfession von 1530 berufen, insbesondere Artikel 28: „Man soll den gewählten Bischöfen nicht gehorchen, wenn sie irren.“ Zehn Tage später bekam ich die Bannandrohungsbulle – heute nennt sich das Disziplinarverfahren. In diesem wurden mir die Ordinationsrechte entzogen, gewissermaßen ein Kanzel-Maulkorb. So etwas hat es wegen politischer Betätigung seit vielen Jahrzehnten nicht mehr gegeben!
„Was meine Kirche da verlangt, das riecht schon sehr nach Ablaßhandel“
Die EKM argumentiert, daß die Werte der AfD den christlichen Grundwerten widersprächen. Warum, meinen Sie, stimmt das nicht?
Michaelis: Vorsicht, wenn man darauf einsteigt, ist man bereits in die Falle der Beweislastumkehr getappt! Es gibt bei dieser Argumentation einige gravierende Fehler: Die Kirchen sind nicht bereit, mit der AfD einen ordentlichen und hochkarätigen Diskurs zu führen. Das wäre in lutherischer Tradition das Allererste, nämlich einen Raum zu bieten, in dem unterschiedliche Positionen unter Zusicherung des freien Geleits zur Diskussion gestellt werden, ohne daß gleich die soziale Reichsacht verhängt wird.
Da war sogar Kaiser Karl V. – dank der Überredungskünste des sächsischen Kurfürsten Friedrichs des Weisen und einer realistischen Einschätzung der Türkengefahr vor 500 Jahren – um Welten besser, wenigstens so lange in Worms getagt wurde.
Auf der Internetseite der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland findet sich eine Argumentationshilfe unter der Überschrift „Wie die Grundsätze der EKM-Verfassung mit Positionen und Aussagen der AfD kollidieren“. Dort findet man Passagen aus der Kirchenverfassung und „belastende“ Zitate von Personen nebeneinandergestellt, die zum Teil noch nicht einmal Mitglieder der AfD sind – zusammengesucht aus dem Internet, Zeitungen und von „Correctiv“. Mehr ist es nicht.
Es gibt also keinerlei theologisch fundierte Auseinandersetzung?
Michaelis: Nein, noch nicht einmal Thesen, mit denen man sich in reformatorischer Manier auseinandersetzen könnte. Es erinnert mich an einen Brief, in welchem sich Martin Luther 1522 über ein Buch äußert, das ihm wohl von einem Widersacher übersandt worden war. Es sei aber geschrieben „mit solchem Witz“, Witz meinte damals den Verstand, also „mit solchem Witz oder Schreibart wie der Esel, so unter den Löwen mit seinen Ohren verraten worden. Das habe ich ins Feuer geworfen. Christus macht seine Widersacher trefflich wahnwitzig.“
Im Klartext, die Einfalt seiner Argumente enttarnt den Dummen?
Michaelis: So, in etwa. Dann haben wir eine wichtige Frage: Was sind christliche Grundwerte? Hier werden Vokabeln aus Theologie und Staatsrecht vermischt. In einem Staatswesen geht es um Grundwerte und Grundrechte. In der Kirche geht es um das Bekenntnis. Meines Wissens hat die AfD niemals Gott als Schöpfer, die Auferstehung Jesu Christi, sein Erlösungswerk und das Wirken des Heiligen Geistes oder die Confessio Augustana von 1530 in Frage gestellt. Das Gegenteil ist der Fall.
Was dann immer als Defizit der AfD ins Feld geführt wird, Nächstenliebe und Barmherzigkeit etc., das aber sind gar keine Grundwerte, sondern das sind die guten Werke, die aus dem Glauben erwachsen. Nach Martin Luthers Rechtfertigungslehre ist es zwar völlig richtig, sie zu tun, aber heilsnotwendig sind sie eben gerade nicht. Daraus irgendwelche zeitlichen oder ewigen Vorteile zu erwarten, wäre ein Rückfall hinter die Erkenntnisse der Reformation.
Und jemandem deshalb mit Nachteilen zu drohen oder zu überschütten, riecht schon sehr nach Ablaßhandel, erst recht, wenn man sich die Zulassung zu einer kirchlichen Wahl zukünftig durch eigenhändige Unterschrift auf einem Zettel zum Abschwören erkaufen muß.
„Auch in der Kirche gilt die Unschuldsvermutung – noch“
Sie kritisieren das als eine Art Beweislastumkehr.
Michaelis: Ja, eben darauf würde es hinauslaufen, denn wenn jemand kirchlicher Ämter enthoben oder zur Wahl in ein Amt gar nicht erst zugelassen werden soll, muß er eigentlich nicht beweisen, daß er unschuldig ist, sondern die Kirchenleitung muß ihm vorlegen, was ihm persönlich angelastet wird. In einem geregelten Verfahren ist zu klären, ob ein persönlich zuzurechnendes Verschulden vorliegt oder nicht. Vorher hat die Unschuldsvermutung zu gelten. So wäre es richtig!
Die geplante Regelung für die Gemeindekirchenratswahlen 2025 sind diesbezüglich sehr, sagen wir „aufschlußreich“, insbesondere wenn man bedenkt, daß damit ja angeblich die „Demokratie gerettet“ werden soll. Denn dort steht: Soll jemandem die Wählbarkeit aberkannt werden, so beschließt das der Kreiskirchenrat. Vor dem Beschluß hört er den Gemeindekirchenrat an.
Eine Anhörung des Betroffenen selbst ist nicht vorgesehen?
Michaelis: Bezeichnenderweise nein. Zwar kann er gegen den Beschluß Beschwerde im Landeskirchenamt erheben – was aber ausdrücklich keine aufschiebende Wirkung hat! Bleibt seine Beschwerde ohne Erfolg, steht es ihm immerhin noch frei vors kirchliche Verwaltungsgericht zu gehen. Doch bis da entschieden wird, sind die Wahlen vermutlich schon längst vorbei.
Und das ist keineswegs ein spitzfindiger Gedanke, wie Sie vielleicht denken könnten, denn ich habe das selbst 2022 bei den Wahlen zur Pfarrvertretung erlebt! Ich wurde als Vorsitzender des Pfarrvereins wegen meiner Coronamaßnahmenkritik abgewählt und folglich nicht mehr in die Pfarrvertretung entsandt, deren Vorsitzender ich ebenfalls war.
Zu den Pfarrvertretungswahlen wurde ich danach gar nicht erst eingeladen. Über die Gründe kann man nur spekulieren. Gegen diesen faktischen Entzug meines aktiven und auch passiven Wahlrechts habe ich im Landeskirchenamt Beschwerde eingelegt. Beschieden wurde die Beschwerde nie. Und dann waren die Wahlen halt vorbei. Ob das bei den Gemeindekirchenratswahlen anders läuft, bleibt abzuwarten.
„Was Gott zur AfD sagt, kann von der Kirche nicht vorweggenommen werden“
Andererseits: Hat die Kirche nicht das Recht, sich ihre Mitglieder selbst auszusuchen?
Michaelis: Das könnte man aus kirchenrechtlicher Sicht meinen. Jedoch handelt es sich nicht um einen Verein, sondern um die Kirche Jesu Christi. Also müssen wir uns der Frage zuerst theologisch annehmen. Es ist eben die Kirche Jesu Christi und nicht die Kirche einer Kirchenleitung oder irgendwelcher Gremien, die darüber entscheiden können, egal ob nach Gutdünken oder demokratisch verpackt.
Man spricht deshalb auch nicht von Mitgliedern, sondern von Gliedern der Kirche. Paulus beschreibt die Kirche als den Leib Christi. Durch die Taufe sind wir dessen Glieder. Nicht einmal eine Rangfolge darf es untereinander geben, also auch kein Herrschen übereinander. Die Zugehörigkeit zu Christus, in der wir miteinander verbunden sind, entzieht sich menschlichem Zugriff.
Martin Luther schrieb 1543 in einem Brief zu solcher Fragestellung: „Das Evangelium sei nicht unser, noch einiges Menschen, ja auch keines Engels, sondern allein Gottes, unseres Herrn, der es mit seinem Blut uns erworben, geschenkt und gestiftet hat zu unserer Seligkeit … Ihr habt auch nichts dazu gegeben, und viel weniger Recht daran als der Teufel am Himmelreich.“
Also lautet die Antwort auf die Frage?
Michaelis: Na die ist damit doch klar beantwortet: Nein, es steht niemandem außer dem dreieinigen Gott zu, darüber zu entscheiden. Und was er am jüngsten Tag sagen wird, warten wir mal geduldig ab. Da Jesus für unsere Sünden gestorben ist, bin ich recht zuversichtlich, als lutherischer Christ sowieso.
Selbst wenn also Mitglieder der Alternative für Deutschland falsch gelegen haben sollten, steht es keiner Kirchenleitung zu, den Jüngsten Tag vorwegzunehmen und politisch auszuschlachten. Hier sickern politische Kriterien durch ein paar Denkfehler in kirchliches Handeln ein und vergiften die Gemeinde.
„Verfassungsschutz gewinnt Einfluß auf die Besetzung von Pfarrstellen und Kirchengemeinderäten“
Die Haltung der EKM widerspricht also selbst den christlichen Grundwerten?
Michaelis: Nun zumindest scheint es an der nötigen Logik zu fehlen. Es gibt die Heilige Schrift und die Bekenntnisschriften. An denen wäre alles zu messen. Stattdessen kann man lesen, was alles an derzeit gerade gängigen Dingen aufgeführt wird. Wer zum Beispiel „das Klima leugnet“, dem wird unterstellt, er wolle die Schöpfung nicht bewahren und stimme deshalb nicht mit christlichen Grundwerten überein. Das ist Unsinn.
Denn es gibt lediglich unterschiedliche Auffassungen, was sinnvoll ist und was eben nicht. Ob man irgendwelchen Auffassungen zum Klimawandel folgt, kann doch kein Grund sein, von den Gemeindekirchenratswahlen ausgeschlossen zu werden. Es ist schlicht nicht die Aufgabe der Kirche, in gesellschaftliche Diskussion so hart einzugreifen, oder genauer gesagt, jede Diskussion zu unterdrücken.
Hier wird, wie schon Eingangs gesagt, der Glaube für politische Ziele mißbraucht und ebenso kirchliche Strukturen. Martin Luthers „Zwei-Reiche“-Lehre, also die Lehre von den zwei Regierweisen Gottes, sollte uns, wie ebenfalls schon erwähnt, eben davor bewahren! Wenn aber nicht mehr theologisch-kritisch nachgedacht wird, kommt es zu einer Vermischung mit fatalen Folgen.
Nämlich?
Michaelis: Einerseits wird von der Kirche auf politische Abläufe, wie etwa das Wahlverhalten massiv Einfluß genommen, wozu nun sogar innerkirchliche Abhängigkeiten bewußt ausgenutzt werden. Andererseits begibt sich die Kirche in Abhängigkeiten gesellschaftlicher oder politischer Institutionen, indem sie beispielsweise ihr Verhalten von Äußerungen der Verfassungsschutzbehörden abhängig macht, ohne diese kritisch zu prüfen, überhaupt prüfen zu können.
So gewinnt der Verfassungsschutz Einfluß auf Gemeindekirchenratswahlen oder, wie in meinem Falle, sogar auf die Besetzung von Pfarrstellen, also die ureigenste Aufgabe der Kirche, die geistliche Versorgung der Gemeinde. Damit droht die Freiheit der Verkündigung unter die Räder zu kommen!
Sie sehen also nicht nur die Demokratie, sondern auch Kirche und Glauben in Gefahr?
Michaelis: Wahrscheinlich machen wir uns noch nicht klar, welches Ausmaß die gesellschaftlichen Verwerfungen erreichen können. Bedauerlich ist, daß die Kirche in der Überzeugung, diese zu verhindern oder verhindern zu müssen, daran unversehens aktiv mitwirkt, auch indem sie undifferenziert maßlos überzogene Vorwürfe erhebt, um sich hernach daran abzuarbeiten.
Sie meint, Grundrechte für einen guten, allerdings aus ihrer Sicht leider indiskutablen Zweck aushöhlen zu dürfen, nachdem sie sich ein gouvernantenhaftes Deutungsrecht über die Gesinnung anderer Menschen angemaßt hat, welches ihr so nicht zusteht, als lutherischer Kirche nach Worms 1521 schon gar nicht.
Martin Luther sollte drei Tage nachdem er nicht widerrufen hatte, am 24. April überredet werden, wenigstens einem teilweisen Widerruf zuzustimmen. Er lehnte das mit den Worten ab, denn „vielmehr muß ein Christ für sich selbst prüfen und urteilen“.
Er hat damit deutlich gemacht, daß es selbst ihm, der als Reformator in die Geschichte einging, nicht zusteht, anderen die Entscheidungen abzunehmen beziehungsweise für sie zu sprechen. Er hat damit aus dem Glauben heraus einerseits enormen Mut bewiesen und andererseits der Versuchung widerstanden, Macht über andere zu gewinnen. Diesen Geist gilt es in unserer Kirche wiederzubeleben.
„Verletzung der Würde des Menschen und der verfassungsmäßigen Grundrechte“
Was ist alles in Gefahr, wenn es nicht gelingt, das zu stoppen?
Michaelis: Es geht um die Würde des Menschen, die durch das Verfrachten in politische Ecken oder Ränder mittels Sprache, verletzt wird. Das gängige Vokabular ist hinreichend geläufig. Es geht um die im Grundgesetz verbürgten Grundrechte: das Recht auf freie Entfaltung der Persönlichkeit, natürlich auch in der Kirche, um den Schutz vor willkürlicher Benachteiligung, um die freie Ausübung des Glaubens, das heißt unabhängig von politischen Überzeugungen. Auch das Recht auf Informationsfreiheit und freie Meinungsäußerung sind in Gefahr. Man darf sich mit anderen zusammenschließen, um gemeinsam Interessen zu verfolgen, ohne daß man einer „Kontaktschuld“ bezichtigt wird.
Die Frage, ob eine Partei sich auf dem Boden des Grundgesetzes bewegt und man folglich in dieser aktiv werden darf, kann nicht von einem Verfassungsschutz beantwortet und in die Gesellschaft zum Nachteil einer Partei und ihrer Wähler getragen werden. Denn nur das Bundesverfassungsgericht hat darüber zu befinden.
Auch einer Kirche steht es nicht zu, diesem aus moralischen Gründen vorzugreifen und innerkirchliche Sanktionen zu verhängen. Als Körperschaft des öffentlichen Rechts unterliegt auch sie, von Glaubensfragen abgesehen, der Verpflichtung weitgehender Neutralität.
Jeder, auch jeder Christ, jedes Glied einer Kirche hat die gleichen bürgerlichen Rechte und je nach Eignung den gleichen Zugang zu jedem öffentlichen Amt. Wenn es um öffentlich erhobene Vorwürfe geht – längst in inflationärem Ausmaß –, erinnere ich an den Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte vom 19. Dezember 1966.
Der was besagt?
Michaelis: Jeder hat ein Recht auf die genaue Kenntnis der Vorwürfe gegen ihn, auf die Möglichkeit, sich selbst angemessen zu verteidigen in einem geregelten Verfahren sowie das Recht, bis zum erbrachten Nachweis seiner Schuld als unschuldig zu gelten. Damit ist aus meiner Sicht untrennbar verbunden, den Beschuldigten nachteilsfrei und im gesamtgesellschaftlichen Umgang als Unschuldigen zu behandeln.
„‘Betreutes Wählen’ darf nicht die Aufgabe der Kirchen sein“
Hat sich die Kirche – oder einzelne ihrer Amtsträger – womöglich in einem Anflug von Hybris an dieser Aufgabe verhoben?
Michaelis: Das alles ist tiefgründig zu bedenken und die Rechte mit Bedacht gegeneinander abzuwägen, wenn Kirchenleitungen, auch Synoden im gesellschaftlichen Raum Einfluß nehmen möchten. Diese Arbeit wurde nicht ansatzweise geleistet. Dazu dürfte sowohl das Personal als auch die Kompetenz nicht ausreichend zur Verfügung gestanden haben und stehen.
Die Auseinandersetzung mit dem gesetzlichen Rahmen unserer Gesellschaft, der in weiten Teilen sogar dem Reformationsgeschehen zu verdanken ist, kann nicht durch empfundene oder angemaßte höherstehende Moral oder ein geistliches Amt ersetzt werden. Gerade dafür müssten wir als eine durch die Reformation geläuterte Kirche hinreichend sensibel sein und einstehen. Betreutes Wählen ist und kann keine kirchliche Aufgabe sein, sondern dies ist die Verkündigung und die Sakramentsverwaltung.
Sich diesen Aufgaben wieder zuzuwenden, ist die einzige Chance, die eine Kirche hat, denn nur dazu wird Gott seinen Segen geben. Sie muß wieder lernen, ihrer Verkündigung und dem Wirken Gottes so weit zu vertrauen, daß sie den Gläubigen die sie betreffenden Entscheidungen dann auch zu überlassen gewillt ist. Hierfür bedarf es einer zweiten Reformation, einer demütigen Besinnung.
Welche Chance sehen Sie für Ihre Anzeige? Glauben Sie wirklich, daß Sie recht bekommen?
Michaelis: Recht bekomme ich auf jeden Fall, so oder so – entweder in der Sache oder als Bestätigung meiner Befürchtungen bezüglich des Zustandes unseres Landes einschließlich der Kirche. Es geht mir nicht nur um die Feststellung, in meinen Rechten verletzt worden zu sein und das einer Kirchenleitung begreiflich zu machen. Es geht um die Chance, dem hohen Gut der Wahlen und vielem anderen mehr, dem viele Menschen schon nicht mehr trauen, wieder aufzuhelfen, um es zu bewahren. Hier tragen vor allem diejenigen eine immens große Verantwortung, denen wir das zur Prüfung vorgelegt und anvertraut haben.
__________
Martin Michaelis war Physiklaborant an der Universität in Jena, wo er 1961 geboren wurde, und später Theologie studierte. Als Pfarrer der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland (EKM) leitete er Gemeinden im thüringischen Altenburg und in Steinach (Landkreis Sonneberg). Er war Vorsitzender der Pfarrvertretung der EKM, Vorsitzender der Pfarrergesamtvertretung der Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands (VELKD) sowie Mitglied der Dienstrechtlichen Kommission der Evangelischen Kirche Deutschlands (EKD).
Nachdem er sich im Dezember 2021 das erste Mal auf einer sogenannten Lichterkette gegen die Corona-Maßnahmen ausgesprochen hatte, wurde er im Januar aus der Dienstrechtlichen Kommission und im März aus der Pfarrergesamtvertretung entfernt. Im März und April 2022 sprach er in Halberstadt auf drei Demonstrationen gegen die Impfpflicht, daraufhin folgte noch im April seine Abwahl vom Vorsitz des Pfarrvereins und ein Disziplinarverfahren gegen ihn, womit zugleich die Untersagung der Tätigkeit als Vorsitzender der Pfarrvertretung verbunden war.
Ab November 2023 übernahm er die Pfarrstelle in Gatersleben/Seeland bei Quedlinburg in Sachsen-Anhalt, bis ihm diese im März 2024 wegen seiner Kandidatur zur Gemeinderatswahl ebenfalls genommen und ein neuerliches Disziplinarverfahren eingeleitet wurde. Er selbst spricht von einem „De-facto-Berufsverbot“.
*Korrekturhinweis: In einer früheren Version des Interviews war in der Eingangsfrage davon die Rede, die EKM habe bekräftigt „AfD-Mitglieder auszuschließen“, gemeint war von Kirchenämtern. Da die Formulierung jedoch mißverständlich war, haben wir sie präzisiert und bitten etwaige Mißverständisse zu entschuldigen.