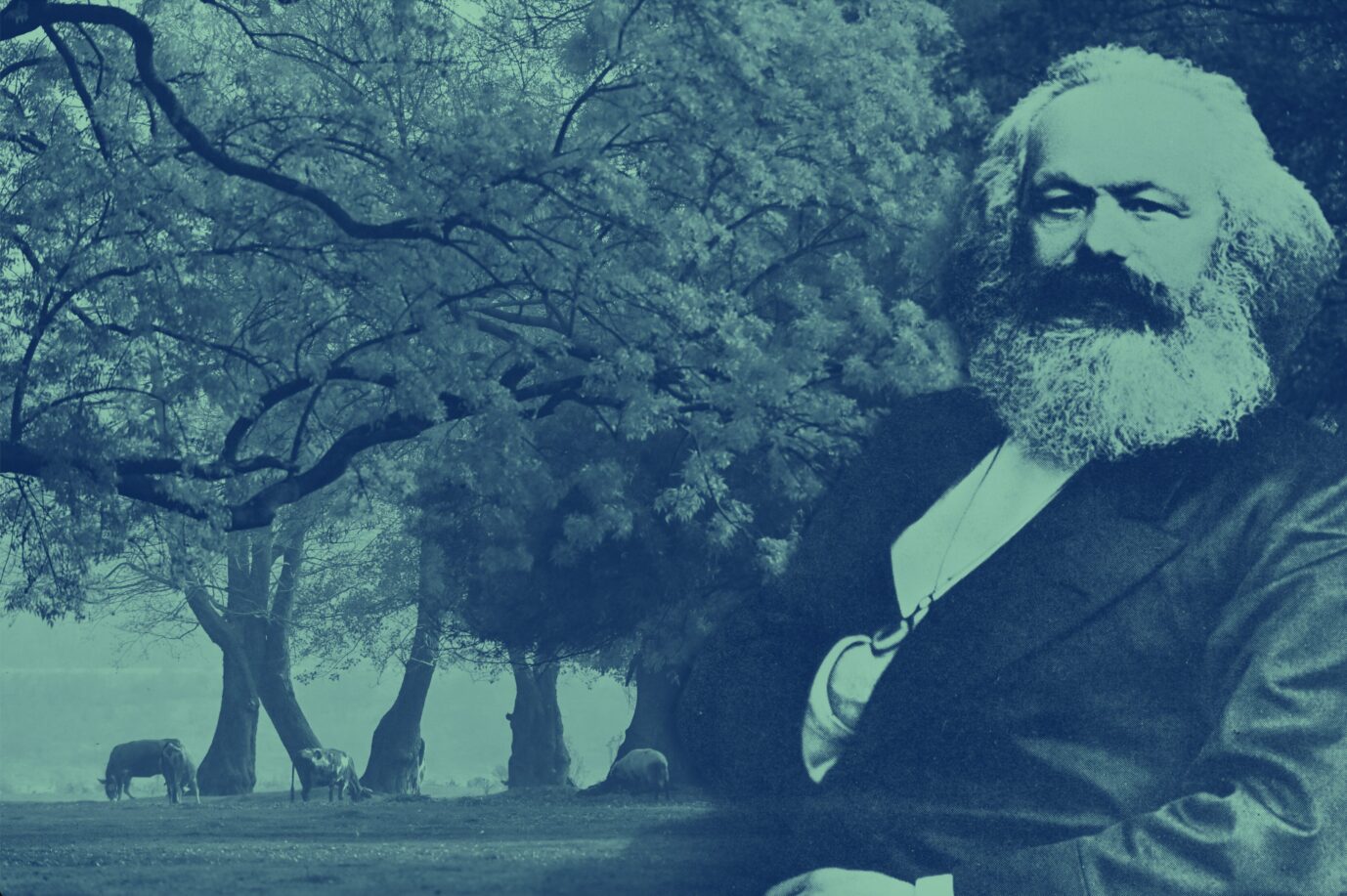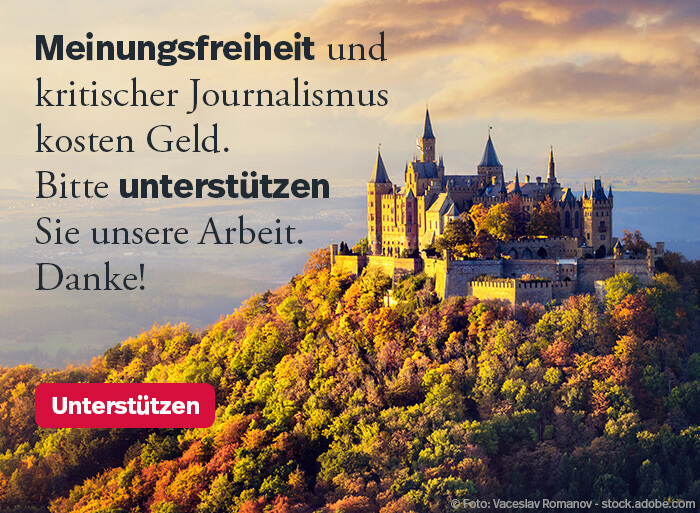Die Weltanschauung von Karl Marx entzündete sich nicht an der chronischen humanitären Katastrophe des ausgebeuteten Proletariats während der manchesterkapitalistischen Frühindustrialisierung. Sondern, so erklärt es der Althistoriker und hohe Ex-KPD-Funktionär Arthur Rosenberg in seiner „Geschichte des Bolschewismus“ (1932), es sei gerade umgekehrt: „Marx ging aus von sich selbst, von seinen eigenen geistigen und seelischen Nöten, von der Hölderlin-Stimmung des deutschen Intellektuellen im Vormärz.“
Was meint hier Hölderlin-Stimmung? Was verbindet den Klassiker der politischen Ökonomie, dessen Hauptwerk „Das Kapital“ von so drögen Materien wie Ware, Tauschwert, Mehrwert und Profitrate handelt, mit einem dem Wahnsinn verfallenen Dichter, der nach jahrzehntelangem Hindämmern 1843 starb (JF berichtete), als der Redakteur Karl Marx mit seiner Rheinischen Zeitung eben die publizistische Bühne betrat?
Keine Antworten auf diese Fragen gibt eine Tonne Literatur, die entferntesten Einflüssen sozialistischer Vorgänger nachspürt, aber die den 1818 geborenen Marx zeitlebens prägenden, in der Chiffre Hölderlin vereinten geistigen Strömungen der Goethezeit – Empfindsamkeit, Klassik, Romantik – fast unbeachtet läßt. Auskunft erteilte lange Zeit allein die 1981 posthum veröffentlichte Marx-Biographie Richard Friedenthals. Ihr nicht zur geistesgeschichtlich blinden Exegeten-Zunft der „Marxologen“ zählender Verfasser, Autor der erfolgreichsten Goethe-Biographie aller Zeiten, präsentiert seinen Helden als humanistisch gebildeten Bürgersohn, der an der Universität Bonn, in den 1830ern eine akademische Hochburg der Romantik, über den Tellerrand seines Jurastudiums schaut und Vorlesungen beim alten August Wilhelm Schlegel besucht, dem Programmatiker der Jenaer Romantik um 1800 (JF berichtete).
Marx hatte das romantische Naturverständnis verinnerlicht
Schlegel ermuntert seinen Gasthörer, Volkslieder zu sammeln, sich im studentischen „Poetenbund“ eifrig als Lyriker zu betätigen und seine Verlobte und spätere Frau Jenny von Westphalen mit weltschmerzlichen Liebesgedichten im Stile Heines und Byrons zu überschütten. Nebenher quillt ihm eine von Nacht- und Mondanbetung gesättigte Naturpoesie aus der Feder, bevölkert mit Scharen von Landschafts- und Wassergeistern.
Friedenthal hebt zwar hervor, daß insbesondere diese dilettantischen Verszyklen davon zeugen, wie tief Marx das romantische Naturverständnis verinnerlicht, das ihm hilft, seine „geistigen und seelischen Nöte“ zunächst literarisch zu lindern, bevor er sie als Theoretiker politisch zu kurieren versucht. Friedenthal erkennt auch, wie nachhaltig, bis ins hohe Alter, das romantische Lebens- und Naturgefühl Marx’ Weltbild fundiert, öffnet damit aber keine Zugänge zu einem neuen Verständnis dieses welthistorisch so wirkungsmächtigen Ideologen.
Das tut jetzt der Göttinger Germanist Heinrich Detering, der, fußend auf seinen Studien über die Entdeckung der Ökologie in der deutschen Literatur von Albrecht von Haller bis zu Annette von Droste-Hülshoff, eine Zeitenwende in der Rezeption einläuten will: weg vom roten, hin zum grünen Marx. Dabei springt der an Friedenthal anknüpfende Detering auf einen Zug auf, den einige vom „Klimawandel“-Diskurs inspirierte angelsächsische Marx-Forscher aufs Gleis setzten, und der dank des japanischen Philosophen Kohei Saito seit 2016 an Tempo gewinnt.
Marx lernte von Goethe
Dieser als „neuer Piketty“ gefeierte Kapitalismus- und Wachstumskritiker spürte in den Nachlaß-Manuskripten zum „Kapital“ nach 1867 angefertigte Exzerpte auf, die Marx als wachen Beobachter agrarökonomischer Kontroversen ausweisen, die eine substantielle Vertiefung seines ökologischen und eine grundlegende Neuausrichtung seines ökonomischen Denkens anstießen. Zuvörderst die intensive Lektüre der Schriften des Münchner Agrarwissenschaftlers Carl Fraas (1810–1875) belehrte ihn darüber, daß Pflanzenwachstum nicht allein von chemischen Prozessen im Erdreich abhängt, sondern wesentlich auch von Wechselbeziehungen zwischen Bodennutzung und Klima.
Nicht nur die Vernachlässigung chemischer Gesetzmäßigkeiten konnte darum den Boden erschöpfen und zu Hungerkatastrophen führen, die in der Antike im Untergang ganzer Zivilisationen mündeten. Die gleichen, durch Kunstdünger nicht zu verhindernden Effekte erzielen kleinräumige, menschengemachte Klimaveränderungen, bewirkt etwa durch „Entholzung eines Landes“. Die Natur lasse sich also nicht unendlich ausbeuten. Unerbittlich ziehe das Klima „Grenzen des Wachstums“, wie sie 100 Jahre später der Club of Rome markierte.
Das Marx durch Goethe, durch romantische Dichtung und Philosophie vermittelte, pantheistische Naturverständnis setzt den Menschen zu „Mutter Erde, Vater Äther, Bruder Bergstrom“ in engste verwandtschaftliche Beziehung, so daß er sich als Teil eines lebendigen Organismus zu begreifen lernt. Natur ist in diesen Konzepten nicht bloße Materie, die der Mensch unbeschränkt zu eigenen Zwecken gebraucht, sondern „sichtbarer Geist“ (Goethe), ein beseeltes Ganzes, das es vor enthemmter Nutzung zu bewahren gelte.
Heidegger sah in beiden Systemen die „Machenschaft“ am Werk
So revidiert der Philologe Detering an den Rändern der Marx-Forschung das bis heute dominante Zerrbild des Stifters einer politischen Religion, die sich den biblischen Auftrag „Machet euch die Erde untertan“ auf die Fahnen schrieb. Ein Bild, das jedoch die anfeuernde Hymne zu illustrieren scheint, die Marx im Kommunistischen Manifest von 1848 der Bourgeoisie und den „Wunderwerken“ ihrer „Großen Industrie“ singt, die mittels globalisierter „Unterjochung der Naturkräfte, Urbarmachung ganzer Weltteile“, „fortwährender Umwälzung der Produktion, ununterbrochener Erschütterung aller gesellschaftlichen Zustände“, einer von ihr erzeugten „ewigen Unsicherheit und Bewegung alles Ständische und Stehende verdampft, alles Heilige entweiht“.
Aus der Sicht deutscher Modernekritiker unterschieden sich der bei dieser nihilistischen Profitjagd mit Mensch und Natur Raubbau treibende US-Krokodilkapitalismus und der im gleichen Ungeist plündernde Sowjetkommunismus nicht. In beiden, in „Amerikanismus und Bolschewismus“, sah Martin Heidegger das Regime der „Machenschaft“ am Werk, das für Alfred Baeumler dem „Grundsatz der absoluten Produktion“, ihrer Maßlosigkeit und Unmenschlichkeit gehorchte. Der „Bolschewismus“ sei darum nichts anderes als „fortgeschrittener Amerikanismus“.
In diesem Sinne blieb der Gründervater des Marxismus für die durch Lenin, Stalin und ihre Nachfolger praktisch umgesetzte Politik brutalster Vernutzung des Planeten bis heute haftbar. Nichts untergrub, abgesehen vom moralischen Bankrott, den ihm das Gulag-System bescherte, so sehr das Vertrauen in seine Lehre wie der ökonomisch-ökologische Untergang der Sowjetunion.
Tschernobyl ist das mahnende Beispiel
Die scheiterte, weil sie gemäß Lenins primitiver Formel „Kommunismus ist Sowjetmacht plus Elektrifizierung“ die Natur rücksichtslos der „absoluten Produktion“ auslieferte. Mit dem Resultat, daß so gigantomanische Projekte wie die Umleitung sibirischer Ströme ökologische Notstandsgebiete hinterließen. Als eine von zahllosen Industriebrachen symbolisiert die stählerne Schutzhülle über dem Reaktorblock des 1986 havarierten ukrainischen Kernkraftwerks Tschernobyl Hybris und Kollaps dieses technokratischen Machbarkeitswahns.
Den durch das Sowjetdesaster diskreditierten „prometheischen“ Marx des „Manifests“, der sich der ökologischen Kosten der um den Erdball rasenden kapitalistischen Ökonomie nicht bewußt gewesen sei, trennt Saito vom alternden Marx der Nachlaß-Exzerpte, der das Problem der Naturzerstörung als Grenze ihrer kapitalistischen Verwertung entdeckt und erkennt, daß der wissenschaftlich-technische Fortschritt so lange nicht der Befreiung der Menschheit dient, wie die Wirtschaftsordnung auf Steigerung von Warenproduktion und Profit ausgerichtet ist. Mit Konsequenz verwandelt er darum Marx vom Ahnherrn des Wachstumsfetischismus zum Schutzpatron der „small is beautiful“ propagierenden ökosozialistischen Degrowth-Bewegung, die nach der grünen Devise „Heute schon auf morgen verzichten“ derzeit die Deindustrialisierung Deutschlands und Westeuropas inspiriert.
Detering ist eine anregende Marx-Revision gelungen
Da der Kapitalismus für den apokalyptisch gestimmten Greta-Thunberg-Fan Saito auf die nahende „Klimakatastrophe“ zusteuert, sei er durch einen weltrettenden „Systemsturz“ – so der Titel seines Spiegel-Bestsellers von 2023 – zu beseitigen. Und zu ersetzen durch strukturell kommunistische, das Gemeineigentum demokratisch selbstverwaltende Subsistenzwirtschaften nach dem Modell historischer germanischer Markgenossenschaften oder zeitgenössischer Dorfgemeinschaften in Hinterindien und Rußland, denen der ökologische Marx auf der Suche nach antikapitalistischen Alternativen intensive, zu Saitos Freude wiederum Exzerpte häufende völkerkundlich-soziologische Studien widmete.
Mit seinem grünen Marx folgt Detering, ein prototypischer deutscher Sinnsucher, der sich eifernd in den „Kampf gegen Rechts“ warf und der sich nun zum Glauben der Klimakirche bekennt, dem „Systemstürzer“ Saito fast sklavisch. Nur dessen These, Marx sei erst nach 1860 zum Ökologen gereift, weist er zurück, um die „universalpoetischen“ romantischen Quellen für dessen früh einsetzende, nie ermüdende ökologische Sensibilität aufzugraben. Sieht man von der bei Saito entliehenen plumpen ideologischen Einrahmung ab, ist Detering damit eine anregende, plausible und gut lesbare Revision orthodoxer Marx-Bilder gelungen.