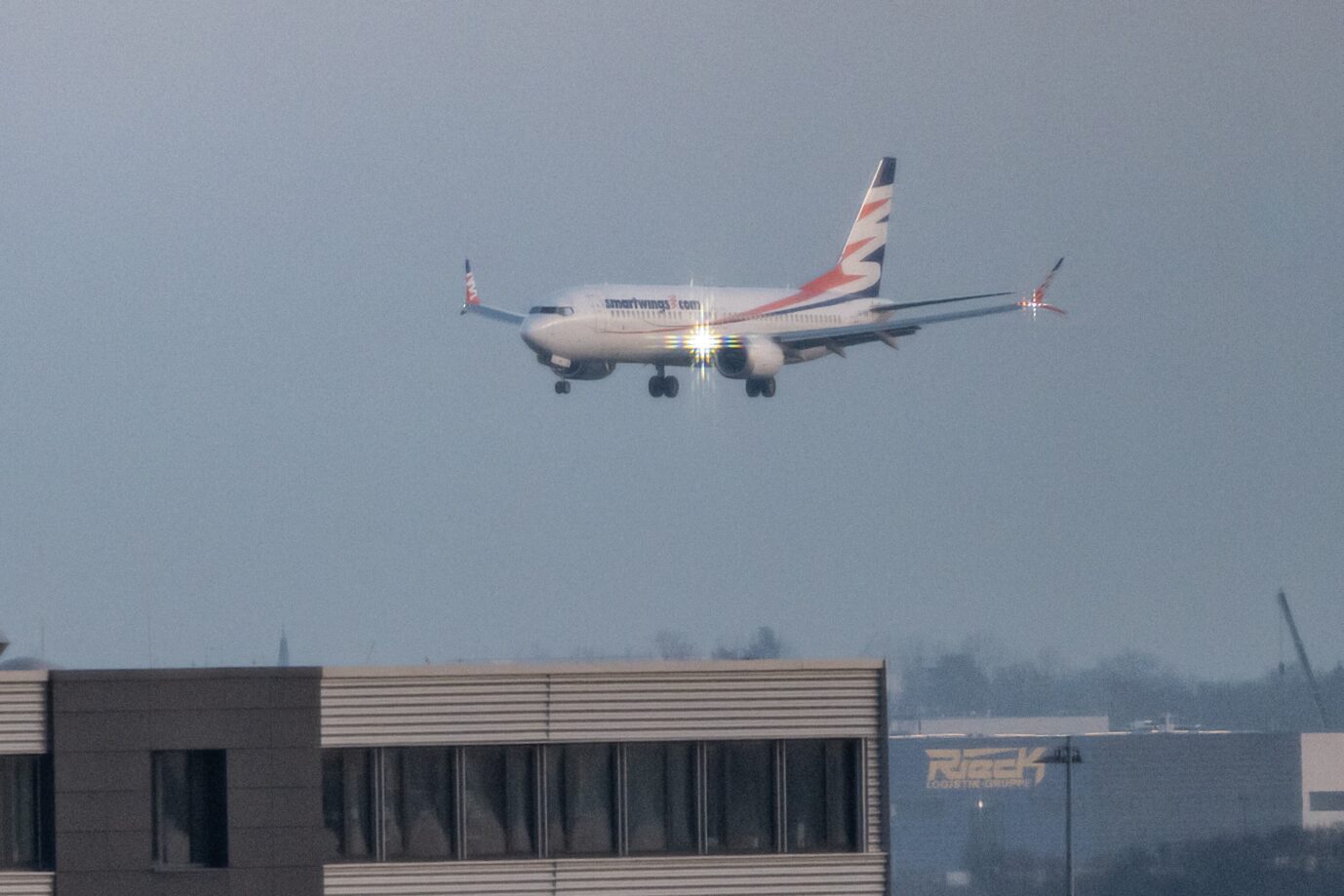Nach der Neuwahl nutzte die abgewählte rot-schwarz-grüne Zweidrittelmehrheit die Wochen bis zur Einberufung des neuen Bundestags, um mit einer Grundgesetzänderung Extraschulden zu ermöglichen, mit denen der Handlungsspielraum der neuen Regierung – entgegen allen Wahlversprechen – über drei neue Schuldentöpfe erweitert wurde (Art. 109, 115 und 143h GG): Erstens unterliegen verteidigungs- und sicherheitsbezogene Ausgaben oberhalb von einem Prozent des Bruttoinlandsproduktes (BIP) zukünftig keiner Kreditobergrenze; zweitens wurde ein 500-Milliarden-Sondervermögen für Infrastruktur und Klimaschutz (SVIK) für zwölf Jahre errichtet; drittens erhielten die Bundesländer einen jährlichen Kreditspielraum von 0,35 Prozent des BIP, über den bislang nur der Bund verfügte.
Das Ziel: Deutschland soll als Folge der wahrgenommenen Bedrohung durch Rußland „Kriegstüchtigkeit“ erlangen, Wirtschaft und Gesellschaft durch zusätzliche Investitionen zukunftsfähig gemacht werden und die klammen Länder und Kommunen auf Kredit saniert werden.
Die Umsetzung wirft Fragen auf
Doch die Umsetzung wirft bereits nach einem halben Jahr Fragen auf. Sparsamkeit, Kosteneffizienz und Wirksamkeit verlieren angesichts dieser Kreditspielräume speziell für den Verteidigungssektor an Bedeutung. Angesichts fehlender Rüstungskapazitäten dürfte der Anstieg des Wehretats von 81 (2024) auf geplante 150 Milliarden Euro (2029) in hohem Maße in Preissteigerungen verpuffen. Und welches Militärgerät anschaffen? Komplexes und teures Großgerät (15 Millionen Euro pro Leopard 2 A7V; etwa 170 Millionen Euro pro Kampfflugzeug F-35 – inklusive rotem US-Abschaltknopf?) oder günstige Drohnentechnologie (pro Stück bis zu 100.000 Euro), die zudem in den eigenen Reihen Soldatenleben schützt. Außerdem macht das im Ukrainekrieg gezeigte Innovationstempo lange Beschaffungs- und Bevorratungsplanungen obsolet.
Beim SVIK-Sondervermögen steht die gesetzlich vorgesehene Zusätzlichkeit der Investitionen in Frage. Wie eine Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) belegt, ist bereits die gesetzte Mindestquote von zehn Prozent ambitionslos. Nach Bereinigung um finanzielle Transaktionen lag die tatsächliche Investitionsquote des Bundes in den letzten Jahren sogar darüber – 2024 bei elf Prozent. Berechnungstricks weisen die Quote zudem überhöht aus. So wird die Investitionssumme nicht auf die Gesamtausgaben bezogen, da man die kreditfinanzierten Verteidigungsausgaben im Rahmen der Bereichsausnahme nicht miterfaßt.
Rein rechnerisch wird die Investitionsquote dadurch überhöht ausgewiesen. Dazu fließen Reparaturen und Unterhaltungsinvestitionen mit ein, die lediglich das Niveau der vorhandenen Infrastruktur erhalten, aber keine Neuinvestitionen sind. Dies stellt einen gravierenden Verstoß gegen die Forderung nach Generationengerechtigkeit dar, denn die zukünftige Generation muß die Kredite doppelt zurückzahlen – einmal etwa den für die Erstellung der Brücke, sodann den für deren Instandsetzung.
Warnung vor steigender Schuldenstandsquote ausgesprochen
Konsumnahe Investitionen wie Schwimmbäder haben keine Produktivitätseffekte. Hinzu kommt ein Verschiebbahnhof zwischen dem regulären Haushalt und den Schuldentöpfen. So können Mittel des Bundesetats für den Hamburger Hafenausbau in den SVIK verlagert werden. Mit dem Argument, als Militärumschlaghafen zu dienen, wäre eine Kreditfinanzierung über die Ausnahme Verteidigung möglich. Schließlich ist insbesondere bei den Krediten für die teils hochverschuldeten Länder und Kommunen eine Verausgabung im Sozialetat wahrscheinlich – Konsum auf Kredit gilt als gravierender Verstoß nicht nur gegen die Generationengerechtigkeit, sondern auch gegen die Nachhaltigkeit. Dies erklärt das IW-Ergebnis, demgemäß die Zweckentfremdung – je nach Berechnung – zwischen 26 und 49 Prozent beträgt.
Ökonomen warnten bereits im Frühjahr – vor Verabschiedung der Durchführungsgesetze – vor einem Verschiebebahnhof und einem erheblichen Anstieg der Schuldenstandsquote (aktuell 63 Prozent/BIP) sowie der jährlichen Defizitquote (1,3 Prozent/BIP). Ebenso warnte der Bundesrechnungshof in mehreren Stellungnahmen vor Fehlleitungen der Kredite. Deshalb erstaunt es um so mehr, daß sowohl der Sachverständigenrat (SVR) in seinem aktuellen Jahresgutachten wie auch die Bundesbank (Bbk) erst jetzt die Warnglocken ertönen lassen. Sie mahnen angesichts prognostizierter Schuldenquoten ab 2035 von über 85 Prozent/BIP und einer Defizitquote von über vier Prozent des BIP ab 2027 einen dringenden Konsolidierungsbedarf an, damit die Schuldentragfähigkeit langfristig keinen Schaden nimmt. In ihrem Vorschlag zur Reform der Schuldenbremse entwickelt die Bbk einen dreistufigen Plan zur Konsolidierung.
Die Bundesbank glaubt sich selbst nicht mehr
In der Phase bis 2029 sollen die hohen Defizite zwar möglich bleiben, die Kredite aber auf Verteidigung und zusätzliche Infrastruktur fokussiert werden. Zudem soll das Kriterium der Zusätzlichkeit stärker gesetzlich abgesichert werden. In der Übergangsphase 2030 bis 2035 sollen die Defizite schrittweise zurückgeführt werden. Dabei sollen die Wehrausgaben als staatliche Kernaufgabe zunehmend ohne Kredite finanziert werden. In der Zielzone ab 2036 sollen Kredite von 0,8 Prozent des BIP nur für zusätzliche staatliche Investitionen zulässig sein. Darüber hinaus soll der Kreditspielraum für Bund und Länder von 0,35 Prozent des BIP nur bestehen, wenn die Schuldenquote die EU-Regel von 60 Prozent nicht überschreitet.
Trifft die Projektion der Bbk zu, dann würde gegenüber derzeitigen Erwartungen 2040 eine Absenkung der Schuldenquote von 90 auf 70 Prozent/BIP und der Defizitquote von 3,2 auf ein Prozent des BIP erfolgen. Kritisch einzuwenden ist die lange Konsolidierungsdauer, denn erst Mitte der 2050er Jahre fiele die Schuldenquote unter die 60-Prozent-Grenze. Angesichts zweier „Schwarzer Schwäne“ in Gestalt von Corona und des Ukrainekrieges allein in den letzten fünf Jahren sowie der permanenten Aufweichung der EU-Schuldenregeln sind auch die Annahmen zu hinterfragen. Hinzu kommt, daß die Bbk an eherne Grundsätze selbst nicht mehr zu glauben scheint. So schlägt sie wohl auch angesichts hochverschuldeter Staaten wie Frankreich und Italien neuerdings vor, die EU solle Eurobonds für Rüstung durch den EU-Haushalt garantieren.
Jahresgutachten 2025/26 der „Wirtschaftsweisen“
Der Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung (SVR) sorgt sich in seinem Jahresgutachten 2025/26 um die Haushaltspolitik – und das bei einem Wachstum des BIP von nur 0,2 Prozent in diesem Jahr. In der Eurozone sind es 1,4 Prozent, weltweit sogar 2,6 Prozent. „Die Chancen, die sich aus dem Sondervermögen für Infrastruktur und Klimaneutralität (SVIK) ergeben, dürfen nicht verspielt werden“, mahnte SVR-Chefin Monika Schnitzer.
Weniger als die Hälfte der SVIK-Ausgaben fließen zusätzliche in die Infrastruktur. Ein Großteil werde für Haushaltsumschichtungen und zur Finanzierung konsumtiver Ausgaben genutzt. Daher fielen die erwarteten Wachstumswirkungen geringer und der Anstieg der Schuldenstandsquote höher aus, als dies bei einem strikt investitionsorientierten Ausgabenplan der Fall wäre. Auch bei den Bundesländern dürfe „nicht der Anreiz entstehen, notwendige Konsolidierungsanstrengungen durch die Inanspruchnahme der SVIK-Mittel zu unterlaufen“. Daher sollten 60 Prozent ihrer Zusatzgelder an die Kommunen fließen. (my)
Prof. Dr. Dirk Meyer lehrt Ökonomie an der Helmut-Schmidt-Universität Hamburg.