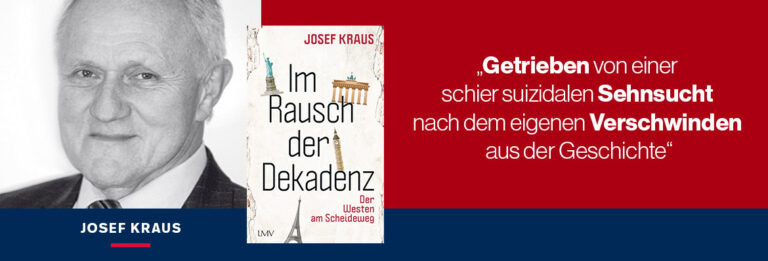Noch immer gilt die Ehe als beliebteste Form des Zusammenlebens. Knapp 19,5 Millionen verheiratete Paare werden derzeit in Deutschland gezählt. Das ist bei einer Einwohnerschaft von 82,5 Millionen eine durchaus stattliche Zahl. Doch täuscht sie darüber hinweg, daß die Ehe als ehemals alternativlose Form des Familienlebens längst ernstzunehmende Konkurrenz bekommen hat und in einer Krise steckt. Seit mehr als 30 Jahren ist hierzulande sowohl eine verstärkte „Abnahme der Heiratsbereitschaft“ als auch eine drastische „Zunahme an Ehescheidungen“ zu registrieren, wie es in bewährtem Amtsdeutsch heißt. Halte diese Tendenz mit unvermindertem Tempo an, prognostizieren Statistiker, müsse man zukünftig davon ausgehen, daß „von jüngeren Männern und Frauen fast ein Drittel zeitlebens ledig bleiben wird“. Lassen wir die Zahlen sprechen: Laut Angaben des Statistischen Bundesamts fiel die Zahl der jährlichen Eheschließungen im Jahr 1968 erstmals unter 600.000, aktuell liegt sie bei 374.000. Das ist der geringste Wert seit Kriegsende in Deutschland. Im selben Zeitraum stieg die Zahl der jährlichen Ehescheidungen von 100.000 auf über 200.000 an. Während also die Zahl der jährlichen Eheschließungen im erwähnten Zeitraum sich in Richtung Halbierung bewegte, hat sich die der Ehescheidungen seitdem mehr als verdoppelt. Aktuell werden jährlich halb so viele Ehen geschieden wie neue geschlossen. Damit liegt die geschätzte Scheidungsquote, bereinigt um die Scheidungszahl von Zweit- und Mehrfach-Ehen, zwischen 40 und 50 Prozent. Das bedeutet: Mindestens zwei von fünf Ehen stehen hierzulande über kurz oder lang vor dem Scheidungsrichter. Damit nähert sich die Nation schrittweise den Ländern mit den höchsten Scheidungsraten in Europa, beispielsweise Schweden, wo bereits seit gut zwanzig Jahren die Hälfte aller Ehen geschieden wird. Für die bundesdeutsche Familienpolitik bedeutet dieser Trend nichts anderes als ein komplettes Desaster. Hat sie sich doch seit mehr als vierzig Jahren den Schutz und die Förderung von Ehe und Familie zur Aufgabe gemacht, so wie es im Art. 6 des Grundgesetzes formuliert ist. Gebracht haben die Bemühungen allerdings wenig. Im Gegenteil: Könnte man die politischen Befürworter der Ehe etwa dazu verpflichten, die aktuellen Zahlen in ihre Argumentation mit aufzunehmen, vermutlich bliebe ihnen nichts als ein verschämtes Schweigen. Andernfalls könnte ihnen jeder halbwegs ausgeschlafene Dreikäsehoch entgegenhalten: Ihre eigentliche Bestimmung hätte die heutige Ehe wohl erst dann gefunden, wenn sie geschieden würde. Gerade Kinder und Jugendliche kennen die Scheidungsprozedur aus eigener Anschauung (aktuell ca. 170.000 betroffene minderjährige Kinder pro Jahr). In den Sozialwissenschaften werden jene unter ihnen, die keinen Kontakt mehr zu einem der Eltern besitzen, mit dem unschönen Begriff „Scheidungswaise“ bedacht. Dabei haben es Scheidungskinder auch so schon schwer genug: Schließlich kämpfen sie zeitlebens gegen eine Negativ-Statistik an. Aus der geht unzweifelhaft hervor, daß Kinder aus geschiedenen Ehen einem erhöhten Scheidungsrisiko ausgesetzt sind. Das Ganze nennt sich „intergenerationale Scheidungstradierung“ und beschreibt das schlichte Phänomen, daß Scheidungskinder ihre Form ehelicher Konfliktlösung von den Eltern modellhaft abgeschaut und verinnerlicht haben. Eine weit schwerwiegendere Tendenz in der modernen Ehe könnte jedoch dafür sorgen, daß Phänomene wie „Scheidungstradierung“ schon bald überlebte Begriffe sind. Denn Ehen werden nicht nur immer seltener und zumeist erst im vorgerückten Lebensalter geschlossen (aktuell: Männer mit 36,9 Jahren, Frauen mit 33,8 Jahren), sondern sie bleiben immer häufiger – meist gewollt, vermehrt auch ungewollt – kinderlos. Kinderlosigkeit jedoch nimmt der Ehe ihre eigentliche Funktion, nämlich als rechtlich besonders geschützte Institution Ort der familiären Reproduktion zu sein. Fällt nun diese Funktion aus, verliert die Ehe ihre einzigartige Stellung im Koordinatensystem der verschiedenen Formen des Zusammenlebens. Als einfach nur praktizierte Paarbeziehung ohne Kinderwunsch erfährt sie einen radikalen Bedeutungsverlust, der durch kein noch so wirksames familienpolitisches Steuerelement abgefangen werden kann. Bereits jetzt sind „29 Prozent der lebendgeborenen Kinder Sprößlinge von nichtverheirateten Eltern“. In den neuen Ländern fallen die Zahlen noch weit höher aus: So liegt etwa in Mecklenburg-Vorpommern der Anteil der nichtehelichen Geburten aktuell bei 63 Prozent. Für die derzeitige Familiensituation von Jugendlichen in Deutschland gilt ganz allgemein, daß mehr als 23 Prozent der 14- bis 17jährigen, also ein Viertel der gesamten Altersgruppe, bei Alleinerziehenden oder in nichtehelichen Gemeinschaften aufwachsen. Diese Zahl macht deutlich, daß die Beweiskraft des Arguments von der Ehe als „Kinder-Produktionsstätte schlechthin“, das gern von allen möglichen Entscheidungsgremien in Politik und Justiz verwendet wird, längst an Zugkraft und Glaubwürdigkeit eingebüßt hat. Da verwundert es kaum, daß sich immer mehr Kritiker zu Wort melden, die den steuerlichen Vorteil des sogenannten Ehegattensplitting nicht am Familienstand der Eltern, sondern vielmehr an der Anzahl der geborenen Kinder – ob nun ehelich oder nicht – festmachen möchten. Allerdings wird dabei von den Kritikern gelegentlich übersehen, daß es finanziell gegenüber der Ehe durchaus von Vorteil sein kann, wenn sich eine Mutter de jure als alleinerziehend ausgibt, obwohl sie de facto in einer eheähnlichen Gemeinschaft lebt. Wie dem auch sei, festzuhalten gilt, daß der Wertewandel in der Ehe dem Wertewandel in der Gesellschaft geschuldet ist. Denn dort, wo instabile Systeme und permanente Wechsel das Leben bestimmen, werden auf Stabilität und Dauer angelegte Rechtsinstitute wie die Ehe nicht bestehen können. In einer ausdifferenzierten Gesellschaft, in der die Dreiteilung Ehe, freie Verbindung und Zölibat längst der Vergangenheit angehört, in der eine Vielzahl von Lebensentwürfen gleichberechtigt nebeneinander steht – ja, sogar in ein und derselben Person wirksam werden kann -, ist die Institution Ehe lediglich eine unter vielen Möglichkeiten der praktizierten Paarbeziehung. Betrachtet man darüber hinaus das langfristige Gefährdungspotential der Ehe – drohende Instabilität, langwieriger Scheidungskrieg, lebenslange Unterhaltszahlung -, erweist sie sich zudem gegenüber anderen Verbindungen keineswegs als vorteilhaft. Doch selbst dort, wo genügend Geld zur Aufkündigung eines Ehekontrakts vorhanden ist, bleibt das eigentliche Dilemma der modernen Ehe offenkundig. Es besteht darin, daß Eheleute noch so sehr nach Orthodoxie in ihrem Zusammenleben streben können, als Form der Zweierbeziehung besitzt die Ehe von heute kein Nachher mehr, keine familiäre Zweckbestimmtheit, deren Werkzeug sie wäre. Kinder sind eben nicht mehr ihr Schicksal. Sobald aber – wie der französische Philosoph Pascal Bruckner bereits Anfang der achtziger Jahre des letzten Jahrhunderts feststellte – „die Zeugung aus ihrem natürlichen Bezugssystem herausfällt, bricht ein ganzes symbolisches Universum zusammen. Die Zweierbeziehung läßt sich nicht mehr als transitorische und funktionelle Form erleben, die von einer überlegenen Macht gewählt wurde, um für die Fortdauer der Geschöpfe zu sorgen.“ Aus Bruckners Befund ergibt sich zwangsläufig die Frage: Wozu soll dann die Ehe heute noch dienen? Die schwindelerregende Zunahme von offenen Paarbeziehungen und von dauerhaftem Singledasein mit oder ohne Kind gibt eine bestechend einfache Antwort darauf: zu nichts, allenfalls zum eigenen Vergnügen. In der Tat, selbst ein glühender Verfechter der Ehe steht heute ab und an in der Versuchung, das Ganze als nutzlose Veranstaltung oder willkürliche Verbindung abzutun. Das liegt an dem bereits erwähnten Funktionswandel der Ehe vom Ort familiärer Reproduktion hin zu einem der Zweierbeziehung, der vorrangig zur Befriedigung emotionaler Bedürfnisse dient und mit einer Verschiebung von Pflicht- und Akzeptanz- zu Selbstentfaltungswerten einhergeht. Damit jedoch ist der Anspruch an eine Ehe ein vollkommen anderer geworden als ehedem. Ehen, die auf einer solchen Basis beruhen – und wie gesagt, die Entwicklung geht in diese Richtung -, sind aus zweierlei Gründen verstärkt der Gefahr von Konflikten und einer möglichen Auflösung der Bindung ausgesetzt: Einerseits sind sie von großer oder gar zentraler Bedeutung für die Befriedigung der emotionalen Bedürfnisse der Partner und mangelnde Performanz in diesem Bereich ist nicht akzeptabel. Andererseits besteht aufgrund der Orientierung an der eigenen Selbstverwirklichung dauerhaft die Notwendigkeit, die gegenseitig zu erbringenden Leistungen auszuhandeln. Wenn aber das Streben nach Glück unter Wahrung der eigenen Autonomie eindeutigen Vorrang gegenüber dem gemeinsamen Leben bekommt, dann führt das schnell zu der Lebensmaxime: Beziehung ja, Bindung auf Dauer nein, folgerichtig kann das gemeinsame Leben dem eigenen Glücksstreben jederzeit zum Opfer fallen. Eine mehr oder weniger enge Beziehung bleibt zwar weiterhin erwünscht, doch wird sie umgehend gelöst, wenn die sich wandelnden individuellen Bedürfnisse sich als „Single“ oder mit einem anderen Partner oder in einer anderen Lebensform besser befriedigen lassen. Die Auswirkungen dieser veränderten Lebenseinstellungen auf Institutionen wie Ehe, Familie und auf das Verhältnis der Generationen zueinander sind so unverkennbar wie nachhaltig. Zwar hat der Einzelne an dieser Krise einen gehörigen Anteil mit seinem fiebrigen Anspruch auf Glück, Partnerschaft und individuelle Erfüllung, folgt darin jedoch nur den vorgegebenen Mustern einer Gesellschaft, in der nicht nur die Ehe als einstige Bewahrerin der Familie keinen Wert mehr besitzt. Egal, ob Single, unverheiratetes Paar, Eheleute ohne Trauschein oder sonstwer, sie alle sind weder Opfer noch zuchtlos. Allenfalls sind sie Adepten des Vagen, flatterhafte Produkte einer Ordnung, in der Dauer nichts und Wechsel nahezu alles bedeutet. So gesehen, befindet sich – wie Pascal Bruckner es formuliert – „die Ordnung selbst in der Krise (…) und nicht die Verhaltensweisen, die sie erzeugt, auf der also nicht mehr der Zwang zur Beständigkeit lastet“.