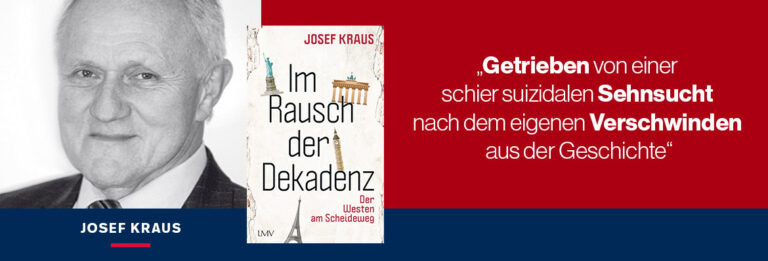Schicksale gleichen sich, und doch wieder nicht. Als im Frühjahr 1946, ein Jahr nach Kriegsende, John Maynard Keynes starb, ging sein Stern erst auf. Auf der Grundlage seiner Einsichten und der darauf aufbauenden Politik erlebte die westliche Welt, das besiegte Deutschland in seiner Westhälfte eingeschlossen, ein goldenes Zeitalter: Die Wirtschaft brummte, der Wohlstand erreichte die arbeitenden Massen, die ihn bislang hatten entbehren müssen, der Kapitalismus wurde „sozial“. Als 60 Jahre später im Herbst 2006 Keynes‘ lebenslanger ökonomischer Antipode Milton Friedman starb, lag die durch ihn personifizierte Gegenbewegung zur keynesianischen Theorie im Koma. Zwar blieb es dem großen alten Mann der postkeynesianischen Ökonomie erspart, ihr definitives Ende erleben zu müssen. Wenige Tage nach seinem Tod bekam ihr letzter und unerschütterlicher Hort, die Europäische Zentralbank (EZB), von ihren überseeischen Schwesterbanken bescheinigt, daß die Friedmansche Geld- und Weltformel ausgedient habe, wonach eine strenge Rationierung des Zuwachses an Zentralbankgeld völlig ausreiche, um überall auf der Welt Wohlstand und Beschäftigung zu garantieren. Gestützt auf neuere Erkenntnisse der Geldwissenschaft, teilten die Kollegen dem sichtlich konsternierten EZB-Chef mit, daß mit „Geldmengenzielen“ à la Friedman, unterstützt durch neutrale, Defizite vermeidende Staatshaushalte, weder ein nachhaltiger Sieg über die Kräfte der Inflation noch über die Stagnation in der Wirtschaft zu erreichen sei. Friedmans fester Glaube, daß auf Märkte stets mehr Verlaß sei als auf die auf diese Märkte einwirkenden Regierungen, lasse sich nicht länger vertreten. Für die Geldpolitik seien neue Strategien angesagt, im Kern jedoch beinhalteten sie die Rückkehr zu den alten. Einem hätte die rechtzeitige Kenntnis von Friedmans wichtigstem Beitrag zur modernen Geldökonomie eine peinliche Blamage erspart: Deutschlands rüstigem Weltökonomen Helmut Schmidt. Als er als „Therapie“ zur Überwindung des ersten weltweiten Ölschocks von 1973/74 verkündete, ihm seien „fünf Prozent Inflation lieber als fünf Prozent Arbeitslosigkeit“, hatte Friedman in seiner berühmten Eröffnungsrede zur Tagung der American Economic Association von 1967 längst nachgewiesen, daß es zwischen beiden Phänomenen keinen stringenten Zusammenhang gibt, weder logisch noch empirisch. Arbeitslosigkeit lasse sich nicht mit monetären oder fiskalischen Tricks überwinden, sondern nur durch Politikangebote, die die Marktakteure überzeugten, denn diese Leute könnten rechnen. Nähmen ihre Inflationsängste zu, dann gingen diese auch in ihre Zukunftsplanungen, Investitionsentscheidungen und Geldanlagen ein. Statt zu fallen, stiegen die Zinsen, trotz (oder wegen!) der höheren Inflationsrate könne dann die strukturelle Arbeitslosigkeit sogar zunehmen statt zurückgehen. Zeit seines Lebens wurde Milton Friedmans Werk und Leistung überschattet von den Allgemeingültigkeitsansprüchen seiner Schüler und den sich mit seinen Formeln rechtfertigenden Politikern. Ging etwas schief, dann lag es an der Formel, nicht an ihnen. Nur: Friedman war nicht der antikeynesianische Bilderstürmer, als den man ihn verkaufte. Mehr als einmal hat er öffentlich darauf hingewiesen, daß er auf der („makroökonomischen“) Grundlage seines Vorgängers aufbaue und diese nicht verwerfe. Anders als viele seiner Mitstreiter sah er in Keynes nicht den Gegner, sondern den Inspirator, zentrale Fragen der Ökonomie neu zu stellen und zu überprüfen. Als Sohn armer jüdischer Einwanderer hatte er im US-Kapitalismus nicht nur Karriere gemacht, sondern auch die Vorteile und Vorurteile der Arrivierten kennengelernt. Zeit seines Lebens wurde Milton Friedmans Werk und Leistung überschattet von den Allgemeingültigkeitsansprüchen seiner Schüler und den sich mit seinen Formeln rechtfertigenden Politikern. Ging etwas schief, dann lag es an der Formel, nicht an ihnen. Seine Schwäche, vielleicht sein Fehler war es, daß er sich nicht klar genug vom ressentimentgeladenen Markt-Radikalismus seiner österreichischen Freunde der sogenannten Wiener Schule abgrenzte, die in den 1930er Jahren in die USA immigriert waren und zunehmend in Washington und London den Ton angaben. Margaret Thatcher und Ronald Reagan, die politischen Exponenten der neoliberalen (richtiger: neokapitalistischen) Gegenrevolution, waren weit mehr geprägt von Ideen und Schrifttum eines Friedrich August von Hayek (und dessen Lehrer Ludwig von Mises) als von Friedmans „Monetarismus“ und seinen pragmatischen Korrekturen des alten Keynesianismus, den er radikal vereinfachte, um nicht zu sagen simplifizierte. Die Neoliberalen der Wiener Schule waren von Hause aus mittelalterliche Nominalisten im philosophischen Sinne; real war für sie nicht der Wald, sondern nur die Zahl der Bäume. Was zählt, ist das Individuum, nicht die Gesellschaft und schon gar nicht der Staat. Berühmt wurde Thatchers Diktum: Es gibt keine Gesellschaft, nur die Personen. Entsprechend lehnten sie den Staat und seine Gemeinwohl-Ziele ab: sein breit gefächertes Angebot an öffentlichen Gütern, von Bildungschancen bis Verkehrsmitteln; seine Bemühungen zur Sicherung von Arbeitsplatz, Ruhestand und der Gesundheitsversorgung der Bevölkerung. Für Hayekianer und von ihnen inspirierte Politiker waren das nur Vor-Formen des „Sozialismus“ oder dieser selber. Sie führten geradewegs zum Verlust der Freiheit und in die Knechtschaft („Road to serfdom“ lautete denn auch der programmatische Titel von Hayeks politischem Credo). Friedman arbeitete zwar eng mit dem marktradikalen Flügel der neoliberalen Bewegung zusammen, aber deren bedingungslose Gleichsetzung von Markt und persönlicher Freiheit teilte er nur mit Einschränkungen. Eine dieser Einschränkungen gegenüber der Marktgläubigkeit lautete: Alle Annahmen und Aussagen über den Markt und seine Abläufe müssen empirisch überprüft und nachgewiesen werden. Als Statistiker überprüfte er die Annahmen der Keynesschen Theorie über die Geldnachfrage und die Abhängigkeit privater Konsumausgaben und des Sparens vom langfristigen Trend der Einkommensentwicklung. Die Volatilität der Geldnachfrage führte ihn zur Kritik an der von Keynes propagierten Inflations- und Depressionsbekämpfung über die Zinspolitik. Erfolgversprechender, fand er, sei das bereits in der altehrwürdigen Quantitätstheorie zur Norm erhobene Postulat der Ausrichtung der Geldmenge am Zuwachs von Güterangebot und realer Wertschöpfung, der Wachstumsrate des Sozial- oder Bruttoinlandsprodukts. So dachte Friedman, gerade weil er Keynes‘ tiefsitzende Skepsis gegenüber der Kompetenz von Zentralbankgouverneuren und ihren Apparaten teilte. Da er nicht an deren Fähigkeit glaubte, die Volkswirtschaft wie ein guter Lotse sicher zwischen der Scylla der Inflation und der Charybdis der Krise hindurchsteuern zu können, lieferte er ihnen einen bequemen (und wie er glaubte verläßlichen) Kompaß: die Steuerung der Wirtschaft über die Geldmenge statt über den Zins. Doch Friedmans größte währungspolitische Innovation wurde zu seinem Waterloo. Er unterschätzte die Folgen des (von ihm mitentfesselten) geld- und finanzierungstechnischen Fortschritts für seine eigene Geldmengenformel. Doch zunächst war die Geldmengensteuerung ein voller Erfolg, besonders in Deutschland, wo sich die Deutsche Bundesbank ab Mitte der 1970er Jahre zu ihrem Vorreiter machte. Tatsächlich kehrte das Vertrauen der Wirtschaft in die Politik zurück, je besser es der Politik gelang, die Furcht der Investoren und Anleger vor allzeit drohenden oder sich noch verschärfenden Inflationsgefahren zu zerstreuen und allzu verwegenen Gewerkschaftsforderungen den Wind aus den Segeln zu nehmen. Die Dispositionen der Wirtschaft konterkarierten nicht mehr die Intentionen der Politik: weder durch teure Vorsichtsmaßnahmen noch durch überzogene Spekulationen. Den Flop von Friedmans „monetaristischer“ Geldmengenlehre lösten jene Innovationen an den nationalen und internationalen Geld- und Kapitalmärkten aus, die sich nach dem Zusammenbruch des Bretton-Woods-System und als Folge des Ölschocks von 1973/74 ergaben. Die Banken lernten im nationalen und internationalen Zahlungsverkehr mit immer weniger Zentralbankgeld auszukommen, ihr Bedarf an den Friedmanschen Geldkategorien schrumpfte dramatisch. Friedmans „monetäre Geldbasis“, Grundlage wie Kontrollinstrument der volks- und weltwirtschaftlichen Finanzierungsprozesse, erodierte. Mit den neuen Finanzierungstechniken verloren Friedmans geldpolitische Innovationen ihre Bedeutung. Banken, Fonds und „Heuschrecken“ (Hedgefonds) refinanzierten sich wechselseitig. Am Markt und an der Zentralbank vorbei kamen immer neue, dem Zugriff durch die Zentralbank entzogene Finanzprodukte wie Derivate und Optionsscheine auf den Markt. Weder als Garanten der Wechselkursstabilität noch als Geldlieferanten noch als Clearingstellen für den Abrechnungsverkehr wurden Zentralbanken gebraucht; der Markt und seine Akteure kamen ohne sie aus. Was bringt eine Kontrolle durch die Zentralbank, wenn diese ohnehin nur noch am Rande des Spielfeldes agiert? Was immer die Deutsche Bundesbank und die inzwischen auf ihren Tritt festgelegte Europäische Zentralbank (EZB) an Geldmengenzielen und -kontingenten vorgibt: Weder werden diese eingehalten, noch sagen sie allzuviel aus. Sie spielen für das Geschehen an den Märkten kaum noch eine Rolle. Die globale Geldwirtschaft hat sich doppelt emanzipiert – von der Realwirtschaft, der sie dienen, und von ihren Zentralbanken, unter deren Kontrolle sie stehen sollte. Friedman selber hat mit seiner zweiten Großtat, der weltweiten Durchsetzung flexibler Wechselkurse, den Startschuß für die Entwertung seiner eigenen Erfindung, der Geldmengensteuerung, abgefeuert. Als guter (Ex-)Keynesianer hatte er sich von freien Wechselkursen einen wirksameren Zugriff der Zentralbanken auf Geldmärkte und Konjunkturen versprochen. Doch er hatte die Rechnung ohne Beachtung der Folgen für die globalen (und exterritorialen) Geld- und Kapitalmärkte gemacht. Diese explodierten nach der Abschaffung der im Bretton-Woods-System kontrollierten Wechselkurse. Frei von jeder Zentralbankaufsicht und -kontrolle durften sie jetzt „alles“ finanzieren: seriöse Geschäfte wie abenteuerliche Spekulationen mit dem Ergebnis einer noch nie dagewesenen Inflation der Aktienkurse und Immobilienpreise. Das Geld dafür besorgten sie sich intern: aus wechselseitiger Kreditgewährung („Kreditreiterei“), Bank-zu-Bank-Verbindlichkeiten und Firmen-zu-Firmen-Krediten. Inzwischen trägt eine permanent schrumpfende Geldbasis eine sich permanent verbreiternde Kreditpyramide, deren stets möglichen Einsturz niemand verhindern kann: keine Zentralbank und kein IWF. In seinen letzten Lebensjahren griff der alternde Milton Friedman immer häufiger zur Feder, um vor dieser auch in seinen Augen bedrohlichen Marktverwilderung zu warnen und sie zu kritisieren. Der Alptraum, daß der Kapitalismus nicht am Staatsinterventionismus (Hayeks „Sozialismus“) zugrunde gehen könne, sondern am Systemrisiko der Finanzmärkte, machte ihm zu schaffen. Er dürfte angesichts der immanenten Kollabierungsgefahren des von ihm geprägten Finanzsystems nicht unbedingt sorgenfrei gestorben sein. Friedman arbeitete zwar eng mit dem marktradikalen Flügel der neoliberalen Bewegung zusammen, aber deren Gleichsetzung von Markt und persönlicher Freiheit teilte er nur mit Einschränkungen: Solche Annahmen müßten empirisch
nachgewiesen werden. Auch eine weitere Annahme, daß nämlich Konsumieren und Sparen nicht vom aktuellen Einkommen abhängen, wie Keynes seiner Meinung nach zu voreilig und ungeprüft unterstellt hatte, sondern vom langfristig erwarteten „Lebenseinkommen“ bestimmt werden, hat sich nicht bestätigt. Der Vergleich zwischen den früheren Wohlstands- und den gegenwärtigen Krisenjahren zeigt deutlich, daß in Zeiten der Perspektivlosigkeit – also den jetzigen – Keynes recht behält, und nicht Friedman. Wenn die Menschen die Angst vor Verlust des Arbeitsplatzes und ihnen drohender Altersarmut befällt, dann kommt die alte Volksweisheit wieder zu Ehren: „Spare in der Zeit, dann hast Du’s in der Not“. Doch damit verstärken die Sparer in der Zeit ungewollt die Krise und die Not von morgen. Um diese zu überwinden, bedarf es des Staates, der die Geldausgaben, auf die die Wirtschaft angewiesen ist, hoch- und das Angstsparen in Grenzen hält, weil auf die sozialen Sicherungssysteme, die den Menschen das Zukunftssparen abnehmen, Verlaß ist. Vergleicht man beide das 20. Jahrhundert prägenden Weltökonomen Keynes und seinen kritischen Reformator Friedman, dann zeigt sich: Der Ältere hat nicht nur den Kapitalismus vor der Kernschmelze nach dem Börseneinbruch des „Schwarzen Freitag“ vom Oktober 1929 bewahrt – denn daß sich dieser zum verheerenden Super-Gau der damaligen Weltwirtschaft ausweitete, war den falschen Reaktionen der Zentralbanken (allen voran der US-Zentralbank) zuzuschreiben, darin stimmten Keynes und Friedman nahtlos überein. Speziell diesem Versagen hat Milton Friedman sein wichtigstes und wohl zeitlosestes Werk gewidmet, seine mit Anna Schwartz verfaßte „Geschichte der Geldpolitik der Vereinigten Staaten, 1867-1960“ aus dem Jahr 1963. In ihm bestätigt er Keynes und widerlegt ihn trotzdem. Dennoch blieb Keynes für Friedman ein wissenschaftliches Professoren- und politisches Beraterleben lang der geistige Übervater. Er vergaß nie, daß Keynes die Marktwirtschaft nicht nur vor dem Zusammenbruch gerettet, sondern ihre Überlegenheit gegenüber dem Kommunismus vor aller Welt bewiesen hatte, den damals viele westliche Intellektuelle für das bessere System hielten. Keynes hatte sie zur unverzichtbaren Geschäftsgrundlage des demokratischen Rechts- und Sozialstaates gemacht. So jemand war kein irregeleiteter Sozialist oder Salonbolschewist, wie Mises und Hayek intern wetterten, denn Keynes‘ Einfluß überschattete den ihren, solange sie lebten. Friedman war objektiver. Er hatte Keynes‘ Verdienste um die USA, in denen er aufgewachsen war und zu Zeiten von Roosevelts „New Deal“ Karriere gemacht hatte, erlebt und erfahren, daß Märkte versagen und eine Nation in Krise und Arbeitslosigkeit stürzen können. Trotzdem hat er in späteren, guten Zeiten die Rolle des Marktes über- und die Gefahr von Krisen aus Marktversagen unterschätzt. Aber blind dafür war er nicht. Sonst hätte sein letzter und aktuellster Auftritt in der Öffentlichkeit nicht der eindringlichen Warnung an die Adresse der Europäer gegolten, sich mit Euro und EZB einem „Währungszentralismus“ zu verschreiben, dessen fatale Folgen für die monetäre, soziale und politische Stabilität der Staaten des alten Europa er voraussah. Friedman konnte sich ein integriertes Europa ohne unabhängige Staaten, Währungswettbewerb und Wechselkurse, die die volkswirtschaftliche Leistung der Nationen widerspiegelten, nicht vorstellen. Dennoch war er selbstkritisch genug, vor der „monetaristischen“ Falle zu warnen, die er selber aufgestellt hatte. Daran ist seine moralische und intellektuelle Größe zu messen und nicht an den Übertreibungen von Mitstreitern und Epigonen. Prof. Dr. Wilhelm Hankel war Direktor der Kreditanstalt für Wiederaufbau und Ministerialdirektor unter Wirtschaftsminister Karl Schiller (SPD). Seit 1967 lehrt er Währungspolitik an der Universität Frankfurt am Main. Foto: Leere Straßen während der Ölkrise 1973/74: Der Anfang vom Ende des Monetarismus