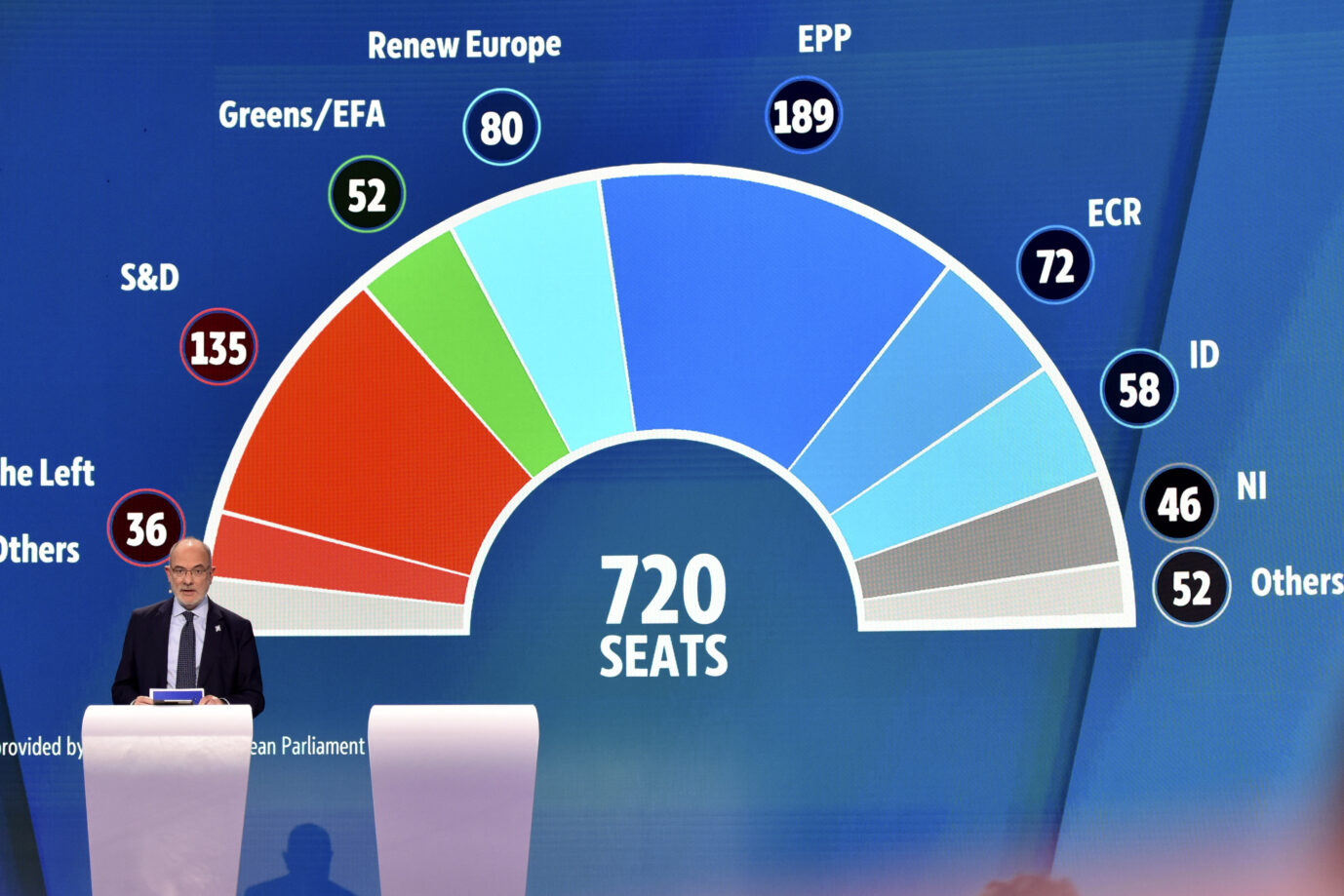So kennt man es, das alte Europa: als Versorgungsstation für angejahrte Politprominenz, die anderweitig nicht mehr vermittelbar ist. Personalien werden da nach heißem Postenschacher im Hinterzimmer ausgekungelt und dem für minderbemittelt gehaltenen Bürger als gewaltiger demokratischer Fortschritt präsentiert. Blöd, wer da nicht mittut, den Spielverderber mimt und sich einfach überstimmen läßt. So wie der britische Premier David Cameron, der sich durch sein „starrköpfiges“ Nein zum neuen designierten EU-Kommissionspräsidenten Jean-Claude Juncker nach einhelliger Eurokraten-Meinung „ins Abseits gestellt“, unmöglich gemacht und selbst geschadet haben soll.
Hat er das wirklich? Die Farce rund um die „Spitzenkandidaten“ bei der Europawahl war ja selbst nichts anderes als eine Kungelei; vom EU-Parlament und seinem Präsidenten Martin Schulz (SPD), dem Westentaschen-Napoleon aus Würselen, ausgeheckt und den EU-Regierungschefs handstreichartig aufgedrängt. Für eine Entscheidung über den Kommissionspräsidenten durch die EU-Wähler gibt es keine Legitimation in den Verträgen und schon gar keine demokratische. Denn dafür hätten die europäischen Völker als Souveräne eine europäische Verfassung beschließen müssen, die eine parlamentarisch verantwortliche und ihren nationalen Regierungen übergeordnete europäische Regierung schafft. Daran haben die europäischen Nationen ersichtlich kein Interesse; die einzigen, die je über eine EU-Verfassung abstimmen durften, Franzosen und Niederländer, haben sie prompt abgelehnt und mußten sich dafür vom künftigen EU-Kommissionschef Juncker hämisch beschimpfen lassen.
Juncker als Inbegriff des arroganten, bevormundenden Europas
Daß David Cameron diese Farce nicht mitgemacht hat, schadet vielleicht seinem Ansehen unter Eurokraten, aber nicht bei den eigenen Bürgern, denen sich ein guter Demokrat an erster Stelle verpflichtet sehen sollte. Nicht nur für britische Wähler ist Juncker ein Inbegriff ebenjenes zentralistischen, arroganten, undemokratisch bevormundenden Europas, das sie mehrheitlich nicht wollen. Und es ist zweifellos nicht nur unter britischen Wählern populär, einen Euro-Zentralisten abzulehnen, dessen wichtigster Beitrag zur europäischen Politik seine zynisch-erhellenden Beschreibungen der ungeschriebenen Gesetze der EU-Politik sind: Klammheimlich vollendete Tatsachen schaffen, ohne daß es einer mitkriegt, und wenn es ernst wird, muß man eben lügen.
Nach dem Brüsseler Gipfel ist erst mal wieder klargestellt, daß es auch so weitergehen soll. Personalien werden wie üblich im Paket verhandelt, damit jeder, der es „verdient“ hat, auch ein schönes Stück vom Kuchen kriegt. Der unermüdlich wieselnde Martin Schulz, der in seinem einzigen echten Wahlamt als Bürgermeister von Würselen den Stadthaushalt mit Nachwirkungen bis heute zerrüttet hat, wird wieder Präsident eines Pseudoparlaments ohne Wahlvolk und Wahlgleichheit und bekommt dafür ein fürstliches Gehalt sowie einen Hofstaat in Halbkompaniestärke. Und Jean-Claude Juncker, der an einer Geheimdienstaffäre gescheiterte Ex-Premier einer Banken- und Steueroase mit angeschlossener Regierung, dessen reales politisches Gewicht dem eines Großstadt-Oberbürgermeisters entspricht, der aber als Chef der Euro-Gruppe die Weichen so stellen durfte, daß die Höhen und die Tiefen der Gemeinschaftswährung stets zum Vorteil des Finanzparadieses Luxemburg ausfielen, darf seinen politischen Lebensabend als EU-Kommissionspräsident ausklingen lassen.
Eine Transferunion zu Lasten Deutschlands als Heilmittel
Schon vorher hat Juncker keinen Zweifel daran gelassen, daß die Euro-Krise ganz im Sinne der Südländer zu einer Transferunion zu Lasten Deutschlands zementiert werden soll. Den vom „Club Med“ entsprechend enthusiastisch unterstützten Banken-Lobbyisten Juncker zu verhindern wäre also auch im Sinne Deutschlands gewesen, auch wenn die Alternative letztlich nur ein anderer Euro-Zentralist gewesen wäre. Immerhin hätte eine Einigung der Regierungschefs auf einen eigenen Kandidaten den Primat der Nationalstaaten als Herren der Verträge und Entscheidungen betont. Ein Superstaat EU, dem durch die Pseudo-Parlamentarisierung der Auswahl des Kommissionspräsidenten weiter Vorschub geleistet wird, ist ebensowenig im britischen wie im deutschen Interesse.
Es ist bezeichnend für die primär an Innenpolitik und Parteitaktik ausgerichtete Außenpolitik der Bundeskanzlerin, daß sie trotz dieser Interessenübereinstimmungen den britischen Amtskollegen im Regen stehen ließ. Nur um sich nicht mit dem Koalitionspartner SPD anlegen zu müssen, machte sich Merkel für einen Kandidaten stark, der den Weg in die Transferunion und in die dauerhafte Ausplünderung des deutschen Steuerzahlers noch beschleunigen wird.
Die Wurstigkeit, mit der die Kanzlerin wider besseres Wissen einmal mehr den Weg des geringsten Widerstands gegangen ist, könnte in Großbritannien die Stimmung für einen EU-Austritt weiter befeuern. Die selbstgefällige Indifferenz vieler deutscher Kommentatoren gegenüber dieser Option ist durchaus unangebracht. Großbritannien könnte für Deutschland nicht nur ein unverzichtbarer Verbündeter gegen die zunehmenden Umverteilungs- und Vergemeinschaftungswünsche der Südländer sein; auch Londons Vorstellungen zur EU-Reform – zurück zur föderalen Freihandelszone mit starken Nationalstaaten und ohne zentralistischen Überbau – sind im deutschen Interesse. Großbritannien wird unter innenpolitischem Druck in nächster Zeit verstärkt auf Schritte in diese Richtung dringen. Deutschland wäre gut beraten, mit den Briten in dieser Frage an einem Strang zu ziehen.
JF 28/14