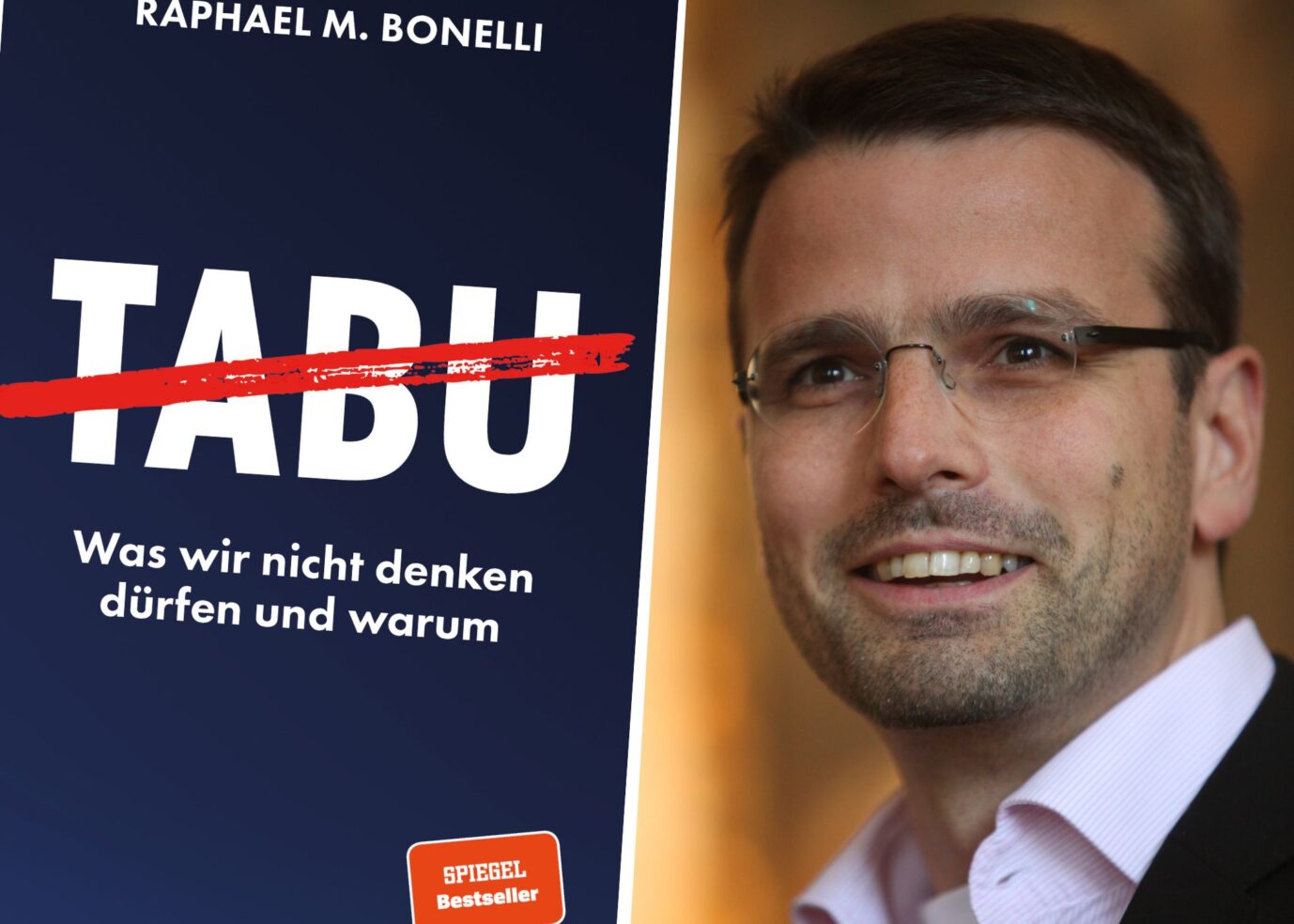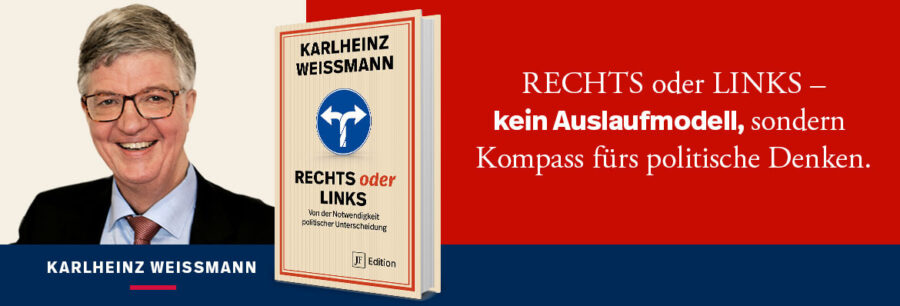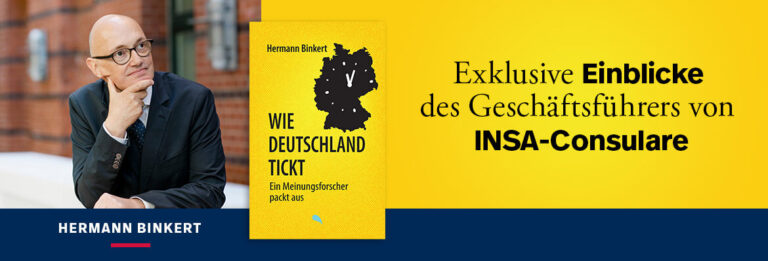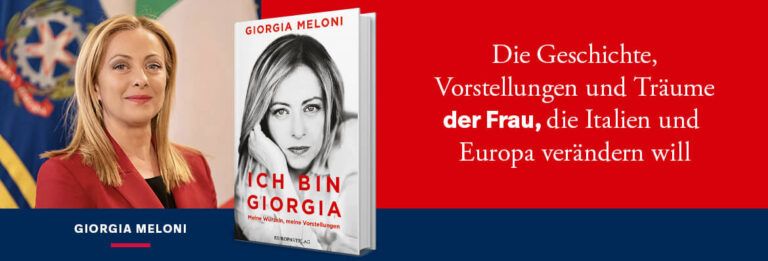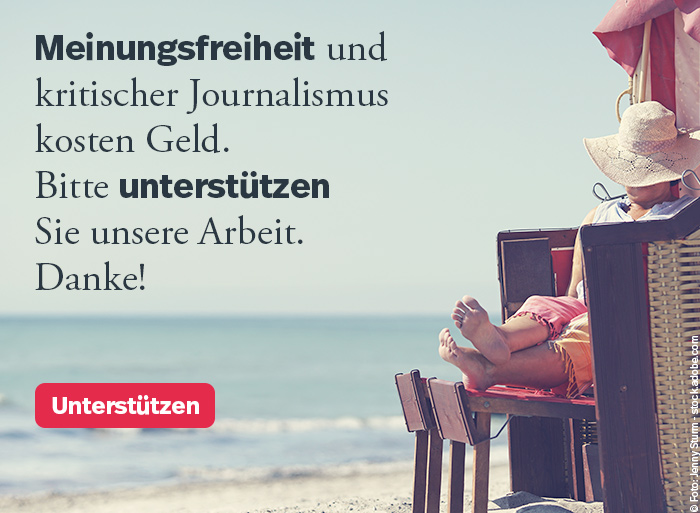Frau Professor Guérot, ist das Urteil gegen Marine Le Pen ein Skandal?
Ulrike Guérot: Ich bin keine Juristin, doch ein sehr bewanderter französischer Fachmann, dem ich vertraue, sagte mir, es sei rechtlich absolut einwandfrei. Und dennoch hat es ein Geschmäckle.
Warum?
Guérot: Auch wenn es juristisch gerechtfertigt sein mag, ist es doch drakonisch. Auch weil der veruntreute Betrag von fünf Millionen Euro vergleichsweise gering ist: Bei Christine Lagarde etwa waren 400 Millionen Euro kein Grund, nicht EZB-Chefin zu werden. Ursula von der Leyens EuGH-Urteil wegen Korruption in Sachen Impfstoff war kein Hindernis, sie nur einen Tag später zur Kommissionspräsidentin zu wählen.
Und Jens Spahn – vermutlich der kommende Königsmörder von Friedrich Merz – dürfte ein zweistelliger Millionenbetrag im Zuge des Maskendeals wohl nicht von Ambitionen auf das Kanzleramt abhalten, und ob ihn überhaupt jemand verklagt, steht in den Sternen.
Sie meinen, wäre Le Pen keine Rechte, wäre das Urteil milder ausgefallen?
Guérot: Das will ich nicht zwingend sagen. Und doch ist es wohl das seit Jahrzehnten weitreichendste politische Urteil in Europa, und auf jeden Fall ist es historisch: Entweder, falls der Verdacht nicht zutrifft, weil eine mutige Richterin endlich einen harten Schritt gegen die Parteienkorruption in Frankreich gewagt hat.
Oder, falls er zutrifft, weil das Urteil die fatale zeitgenössische Tendenz bestärkt, Wahlen durch Gerichte zu ersetzen. Vor diesem Hintergrund wird es aufschlußreich sein, was mit Nicolas Sarkozy geschieht, für den die Staatsanwaltschaft wegen Korruption sieben Jahre Gefängnis gefordert hat.
„Die Tendenz, Wahlen durch Gerichte zu ersetzen“?
Guérot: Ja, nehmen Sie etwa die Versuche in den USA, Trump vor der Wahl ins Gefängnis zu bringen, in Rumänen die Sperrung Călin Georgescus, des Gewinners der ersten Runde der Präsidentschaftswahlen, hierzulande die Überlegungen, die AfD zu verbieten oder aktuell in der Türkei die Verhaftung des Oppositionsführers Ekrem İmamoğlu. Auch wenn das juristische Vorgehen gegen politische Opponenten legal sein mag, so ist es doch nicht legitim – und die Reduzierung von legitim auf legal ist der Vorbote von Rechtspositivismus!
Ulrike Guérot: „Es ist brutal ausgeschlossen zu werden“
Was also droht der Demokratie in Europa?
Guérot: Eine Wende ins Autoritäre, wie sie etwa der Politologe Johannes Agnoli beschrieben hat: „Involution“ nennt er, sich demokratischer Methoden zu bedienen, um die Demokratie von innen zu entkernen. Die Demokratie wird also formal nicht abgeschafft, aber unter der Oberfläche mit autoritären Elementen angefüllt.
Sie haben diesen Prozeß selbst erfahren, wurden von der gefragten Politologin zur Persona non grata.
Guérot: Sie meinen meine Kündigung aus wohl vorgeschobenen Gründen? Ja, dann blickt man etwas anders auf Demokratie und Gesellschaft und geht auch anders durchs Leben.
Zum Beispiel?
Guérot: Heute springen mir etwa all die selbstzufriedenen Wohlstandsbürger regelrecht ins Gesicht, die sich um die Probleme des Landes keine Gedanken machen. Früher war ich selbst im polit-medialen System berufstätig, traf Politiker aller Couleur, Journalisten, Leute wie Wolfgang Ischinger, Claudia Major, Wolfgang Schäuble, Cem Özdemir, Franziska Brantner oder Friedrich Merz. Ich könnte lange fortfahren, gleichsam die halbe Bundespressekonferenz oder „halbe Republik“ aufzählen.
Es geht ja immer um Austausch, Hintergründe, Tagungen, Konferenzen und Informationen. Ich war in dieser Welt zu Hause – was a priori nichts Verwerfliches ist. Ich glaubte mich dort wertgeschätzt, persönlich wie fachlich, und daß gute Analysen und kritisches Denken in unserem Land willkommen seien, man alles diskutieren könne.
Wenn man dann von all dem von heute auf morgen ausgeschlossen wird, ist das brutal: Man verliert seinen gesamten gesellschaftlichen Kontext, gleichsam das soziale Gewebe, das einen umgibt – und vor allem versteht man zunächst nicht warum. Schließlich verlor ich sogar meine Stelle an der Universität Bonn, stand quasi von einem Tag auf den anderen ohne Einkommen da.
„Ich mußte erfahren, daß all die Wertschätzung nichts zählt“
Der Grund sind Plagiatsvorwürfe: In erster Instanz hat das Arbeitsgericht Ihre Klage abgewiesen, nun läuft die Berufung.
Guérot: Ich hoffe sehr, daß ich diese völlig aufgeblähten Vorwürfe entkräften kann und das Landesarbeitsgericht Köln am 16. Mai die Kündigung für nicht rechtskräftig erklärt. Dennoch verändert eine solche Erfahrung den Blick auf die gesellschaftlichen Mechanismen und unsere Demokratie.
Etwa schrieb die FAZ vor Jahren, „die schnellsprechende, hochintelligente Ulrike Guérot“. Man würde also denken, wenn die „hochintelligente“ Ulrike Guérot sagt, bei Corona stimmt etwas nicht, dann müßte ihr berufliches Umfeld doch nachdenklich werden und sich fragen „Stimmt dann da vielleicht tatsächlich etwas nicht?“ und das diskutieren. Aber das passierte nicht.
Vielmehr mußte ich erkennen, daß all die goldenen Worte, all die Wertschätzung nichts zählten. Wie sagte Julian Assange: Seine größte Enttäuschung sei gewesen, zu erfahren, daß Intelligenz und Mut nichts miteinander zu tun haben.
Was denken Sie heute über diese Menschen?
Guérot: Ich hatte mir eingebildet, auf mein berufliches Umfeld sei Verlaß und daß dort alle gleich dächten wie ich, etwa daß bei Corona die Freiheit und im Ukraine-Konflikt der Frieden verteidigt werden muß – auch grundgesetzlich übrigens. Plötzlich aber wird man angefeindet und aus dem System ausgespuckt, weil man genau dafür eintritt. Und doch ist es schwer, zu einem endgültigen Urteil zu kommen, denn kann man jene verwerfen, mit denen man so viele Jahre seines Lebens geteilt hat?
„Andere auszugrenzen nennt man heute ‘die Demokratie retten’“
Diese Menschen halten sich selbst für vorbildlich demokratisch, sozial, tolerant und menschlich. Sind sie das?
Guérot: Ich unterstelle niemandem böse Absicht und konzediere, daß man, steckt man ganz und gar in einem bestimmten Umfeld, davon überzeugt ist, daß alles, was dieses tut, richtig ist. Dann nimmt man – wie früher auch ich – tatsächlich anderes Denken und andere Argumente oft nicht wahr. Und wenn doch, dann erscheint beides bedrohlich und muß kategorisch abgelehnt werden. Genau das passiert heute – man nennt es „Demokratie retten“.
Dieses Feststecken ist nachvollziehbar, aber rechtfertigt es die Ausgrenzung Andersdenkender?
Guérot: Nein, aber wie schon der antike Dichter Aischylos schrieb: Es ist des Menschen Charakter, den der fällt, noch zu treten. So habe ich es erlebt. Es gab über 180 Haß-Artikel gegen mich quer durch alle relevanten Medien. Leute, die ich gar nicht kannte und die nicht einmal den Kontakt zu mir suchten, traten nochmal nach, als ich quasi zum Abschuß freigegeben war.
So gab es etwa in der Zeit ein Interview mit einem Politologen, in dem man sich daran ergötzte, welchen Quark ich doch angeblich rede. Ein zentrales Argument dafür, daß ich mich zum Ukraine-Krieg nicht äußern dürfe, war, daß ich kein Ukrainisch spräche. Pardon, aber sprechen etwa Claudia Major, Roderich Kiesewetter oder Agnes Strack-Zimmermann Ukrainisch? Also schrieb ich an zwei sehr gute Freundinnen in der Redaktion – mit einer war ich noch 2019 in Urlaub –, ob nicht jemand dort mal den Finger hätte heben können, bevor so etwas gedruckt wird.
Ähnlich beim Spiegel, der einen absurden Haß-Beitrag über mich brachte, worüber ich mich bei einer guten Freundin in der Redaktion beschwerte. In beiden Fällen bekam ich nur ausweichende oder wütende Antworten. Das Wegducken von Freunden tut schon weh, und es läßt einen den Kopf schütteln.
Wie auch im Fall eines langjährigen Freundes bei der Süddeutschen Zeitung, der einen Nachruf auf Jacques Delors vorbereitet hatte, für den er mich ausführlich befragte, weil ich von 1996 bis 1998 dessen wissenschaftliche Mitarbeiterin war – entsprechend häufig kam ich in dem Text vor. Doch als Delors 2023 starb, rief er mich an: die Redaktion habe gebeten, meinen Namen daraus zu streichen.
Wie bitte? Das ist ja wie bei Orwell!
Guérot: Ja, und als ich fragte, was es ihn gekostet hätte, darauf zu beharren, daß der Nachruf so oder gar nicht erscheine, antwortete er mir allen Ernstes: er habe zu viel Streß. Es erinnert an Hannah Arendt, die sagte, in der schlimmsten Krise schmerzen dich nicht die Worte deiner Feinde, aber es fehlen dir die deiner Freunde. Auch daß mir ein Kollege an der Uni einmal nicht die Hand gab oder eine bekannte Literaturagentin in Berlin demonstrativ ein Restaurant wegen mir verließ, sind zugleich schmerzhafte wie sehr erhellende Erfahrungen.
„Ich spreche hier auch für all jene, die niemand interviewt“
Haben Sie je daran gedacht, wie diese Leute einfach mitzumachen, um sich all das zu ersparen?
Guérot: Ich habe nicht darüber nachgedacht, ob ich mir besser etwas „erspare“. Ich war fassungslos, solch eine autoritäre Schließung der Gesellschaft zu erleben und habe fast impulsiv darauf mit Interviews, Texten und Büchern reagiert. Ich habe an die Meinungsfreiheit hierzulande geglaubt und hielt es für meine Bürgerpflicht, den Mund aufzumachen, zumal ich Politikwissenschaftlerin bin.
Jedenfalls bin ich froh, alles überstanden zu haben, denn es war über Monate seelisch wie psychisch kein Ponyritt. Ich spreche hier übrigens auch für die vielen, denen Ähnliches widerfährt, die aber niemand dazu interviewt: Wir müssen die Meinungsfreiheit wiederherstellen und die kritischen Stimmen, von denen einige sogar inhaftiert worden sind, rehabilitieren. Sonst werden sich Gesellschaft und Demokratie nicht erholen.
Unsere Gesellschaft ist zutiefst gespalten und als politische Konsequenz hat man Brandmauern hochgezogen, durch die rund ein Drittel der Wähler oder Bürger vom politischen Diskurs ausgeschlossen werden. Allerdings habe ich auch Dinge erlebt, die mir Mut machen.
Nämlich?
Guérot: Plötzlich bekam ich für „meine Stimme“ Zuspruch, Briefe, Blumen, Gedichte und alle möglichen Geschenke von Mitbürgern. Wildfremde luden mich zu sich ein, wollten mich bekochen, schickten mir selbstgestrickte Strümpfe, selbstgebackene Kekse, selbstgemachte Leberwurst. Künstler schickten Porträts von mir. Es waren alles selbstgemachte Dinge, das ist wichtig: Jeder wollte mir offenbar etwas von sich selbst geben.
Ich begriff, daß für viele Menschen, die selbst nicht die Möglichkeit haben, sich Gehör zu verschaffen, mein Einspruch eine Art „Wortgabe“ ist. Und daß die selbstgemachten Geschenke eine Art Gegengabe sind: „Danke für deinen öffentlichen Widerspruch – dafür diese Gabe von mir an dich!“ Oft sagten mir sich hilflos fühlende Menschen, meine Worte hätten sie durch die Corona-Zeit getragen. Dadurch wurde mir erst klar, daß meine Bücher nicht nur eine politische, sondern für viele auch eine ganz persönliche Bedeutung hatten.
Ich bin also nach dem Rauswurf bei den normalen Bürgern gelandet, beim „Volk“, wenn Sie so wollen – wo es eine große Wärme gibt, wie ich sie im Establishment nie erlebt habe. Beides wieder in Einklang zu bringen, wäre das Ziel: Wir hatten ja auch mal politische Führungspersönlichkeiten wie Willy Brandt oder Helmut Kohl, die politische Klugheit mit Anstand, Mut, aber auch Jovialität verbanden.
2024 sind Sie in die katholische Kirche eingetreten, die Sie 2004 verlassen hatten. Warum?
Guérot: Nun, Anfang 2024, es war schon ein Jahr nach der Kündigung, als mein Prozeßtermin gleich fünfmal verschoben wurde, die Anwaltsrechnungen sich häuften und mir klar wurde, daß ich als Gebrandmarkte wohl keine beruflichen Perspektive in diesem Land mehr haben würde, hatte ich eine Art Einbruch.
Es war als ob man versucht, aus einem Kanal zu kriechen – doch was man auch tut und macht, immer setzt sich jemand auf den Kanaldeckel, immer werden neue Steine auf diesen gelegt. Zum Beispiel fand ich zeitweilig keinen Anwalt, weil diejenigen, die bereit waren, mich zu vertreten, kein grünes Licht von ihren Kanzleien bekamen: die „umstrittene“ Guérot? Gott bewahre! Das ist schlecht für unsere Kanzlei! Allein dies sollte in einer demokratischen Gesellschaft alle Alarmglocken klingeln lassen.
Schließlich wurde mir klar, daß ich da nicht alleine rauskomme, daß es eine andere Dimension des Ganzen, andere Kräfte und Mächte gibt. Und es vor allem Demut braucht, sich Fügung und Führung zu überlassen, weil man diese Dinge letztlich nicht selbst entscheidet.
Ich hatte schon lange intensiv Yoga gemacht, viel meditiert, ja, sogar indische Aschrams besucht. All das war und ist sehr bereichernd und ohne diese Praxis hätte ich all die Anfeindungen gegen mich in der Corona-Zeit sicher nicht ertragen. Aber es gibt im Yoga keine Anbetung und keine Offenbarung – man kann nicht flehen. Das ist der große Schatz der katholischen Kirche! Was ich dort wiedergefunden habe, hätte ich mir früher – obgleich ich im Rheinland katholisch sozialisiert wurde – nicht einmal vorstellen können!
„In einer echten Republik wird niemand ausgeschlossen“
Sie sagen, Sie waren selbst Teil des Systems: Haben Sie in ähnlichen Fällen vor Ihnen, wie etwa dem Martin Hohmanns 2003 oder Eva Hermans 2007, sich zumindest durch Schweigen mitschuldig gemacht?
Guérot: Die Formulierung „Teil des Systems“ zu sein, ist als solcher Ausdruck des zeitgenössischen Problems der Demokratie. Wir waren einmal eine ungeteilte Republik, mit einem Chor unterschiedlicher politischer Stimmen, aber ohne Ausgrenzung. Jetzt sind wir eine polarisierte Gesellschaft, die ein „Wir“ gegen ein anderes „Wir“ stellt: Eine extremisierte Mitte will die „Demokratie retten“ und zieht dafür eine Brandmauer hoch, die die bundesdeutsche Demokratie zum Einsturz bringen könnte. Wir alle sollten deshalb diesen Ausdruck meiden, sonst reden wir die „Stasis“ – ein Wort des italienischen Philosophen Giorgio Agamben –, also die gesellschaftliche Stockung, oder demnächst gar den Bürgerkrieg, buchstäblich herbei.
Ansonsten kann ich wohl sagen, daß ich mich nie an Ausgrenzung beteiligt habe, es aber früher wohl auch an Solidarität habe fehlen lassen. Die schon sehr frühe Ausgrenzung Eva Hermans etwa ist ebenso an mir vorbeigegangen wie die des Schriftstellers Uwe Tellkamp und anderer. Vielleicht auch, weil ich viel im Ausland gelebt und deutsche Innenpolitik streckenweise nicht intensiv verfolgt habe. Es ist aber etwas dran, daß man gewisse Mißstände erst bemerkt, wenn man selbst betroffen ist.
Kognitiv ist das schwer zu begreifen. Deswegen glauben auch heute viele Bundesbürger nicht, daß es Probleme mit der Meinungsfreiheit gibt, einfach weil sie nicht direkt betroffen sind. Auch deswegen ist es mir wichtig, öffentlich – und stellvertretend für viele andere Betroffene – über meinen Fall zu sprechen, denn jeder kennt ja das geflügelte Wort Martin Niemöllers: „Als sie die Kommunisten holten, habe ich geschwiegen, denn ich war ja kein Kommunist … etc.“
Wehret den Anfängen ist also jetzt! Genau das ist das Problem unserer Demokratie: Die einen wollen den Anfängen wehren mit Blick auf die AfD beziehungsweise die Rechte, die anderen mit Blick auf die „extremisierte Mitte“. Aus dieser „Logik“ müssen wir dringend heraus!
Nämlich wie?
Guérot: Aus meiner Kündigung gibt es eine Lehre und einen gesellschaftlichen Auftrag zu ziehen: In einer Republik wird niemand ausgeschlossen – das muß das neue Credo werden! Ich persönlich habe in den letzten zwei Jahren viele neue Bekanntschaften gemacht und auch mit sogenannten Rechten gesprochen.
Ich habe mich auf viele Personen eingelassen, die schon zuvor, meist grundlos, vom Diskurs und von der Gesellschaft ausgeschlossen worden sind. Erlebt habe ich, wenn man die Mauer im eigenen Kopf erst einmal überspringt, meist engagierte Bürger, die sich Sorgen um die Demokratie machen, eben auf ihre Art – die Ängste und Bedenken artikulieren und diese auch begründen können. Ihnen allen müßte man endlich einmal zuhören, anstatt sie als „populistisch“ zu verdammen.
Letztlich sind wir alle der Populus im Platonschen Sinne. Meist sind sogenannte Rechte sehr anständig und diskussionsbereit. Und das ist es eigentlich, was eine Republik ausmacht: sich zwar politisch bis aufs Messer zu streiten, sich aber dennoch fair und menschlich korrekt zu behandeln.
__________
Prof. Dr. Ulrike Guérot ist designierte Ko-Direktorin des Europazentrums CERC der Universität Bonn. Zuvor leitete sie das Departement für Europapolitik und Demokratieforschung an der Donau-Universität Krems in Österreich. Die 1964 in Grevenbroich geborene Politologin lehrte und arbeitete an diversen Hochschulen und Denkfabriken in Paris, Brüssel, London, Washington, New York und Berlin.
Außerdem publizierte die Bestsellerautorin etliche Bücher, darunter „Wer schweigt, stimmt zu. Über den Zustand unserer Zeit und darüber, wie wir leben wollen“ (2022), „Endspiel Europa. Warum das politische Projekt Europa gescheitert ist und wie wir wieder davon träumen können“ (2022) (Rezension hier) und die erhellende geopolitische Analyse „Ulrike Guérot über Halford J. Mackinders Heartland-Theorie. Der geografische Drehpunkt der Geschichte“ (2024) – und sie betreibt einen eigenen YouTube-Kanal. Am 19. Mai erscheint ihr neuer Band: „Zeitenwende. Zur geistigen Situation der Gegenwart“