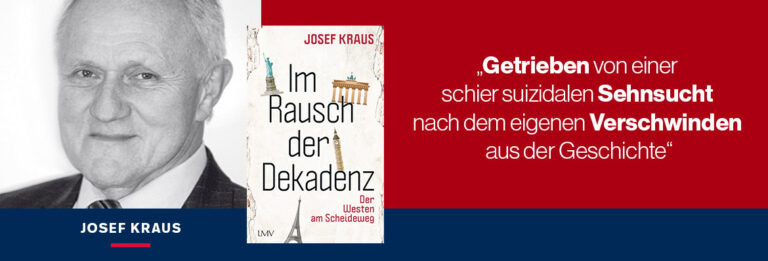Wo ist Preußen? Diese Frage aufzuwerfen, ist längst nicht mehr nur ein Anliegen von Freunden des nach dem Krieg von den Siegermächten aufgelösten Staates. Das Erbe Preußens in seinen mannigfaltigen Ausbildungen geistiger und physischer Art – selbst in seinen Überresten – bewegt auch Skeptiker. Der Grund liegt wohl einerseits in der wirtschaftlich notwendigen Pflege und der Lukrativität des Hinterlassenen. Preußen ist ein Faktor des Tourismus, der vergleichenden Kunstbetrachtung. Es macht in seinen Wirkungen einen beachtlichen Teil der Stellung und des Rufes der deutschen Kultur aus. Preußen hat aber auch andererseits viel an staatlicher Ordnung und bestem bürgerlichen Gemeinschaftssinn in die heutige gesellschaftliche und staatliche Kultur hineingetragen, ohne daß dies je hätte dekretiert werden müssen. Eine Annäherung an Preußen beginnt über die Anerkennung seiner Leistungen, aber auch seiner Widersprüche und Ungleichzeitigkeiten, Ausdrucksformen und Protagonisten. Aber sicher auch über das Verständnis für die machtpolitische Form, die alles zusammenhielt und Preußen erfolgreich machte. Die kulturelle Erbschaft Preußens ist ganz Deutschland zugefallen. Sie ist nationales Erbe. Die frühe Bundesrepublik trug diesem Faktum mit der Verabschiedung eines Gesetzes vom 25. Juli 1957 Rechnung, mit der Gründung der Stiftung Preußischer Kulturbesitz, einer Institution, die vor allem die Pflege und Erhaltung der Kulturgüter des ehemaligen Staates übernehmen sollte. Mit diesem souveränen Akt unterlief sie übrigens faktisch das Auflösungsgesetz der Alliierten, indem sie einmal mehr dem Märchen widersprach, alles Preußische sei reaktionär und militaristisch gewesen. Die Stiftung ging aber weit über das Verwalten hinaus, wofür der Aufbau von 17 Museen und die Pflege des bedeutenden Bibliotheks- und Archivbestandes von Staatsbibliothek und Geheimem Staatsarchiv Zeugnis ablegen. 75 Prozent der Finanzierung der Stiftung übernahm von Beginn an der Bund, der Rest verteilt sich auf alle Bundesländer, die damit zu verstehen geben, daß sie das nationale Erbe Preußens annehmen. Neben dem Bund sind es die Länder Berlin und Brandenburg, die sich nach der Vereinigung für eine gemeinsame Bestandsaufnahme und Zusammenführung des Sammlungsbesitzes bzw. die Pflege des Schlösserbesitzes engagierten. Per Staatsvertrag wurde im Jahre 1994 die Stiftung preußische Schlösser und Gärten ins Leben gerufen, die sich auf die vormals preußische Verwaltung der Staatlichen Schlösser und Gärten zurückführen läßt. Die Stiftung Preußischer Kulturbesitz und die Stiftung preußische Schlösser und Gärten verbürgen gemeinsam mit den in den Bundesländern beheimateten Landes- und Regionalmuseen den physischen Erhalt und die Pflege des Sammlungs- und Baubestandes. Bei soviel institutioneller und staatlicher Fürsorge darf nicht übersehen werden, daß das preußische Vermächtnis – dem kulturpolitischen Auftrag zum Trotz – von der Politischen Klasse weithin in Frage gestellt wird. Zahllose Tugenden wie Verfassungstreue, Pflichtbewußtsein, Opferbereitschaft, Liberalität und Bürgersinn, also die Bereitschaft der Regierenden wie der Regierten zum Dienen, entspringen zwar unmittelbar dem preußischen Geist, stellen jedoch keinen politischen Konsens, geschweige denn eine gesellschaftliche Selbstverständlichkeit dar. Dieser Konflikt zwischen kulturpolitischem Auftrag einerseits und gesellschaftspolitischer Realität andererseits spiegelt sich in exemplarischer Weise in den Diskussionen um die preußische Architektur wider, wie sie im Rahmen der Rekonstruktion des Stadtbildes in Berlin oder Potsdam geführt werden. Trotz institutioneller Fürsorge wird das preußische Vermächtnis von der Politischen Klasse weithin in Frage gestellt. Viele Tugenden entspringen zwar dem preußischen Geist, sind jedoch keine politische, geschweige denn gesellschaftliche Selbstverständlichkeit. An den Diskussionen um das preußische Bauerbe seit Beginn der neunziger Jahre läßt sich wohl am deutlichsten ablesen, wie verschwommen die allgemeine Vorstellung vom Preußischen in der Baukunst vielerorts war und ist. Für die einen mündet die Antike in die „Welthauptstadt Germania“, andere versteigen sich zu der Auffassung, das Ornament an sich sei bereits preußisch (Hotel Adlon). Das oftmals niedrige Niveau der Auseinandersetzungen zwischen linken Kulturpolitikern, Architekturhistorikern und Architekten, teils noch bestimmt von ideologischen Streitigkeiten der achtziger Jahre, zeigt allzu deutlich, daß es längere Zeit dauern wird, um zu erfassen, worum es sich bei der preußischen Hinterlassenschaft eigentlich handelt: um ein verläßliches Gerüst, an dem man die Stadt studieren, Stadträume begreifen und eine weithin vergessene menschliche Haltung ablesen kann. Da die preußische Architektur mittlerweile einen gewissen Schutz genießt und sich Bauwerke auch nicht in Vitrinen einschließen lassen, geht es in den Diskussionen immer auch darum, welche Bedeutung man dem Ort, dem Bauwerk überhaupt zugestehen will. Seine städtebauliche Einbettung in den sich (mitunter gravierend) weiterentwickelnden Stadtraum, die Auf- oder Abwertung durch das Hinzugebaute, die Nutzung, die konzeptionell tragfähige städtebauliche Einbindung – all das sind Fragen, die im Falle der historischen Bausubstanz von vor 1918 stets auch an die Frage rühren, wie Preußen angenommen und bewertet wird. Im Falle des geplanten Wiederaufbaus des Berliner Stadtschlosses, einst Residenz der in Brandenburg und Preußen regierenden Hohenzollern, scheint bald 17 Jahre nach der staatlichen Vereinigung beider Stadthälften und acht Jahre nach dem Regierungsumzug politisch und weitestgehend auch gesellschaftlich Konsens darüber zu bestehen, daß eine weitere Verzögerung des Projektes inopportun ist. Der Beschluß des Deutschen Bundestages vom 4. Juli 2002, der die Rekonstruktion des Stadtschlosses in seinen Fassaden vorsieht, soll nicht mehr in Frage gestellt werden. Mit Nachdruck wird nun der Abriß des Palastes der Republik vorangetrieben, spätestens Ende 2008 soll er abgeschlossen sein. Damit wird auch ein Kapitel DDR-Architekturgeschichte geschlossen und mithin ein Schlußstrich unter die baulichen Verirrungen der Nachkriegszeit an einem städtebaulich wie politisch hochsensiblen Ort gezogen. Im Anschluß an den Palastabriß werden für ein Jahr Archäologen den Baugrund untersuchen können, woran sich nach dem Willen des Bundesbauministeriums etwa 2009/2010 der eigentliche Beginn des Wiederaufbaus anschließen würde. 480 Millionen Euro plant die Bundesregierung für den – äußerst optimistisch – auf nur drei Jahre veranschlagten Wiederaufbau des ehedem größten preußischen Schlosses ein. Die restlichen 80 Millionen Euro, für die Fassaden vorgesehen, sollen aus privaten Spendengeldern zufließen. Der Prozeß der Realisierung des Schlosses zeigt, daß es trotz der jahrzehntelangen Beschäftigung mit Preußen, etwa über die staatlichen Stiftungen, notwendig war, zunächst in kleinen Schritten ein gesamtgesellschaftliches Gespür dafür zu entwickeln, womit man es an dieser Stelle, an diesem preußischen Ort zu tun hat: mit einer Kultur, die die DDR überstanden hat. Und der Prozeß dauert an. Er zeigt aber auch, wie ein preußisches Thema sich als nationales Thema erweisen kann und Menschen in einer Vision zusammenbringt. Das Humboldt-Forum – und mit ihm das Berliner Schloß – wird, das ist schon jetzt absehbar, ein äußerst populärer und positiv besetzter Ort werden. Während man im Falle des Berliner Stadtschlosses eine Abkehr von der alten und heute dogmatisch wirkenden denkmalpflegerischen Haltung beobachten kann, wonach man grundsätzlich Ruinen oder Verschwundenes nicht wiederaufbauen dürfe, stellt sich der Staat andernorts seiner Verantwortung nicht: Preußische Orte jenseits der zum Weltkulturerbe erklärten Museumsinsel schließt die staatliche Fürsorge nicht ein, und es bedarf wohl eines größeren gesellschaftlichen Drucks, dies zu ändern. Insbesondere die westliche Begrenzung der historischen Berliner Innenstadt – die als Regierungsstraße zum Synonym für preußisch-deutsche Macht gewordene Wilhelmstraße – ist nach wie vor nur ein Schatten ihrer selbst. Hier, an diesem düsteren, vernachlässigten Ort, läßt sich noch heute sowohl das katastrophale Ende von 1945 als auch das Verschwinden des noblen, alten Preußen, verkörpert durch das nicht mehr vorhandene Palais, ablesen. Privat angebrachte Hinweisschilder helfen bei der Orientierung, wo meist von der historischen Bebauung nichts mehr steht, wo auch der heutige Staat keine Hinweise mehr zu geben vermag. Die Wilhelmstraße, das zeigte minutiös der Berliner Publizist Laurenz Demps in seiner Monographie „Berlin-Wilhelmstraße. Eine Topographie preußisch-deutscher Macht“ (1994), war und ist keine Straße wie jede andere in Deutschland. Sie ist in unvergleichlicher Weise mit dem Aufstieg und dem Niedergang Preußens und des von ihm begründeten Reiches verbunden. In der Wilhelmstraße waren im 18. Jahrhundert jene Adelspalais errichtet worden, die von der Mitte des 19. Jahrhunderts bis 1945 Regierungsbehörden oder Ministerien beherbergten und die im kollektiven Gedächtnis von Generationen gleichsam gestalthaft für die Souveränität des Staates standen. Hier wurde 1878 der Berliner Kongreß verhandelt, hier, im Palais Radziwill, arbeitete und wohnte Reichskanzler von Bismarck, auf dessen Reichsidee das heutige Staatsgebilde ja indirekt zurückgeht. Nebenan befand sich das spätere Palais des Reichspräsidenten, am Wilhelmplatz gegenüber auch das von Schinkel umgebaute Palais des Prinzen Karl von Preußen. Hier machte allerdings auch Hitler Politik, bis zum 30. April 1945. Wer heute den Ort aufsucht, findet banale Plattenbauten, die die Wende unbeschadet überstehen durften, einen klobigen Versorgungsbau, der einen Supermarkt beherbergt, und überaus häßliche Botschaftsgebäude aus den siebziger Jahren, die die DDR für die Bruderländer Nordkorea und ČSSR am Rande des Platzes errichten ließ, dort wo ehedem das Hotel Kaiserhof stand. Bis auf den Erweiterungsbau des ehemaligen Propagandaministeriums und das Palais der ehemaligen Ritterschaft finden sich heute keine historischen Gebäude mehr am Ort. Der zerstörerischen, antipreußischen DDR-Politik bis 1960 wird von der derzeitigen Politik nichts entgegengestellt. Wie unter einem Tabu entzieht sich jede Regierung – von Kohl über Schröder bis zu Merkel – eines politischen Zeichens. Das muß sich ändern. Das Drama der derzeitigen Vernachlässigung von Wilhelmstraße und Wilhelmplatz wird um so klarer, als im Jahre 2005 eine private Initiative, die Berliner Schadow-Gesellschaft, inmitten des vollkommen unkenntlich gemachten Raumes des Wilhelmplatzes zwei historische Kopien von Marmorstatuen Johann Gottfried Schadows auf Postamenten enthüllen durfte. Nun weist der „Alte Dessauer“ in Richtung eines Plattenbaus. Seit 1990 ist der Zustand, den die DDR im alten preußischen und deutschen Regierungsviertel hinterlassen hat, nicht angetastet worden. Ihrer zerstörerischen, antipreußischen Politik der Tilgung – besonders bis 1960, als letzte Gebäudereste des ehemaligen Reichspräsidentenpalais abgeräumt wurden – wird von der derzeitigen Politik nichts entgegengestellt. Wie unter einem Tabu entzieht sich jede Regierung – von Kohl über Schröder bis zu Merkel – eines politischen Zeichens. Dies sollte und muß sich ändern, um der baulichen Verwahrlosung entgegenzutreten, die in sichtbarem Widerspruch zu den Fortschritten in der Rekonstruktion anderer preußischer Orte steht. Die Kelle zücken für den glücklichen Aufbau des Schlosses, den Fußtritt hingegen für die Wilhelmstraße, dies wirkt zumindest unbedacht. Aber vielleicht drückt sich in dem widersprüchlichen und inkonsequenten Umgang mit dem preußischen Erbe auch die Erkenntnis aus, die der politische Schriftsteller und Kulturhistoriker Arthur Moeller van den Bruck (1876-1925) mit der Vision einer Verschmelzung von Gegensätzlichem zu einer neuen Einheit beschrieb. Er machte dies auch an stilprägenden Personen der preußischen Geschichte fest. In bezug etwa auf den General und Freund Friedrichs II., Wenzeslaus von Knobelsdorff, Baumeister und künstlerischer Schöpfer des antikischen Rokoko in Preußen, bemerkte Moeller in seinem 1916 erschienenen Buch „Der Preußische Stil“: „Wer das Gesetz des Gegensatzes kennt, wer weiß, daß der schöpferische Mensch immer der Mensch seines Widerspruchs ist und den Ausdruck seines Gegenteils zu suchen pflegt, den wird nicht wundern, daß Knobelsdorff keine Kunst der Robustheit schuf, sondern der äußersten, zartesten, feinsten Lyrismen.“ Vor diesem Hintergrund darf man vielleicht hoffen, daß selbst eine Politische Klasse, die eine Kultur des Betons und des Stahlträgers als Ausdrucksform ihres Selbstverständnisses wählt, fähig sein kann, ein Barockschloß und auch nobelsten preußischen Städtebau zu rekonstruieren. Will der Staat Preußen finden – oder vergessen machen? Das bleibt auch nach 16 Jahren Wiedervereinigung unklar. Ein Brückenschlag, der in Anbetracht etwa des kunsthistorischen Erbes in den Stiftungen die selbstbewußt-gelassene Vermittlung einer politischen Nationalkultur preußischer Provenienz beinhaltet, ist noch nicht versucht worden. Der Staat sollte aber endlich dieses Selbstbewußtsein entwickeln und damit einen Beitrag zur politischen Kultur Deutschlands leisten. Dann hielte man wohl auch seine inneren Widersprüche besser aus. Foto: Neue Nationalgalerie in Berlin: Ludwig Mies van der Rohe schuf den Bau in bewußter Anlehnung an das Ideal preußischer Formenstrenge