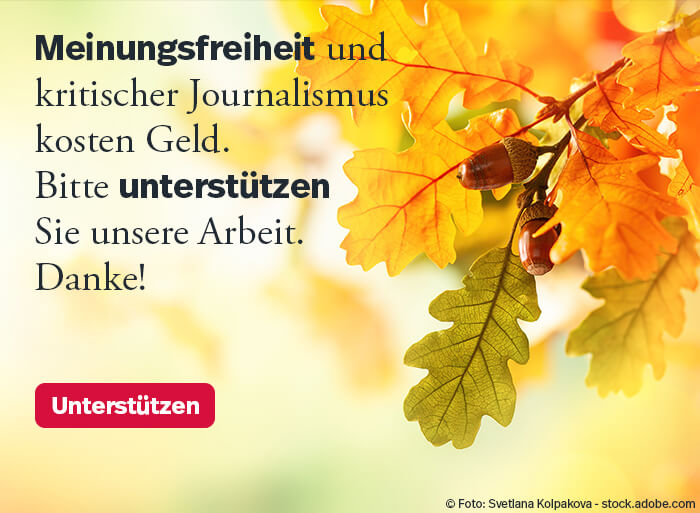Chris Reiter und Will Wilkes stammen aus den USA beziehungsweise England und berichten als Journalisten für Bloomberg News. Beide leben seit vielen Jahren in Deutschland, der eine in Berlin, der andere in Frankfurt am Main, und sind hier familiär gebunden. Beide empfinden Deutschland als ein Land, das im Niedergang befindlich ist. In ihrem gemeinsamen Buch beschreiben sie die Ursachen, Folgen und Erscheinungsformen dieses Niedergangs. Sie blicken auf deutsche Befindlichkeiten, beschreiben nationale Eigenarten, die ihnen aus angelsächsischer Perspektive auffallen, und bemühen sich um eine politisch-psychologische Gesamterklärung.
Dabei scheitern sie gründlich, denn sie überfordern sich mit dem Versuch einer kulturell-historischen Großanalyse: Für die beiden angelsächsischen Journalisten sind die Probleme, mit denen Deutschland konfrontiert ist, „so grundlegend und so tief in den Versäumnissen der Vergangenheit verwurzelt, daß eine tiefgreifende Überarbeitung der Idee von Deutschland selbst erforderlich ist“. Für sie gibt es keine tragfähige Definition von Deutschland, sie halten „es für eine komplexe Mischkultur (…), die sich weiterentwickeln wird“.
Sie übersehen, daß dies für alle modernen Nationen gilt, also gleichermaßen für Großbritannien, Frankreich oder Italien und im besonderen für die USA und Kanada. Den fehlenden Zusammenhalt in Deutschland sehen sie, „seit sich einige kriegerische Stämme, die nicht viel mehr als die Sprache verband, zusammengetan hatten, um vor über 2.000 Jahren in der Schlacht am Teutoburger Wald die mächtige römische Armee zu besiegen.“
Leidet Deutschland an zu viel Abgrenzung?
Und aus ihrer Sicht änderte sich „an dieser germanischen Vielfalt (…) wenig, bis sich vor etwas mehr als 150 Jahren eine Ansammlung von Königreichen, Herzog- und Fürstentümern unter der Oberherrschaft der Preußen vereinigte“. Der Begriff des „Deutschseins“ ist für sie offenbar eine inhaltsleere und, wie sie wiederholt zu erkennen geben, auch gefährliche Fiktion.
Die „angeborene Vielfalt“ wurde aus ihrer Sicht verstärkt, als sich in der „Nachkriegszeit Gastarbeiter niederließen, und sie verstärkte sich nach der Wiedervereinigung“. Die kulturfremde Masseneinwanderung der letzten Jahrzehnte ist für sie also eine begrüßenswerte Fortsetzung der Vielfalt germanischer Stämme zur Zeit von Hermann dem Cherusker. „Die Antwort kann nicht darin bestehen, abzugrenzen, was hineingehört und was nicht. Das wäre das Rezept für eine Niederlage. Stattdessen muß Deutschland Möglichkeiten für Gemeinsamkeiten schaffen und die besten Ideen gedeihen lassen.“
Entsprechend verabscheuen sie den Begriff einer deutschen „Leitkultur“ und kritisieren ihn wiederholt wegen seines aus ihrer Sicht ausschließenden Charakters. Sie machen sich lustig über Friedrich Merz, der den geschmückten Weihnachtsbaum als etwas typisch Deutsches anführte. Sie kritisieren den Verein Deutsche Sprache (VDS) für seine Bemühungen um die deutsche Sprachkultur und ereifern sich besonders über dessen Kampf gegen die sprachlichen Folgen des Genderns. In der Bemühung um die Reinheit der Sprache wittern sie finsteren Nationalismus, der deutschnationalen Irrtümern und letztlich der AfD Vorschub leiste.
Wirkt das Siezen ausgrenzend?
Sie werfen Deutschland eine übertrieben formalisierte und demonstrative Erinnerungskultur an die Greuel des Nationalsozialismus vor und machen gleichwohl den Deutschen immer wieder den Vorwurf, aus den problematischen Teilen ihrer Geschichte nicht die richtige Lehre gezogen zu haben. Diese Lehre besteht aus ihrer Sicht darin, ganz damit aufzuhören, spezifisch deutsch sein zu wollen. Stattdessen solle sich das Land auch innerlich ganz der ethnischen und kulturellen Vielfalt öffnen, die durch Einwanderer von außen zu uns kommt.
Etwas in Widerspruch zu dieser Argumentationslinie beklagen sie, daß es den Deutschen an innerem Zusammenhalt fehle. Der Deutsche neige zu sehr dazu, in „wir“ und „die“ zu denken. Dazu leiste die deutsche Sprache mit ihrer Unterscheidung zwischen „Sie“ und „Du“ einen Beitrag. Das distanzierte „Sie“ wirke tendenziell ausgrenzend.
Auch deshalb seien soziale Beziehungen in Deutschland häufig unbeholfen. Überhaupt sei Deutschland für die Deutschen selber offenbar unattraktiv: „Da also die deutsche Sprache nicht in der Lage ist, Brücken zwischen dem Menschen zu bauen und die Ernährung und die Kultur langweilig ist, bleibt der Fußball einige der wenigen Bastionen, die die Deutschen vereinen.“ Aber anstatt den hohen Anteil ausländischer Spieler „als Bestätigung für das Potential der Diversität“ zu sehen, sei „der Fußball zu einer Petrischale für ethnonationalistische Auffassungen von Identität geworden“.
Die Autoren warnen vor Nationalismus
Mangelhafte Integration von Migranten ist für die Autoren ausschließlich Ausfluß einer unzureichenden Willkommenskultur. Die schlechte Bildungsleistung unterer sozioökonomischer Schichten ist für die Autoren Ausdruck fehlender Chancengleichheit und der Abschottung oberer Gesellschaftsschichten. Kein Wort darüber, daß in Deutschland jeder, der gute Schulleistungen bringt, egal welcher sozialen Schicht er angehört oder woher seine Eltern kommen, zu Abitur und Studium durchmarschieren kann und damit quasi den Marschallstab im Tornister hat.
Da es den Deutschen außer dem gemeinsamen Stolz auf den im Wirtschaftswunder erworbenen Wohlstand an Gemeinsamkeiten mangele, seien viele immer wieder in Versuchung, den fehlenden inneren Zusammenhalt durch Nationalismus zu ersetzen. Der auf vielen Gebieten zu beobachtende deutsche Niedergang und die Reformunwilligkeit und Unbeweglichkeit des politischen Systems gefährdeten aber den Wohlstand und weckten bei breiten Schichten Abstiegsängste.
Die Vorschläge sind naiv
So erkläre sich der besorgniserregende Aufstieg der AfD. Es bestehe die Gefahr, daß die Deutschen als Antwort auf krisenhafte Entwicklungen erneut in Nationalismus flüchteten. Deshalb müsse man für mehr Zusammenhalt sorgen und die wirtschaftlichen Schwierigkeiten überwinden, um der AfD auf diese Art das Wasser abzugraben. Dazu machen sie Vorschläge, die in ihrer Naivität rührend, aber weitgehend unbrauchbar sind.
Man tritt den beiden Autoren nicht zu nahe, wenn man ihnen eine tiefverwurzelte linksliberale Grundeinstellung unterstellt, die in zentralen Fragen ihren Blick auf die deutsche Wirklichkeit vernebelt. Das ist schade, denn zu den konkreten Defiziten und Fehlentwicklungen in Deutschland wissen sie nämlich durchaus aus journalistischer Sicht Interessantes und Erhellendes zu berichten. Das wird aber durch den verfehlten Gesamtkontext entwertet.
——————————————————————————–
Dr. Thilo Sarrazin ist Publizist und war SPD-Finanzsenator in Berlin. Zuletzt veröffentlichte er das Buch „Deutschland schafft sich ab. Die Bilanz nach 15 Jahren“ (München 2025).