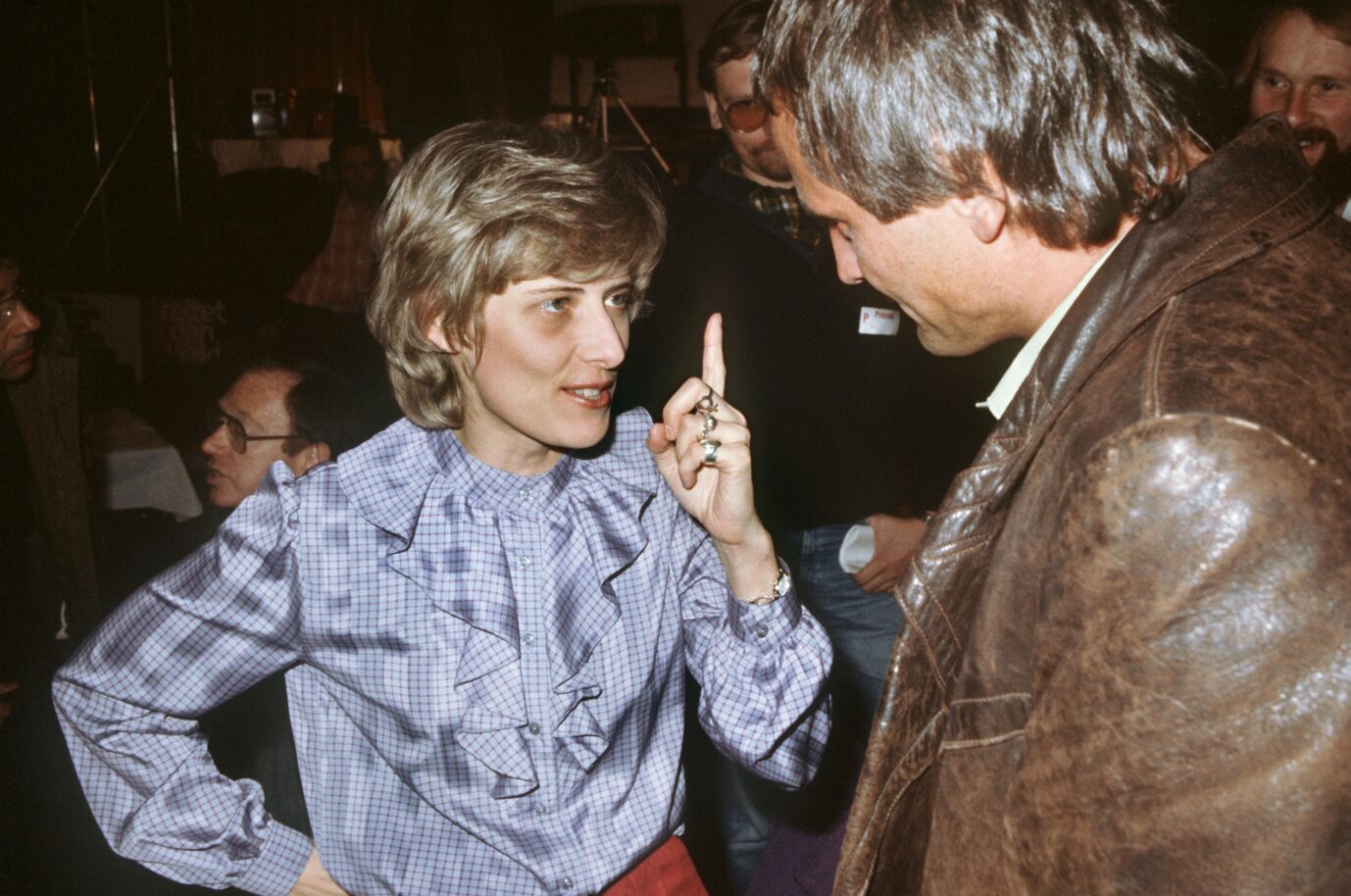Ziemlich weit aus dem Fenster hat sich Wolfgang Hetzer, Doktor der Rechts- und Staatswissenschaft und seit 2002 Leiter der Abteilung „Intelligence: Strategic Assessment & Analysis“ im Europäischen Amt für Betrugsbekämpfung (OLAF) in Brüssel, mit seinem gerade veröffentlichten Buch „Finanzmafia. Wie Banker und Banditen unsere Demokratie gefährden“ (Frankfurt/Main 2011) gelehnt.
Das Anliegen des Buches beschreibt Martin Schulz, Vorsitzender der Sozialdemokratischen Fraktion im Europäischen Parlament, wie folgt: Hetzer gehe der Frage nach, „ob die internationalen Finanzmärkte zum Tummelplatz einer besonderen Art der Organisierten Kriminalität geworden sind, die es in einem Milieu höchster krimineller Energie, exquisiter fachlicher Qualifikation und korruptiver Verflechtung geschafft hat, die Zusammenhänge zwischen Arbeit, Leistung und Erfolg … in einer jahrelangen hemmungslosen und selbstsüchtigen Bereicherungsorgie zu zerstören“. Hetzer hat seine Auffassungen in einem Interview mit Welt-Online vor kurzem nochmals bekräftigt, als er erklärte: „Die Finanzwelt folgt der Logik der Mafia, nämlich der Orientierung am höchstmöglichen Gewinn bei minimiertem Risiko.“ Er ortet deshalb eine regelrechte „Kultur des Betrugs“.
Käuflichkeit prägt das Gemeinwesen
Wohl nur noch rhetorisch ist vor diesem Hintergrund die Frage Hetzers zu verstehen, ob Korruption nicht geradezu zur „Leitkultur“ geworden sei. Seiner Ansicht nach kreuzten sich immer häufiger die „Gewinnabsichten von Wirtschaftssubjekten, die Ambitionen von Politikern, die Finanzierungsbedürfnisse von Parteien und die Geldgier von Amtsträgern“. Dem sei mit dem geltenden Strafrecht nur bedingt beizukommen. Unmißverständlich konstatiert Hetzer: „Wenn Käuflichkeit den inneren Charakter eines Gemeinwesens prägt, degeneriert Rechtsgehorsam ohnehin zur lächerlichen Attitüde.“
Den Ausbruch der Finanzkrise im Sommer 2007 ist aus der Sicht Hetzers das Ergebnis einer jahrelangen Entwicklung. Der Politik wirft er vor, nicht begriffen zu haben, was in diesem Jahr passiert sei. Es handelte sich keineswegs um ein Geschehen, daß sich einer Steuerung entzogen habe. Eine „geschickte Medienpolitik“ konnte die Verantwortlichkeiten aber vertuschen. Die Entscheidungsträger in Wirtschaft und Politik hätten „in einer Mischung aus Ambition und Inkompetenz selbst die Bedingungen geschaffen, unter denen sich die internationale Finanzwirtschaft in ein Schlachtfeld verwandeln konnte“. Und: „Keine Naturgewalt hat diese Finanzkrise ausgelöst, sondern beschämendes Versagen in den Vorstandsetagen.“ Die Krise sei deshalb auch nicht beendet, sondern habe nur eine „Pause eingelegt“.
„Heuschrecken“ den „Luftraum“ geöffnet
Daß auch deutsche Politiker ihr Scherflein dazu beigetragen haben, die Finanzwirtschaft in ein „Schlachtfeld“ zu verwandeln, zeige zum Beispiel das Investmentmodernisierungsgesetz (2004), das den „Heuschrecken“ den „Luftraum“ über Deutschland geöffnet habe. Vor allem der „rot-grünen“ Bundesregierung lastet Hetzer an, die Auflösung der „Deutschland AG“ betrieben zu haben. Rot-Grün habe „die Tatgelegenheiten für Wirtschaftskriminelle größten Kalibers vervielfältigt und erweitert“.
Sie schuf die „legalen Grundlagen dafür, daß auch Deutschland wenige Jahre später in den Mahlstrom des internationalen Finanzkapitalismus geriet“.
Für sein ureigenstes Feld, die Rechtsprechung, konstatiert Hetzer, daß es keinen Straftatbestand der „Kapitalvernichtung“ gebe. Die Teilnahme an Systemkriminalität sei, so Hetzer zugespitzt, offenbar ohne Strafbarkeitsrisiko. Das Zusammenspiel von ökonomischen Interessen und politischen Ambitionen lägen bisher außerhalb der Reichweite strafrechtlicher Normen.
Verantwortliche beim Namen genannt
Es bleibt zu bedauern, daß man Hetzers Angriff auf die internationale Finanzwirtschaft häufig anmerkt, daß er kein Ökonom ist. Auch beim logischen Aufbau des Buches sind Defizite zu konstatieren. Das wird es den Angegriffenen erleichtern, seine Analysen, denen manchmal die Tiefenschärfe fehlt, zu ignorieren oder als Ausdruck populistischer Ressentiments gegen die Finanzwelt, deren Komplexität viele nicht überblickten, abzukanzeln.
Dessenungeachtet bleibt dieses Buch, gerade auch aufgrund des juristischen Blicks auf jene Machenschaften, die die Finanzkrise auslösten, eine faktenreiche Untersuchung, in der Klartext geredet wird und Verantwortliche beim Namen genannt werden. Allerdings wird auch dem geneigten Leser, das sei nicht verschwiegen, einiges zumutet.