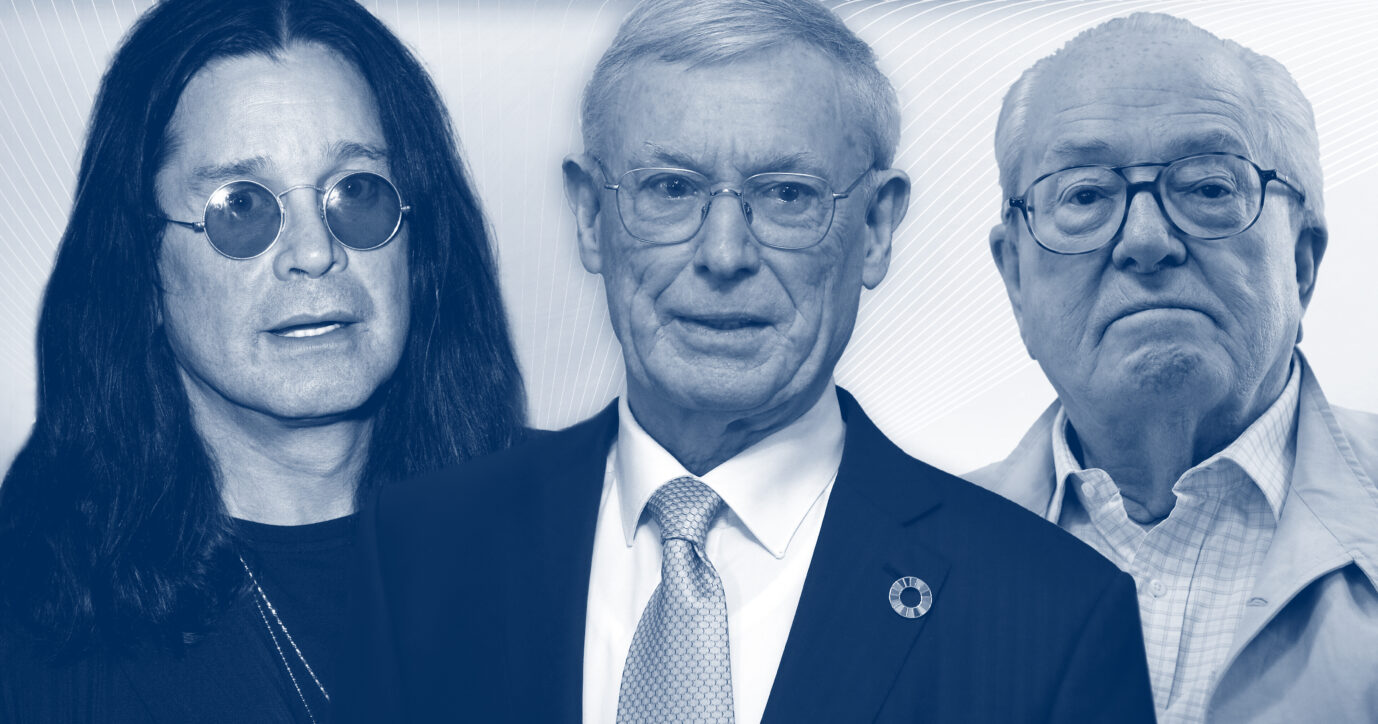Die Kulturstaatsministerin möchte der Stiftung Preußischer Kulturbesitz (SPK) das „Preußische“ nehmen. Sie nennt Argumente. Überzeugend sind sie nicht. Denn, was Claudia Roth zur Bürokratielast der SPK vorträgt, über das reiche Erbe des anderen, nichtpreußischen Deutschlands und die Notwendigkeit, in die Zukunft, nicht auf die Vergangenheit und mithin die „Vielfältigkeit“ zu blicken, die da kommt, – das alles soll nur verschleiern, worum es tatsächlich geht. Worum es auch schon bei ihrem Vorstoß gegen die Inschrift an der Kuppel des Berliner Schlosses oder bei dem Bildersturm ihrer Parteifreundin und Kabinettskollegin Annalena Baerbock ging, die das Bismarck-Zimmer des Auswärtigen Amtes umbenannt und umdekoriert hat.
Gemeint ist die Bereitschaft, jenen Affekt zur Wirkung zu bringen, den Claudia Roth mit ihrer Generation teilt und den die Tonangeber seit Jahrzehnten an die Jüngeren weitergegeben haben. Wobei die Polemik gegen Pflichtgefühl und den Choral von Leuthen, gegen Sekundärtugenden und Kadavergehorsam, gegen Heinrich Manns „Untertan“ und die braune Indienstnahme des preußischen Erbes nicht davon ablenken sollte, daß man auf Grundsätzliches zielt: das Preußische Prinzip, jene Überzeugung von der Notwendigkeit staatlichen In-Form-Seins, das dieser Republik so fremd ist wie kaum etwas anderes.
Antipreußischer Affekt entfaltet Wirkung
Daran hat auch der Ausruf der „Zeitenwende“ nichts geändert. Vielmehr entfaltet der antipreußische Affekt erst jetzt seine volle Wirkung. Denn es gibt keine hemmenden Kräfte mehr und keine Reserven, die man im entscheidenden, also im Ernstfall nutzen kann. Einer, der diese Entwicklung und ihre fatalen Folgen früh abgesehen hat, war der Literaturwissenschaftler Karl Heinz Bohrer. Achtundsechziger und Ernst Jünger-Exeget, Jakobiner-Versteher und lieber in Paris oder London als in der Heimat, wo es kein „Spree-Athen“ mehr gab.
In seinen Kommentaren zum Zeitgeschehen konnte Bohrer mit unerwarteter Tendenz und ungeheurer Verachtung über die „winselnde Harmlosigkeit“ der Bundesdeutschen sprechen, über ihr „Nachkriegs-Gartenzwerg-Bewußtsein“, passend zu einem Volk von Krämerseelen; „so übersättigt, verängstigt, eingekauft ist diese westdeutsche Händlernation, daß sie nur andere für sich kämpfen lassen könnte oder es bräche eine Massenhysterie aus: die Staatskrise. Da sie das nicht offen zugeben kann, tabuisiert sie den Kampf überhaupt oder rationalisiert sie ihre Angst davor mit pragmatischer Vernunft, das heißt mit wirtschaftlichen Zwängen“.
Womit Bohrer Bezug auf ein anderes Tabu nahm: die „Ideen von 1914“ und Max Schelers Typologie der „Händler“ und „Helden“. Aber vor allem wollte er klarstellen, daß mit dem „Ethos der Mainzelmännchen“ kein Staat zu machen ist, weil jede staatliche Existenz ein Maß an Härte und Einsicht in die Notwendigkeit von Härte voraussetzt, das diesem Ethos fremd ist und bleiben muß.
„Koalition des Fortschritts“ im Kulturkrieg
Bohrer litt am Untergang Preußens. Aber es war ein anderes Leiden als das der übriggebliebenen „Potsdamdeutschen“ (Barbro Eberan), die nach 1945 die Ehre Preußens verteidigten, den Verlust Ostdeutschlands betrauerten und die eine oder andere Nostalgie pflegten. Bohrer dachte nicht an eine Restauration, sondern wollte Lehren der Geschichte wieder Geltung verschaffen, die zuerst in der „Rheinbundrepublik“ (Walther Rathenau / Rudolf Augstein) und dann im Traumland des „Posthistoire“ systematisch verdrängt worden waren. Die zu beherzigen wird man von unserer politischen Führung erst recht nicht erwarten dürfen. Denn in ihren Reihen nehmen Männer und Frauen Einfluß, die weder Weite des Horizonts noch Respekt vor der Überlieferung besitzen, denen es an Takt ebenso fehlt wie an einer realistischen Einschätzung ihres eigenen – minderen – Ranges.
Man sollte die Ankündigung Claudia Roths darum im Kontext des Kulturkrieges verstehen, mit dem die „Koalition des Fortschritts“ das Land überzieht und dessen Ziel es ist, einen Endsieg zu erringen. Das heißt, wir haben es nicht mit üblicher linker Symbolpolitik zu tun, die „mit moralischem Furor Geschichtsreinigung“ (Wolfgang Thierse) betreibt. Es geht vielmehr darum, ein strategisches Ziel zu erreichen: das Land so zu verändern, daß es nicht mehr wiederzuerkennen ist, ein Volk in eine Masse von Entwurzelten zu verwandeln und jede Erinnerung an die Größe seiner Vergangenheit auszutilgen.
Viel Grund zur Hoffnung, diesen Feldzug scheitern zu sehen, gibt es nicht. Nur einen vielleicht: die Hast der Verantwortlichen. Die könnte ein Hinweis auf die Sorge sein, es möchte jemand wie Friedrich, von feindlicher Übermacht eingeschlossen, die letzten Mannschaften im Lager von Bunzelwitz verschanzen und von dort den Widerstand organisieren.