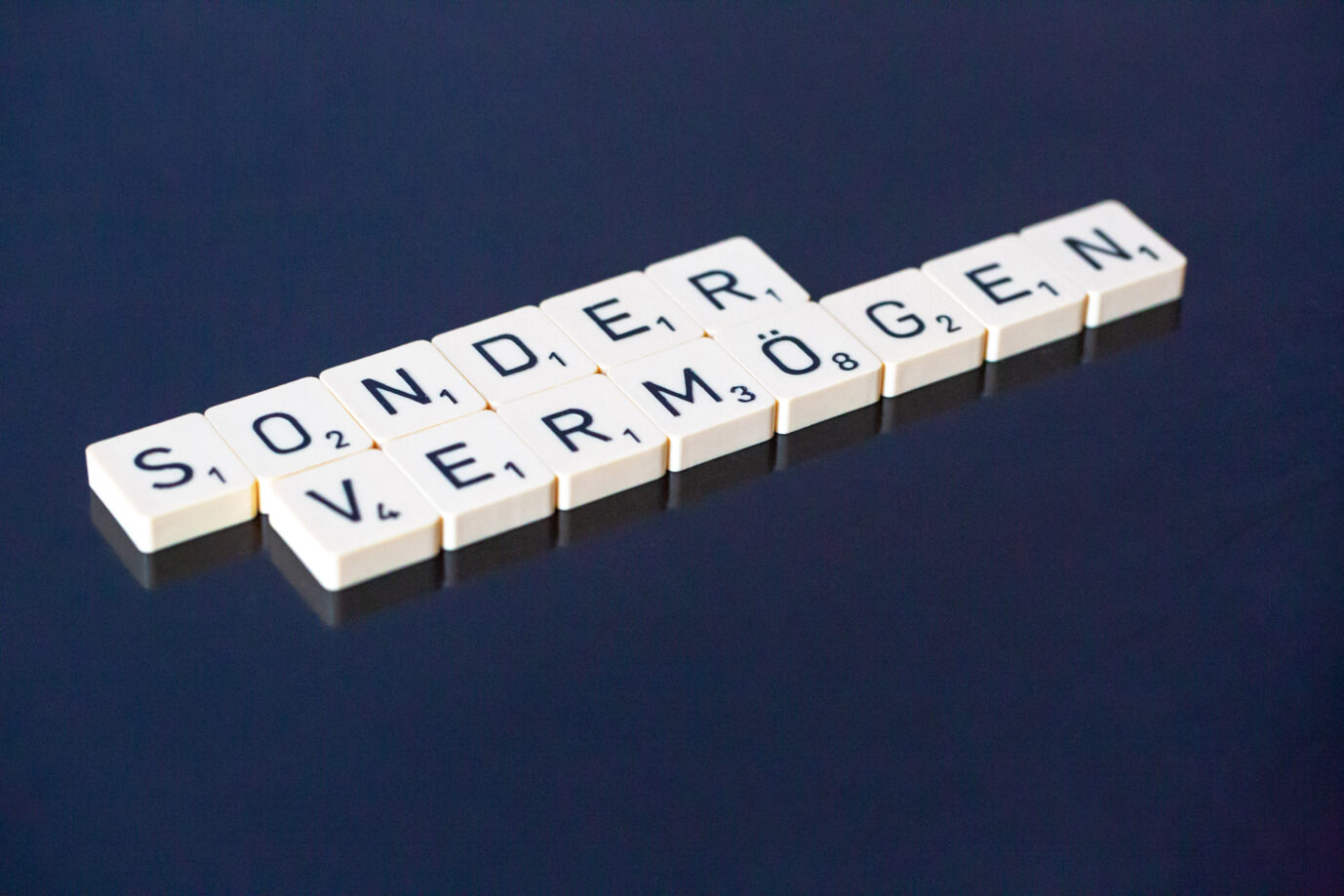Deutschland geht neuen Zeiten entgegen: Seit Mittwoch ist die Ampel-Regierung im Amt. Auch für die Unionsparteien bedeutet das einen Umbruch: 16 lange Merkel-Jahre haben die Christdemokraten abgenutzt, entkernt, jeglicher Inhalte entkleidet. Die Opposition kann da nur guttun. In der neuen Rolle können CDU und CSU wieder zu sich selbst finden, ihre Wurzeln neu entdecken, das konservative Profil schärfen.
So zumindest lautet die Erzählung derer, die die einstmals christlichen Parteien immer noch nicht abschreiben wollen und können. Weil sie selbst politisch heimatlos geworden sind und irgendwo im Nirgendwo zwischen der Beliebigkeit der C-Parteien und der teils radikalen Tonlage der AfD wieder abgeholt zu werden hoffen. Einzig und allein: Diese Hoffnung ist hoffnungslos.
Das wurde auch am Mittwoch wieder deutlich. Am Abend nach der Kanzlerwahl im Bundestag lud Sandra Maischberger Friedrich Merz zu sich ein, den „Hoffnungsträger der Konservativen“ in der Union also. Er sollte mit Kevin Kühnert „diskutieren“, wie die Redaktion im Vorfeld angekündigt hatte. Eine knappe halbe Stunde wurde es am Ende, allerdings ohne Diskussion.
Keine Kritik, nur Abwarten
Denn wer nun erwartet hatte, daß Merz den Tag der Amtseinführung der rot-grün-gelben Koalition nutzen würde, um gegen deren Umbauprogramm und die „progressive“ Agenda zu ledern und sich am – freilich inzwischen auch gezähmten – Juso Kühnert zu reiben, sah sich enttäuscht. Kaum eine explizite Kritik kam Merz über die Lippen. Ohne Kontur saß er da: Kein Programm, keine Ideen, wenig Abgrenzung. Stattdessen nur Worte des Abwartens: Von „wir werden sehen, was dabei herauskommt“ bis „das wird man sehen“.
Nach mehreren Runden dieser Phraseologie fragte die Moderatorin, offenbar selbst etwas überrascht, nach: „Auch da geben Sie also quasi erstmal denen einen Vorschuß?“ Merz: „Eine Regierung hat doch auch mal zunächst einen Vertrauensvorschuß verdient. Deswegen fang ich doch heute nicht an, lautstark über diese Regierung zu lamentieren.“
Die Themen lägen eigentlich auf dem Tisch
Erst als Maischberger ihrem Interviewgast Kritik an der Ampel geradezu in den Mund legte, als sie mit Blick auf den Eiertanz ums Infektionsschutzgesetz fragte: „Halten Sie das für einen Ausweis dafür, daß da jemand die Realitäten zu spät anerkennt?“ wagte der ein kritisches Wort: „Also ein richtig gut gelungener Start war das mit diesem Thema nicht.“ Das war’s aber auch schon.
Der Umbau der Familien, die liberale Migrationspolitik samt Spurwechsel für Asylbewerber, die Liberalisierung von Abtreibungen, die radikale Klimatransformation: Es liegen genug Themen auf dem Tisch, die Merz hätte aufgreifen und thematisieren können. Doch nichts dergleichen kam.
Merz geht auf das Establishment zu
Zwar befindet sich Merz zur Zeit noch im Kampf um die Gunst der Mitglieder bei der Wahl zum Parteichef. Klare Kante und deutliche Worte, wie man sie von seinen Auftritten in den Kreisverbänden des Landes kennt, würden da gut ankommen. Doch andererseits wird er angesichts der noch liberaleren Konkurrenz darauf setzen, den konservativen Flügel der Basis sowieso schon auf seiner Seite zu haben.
Und so geht Merz bereits auf das „Establishment“ (O-Ton Merz) an der Parteispitze zu, bevor die Wahl überhaupt gelaufen ist. Dieses Establishment aber will den unter Merkel eingeschlagenen Linkskurs fortsetzen, klare, wenn auch natürlich ebenso opportunistische Warnungen wie die von Fraktionschef Ralph Brinkhaus vor der „strammsten Linksagend“ werden dort nur verstört zur Kenntnis genommen.
Auch wenn die CDU auf der Trias vom Christlich-Sozialem, Liberalem und Konservativem noch formelhaft beharrt: In ihrem Innersten sieht sie sich nicht mehr als konservative Partei. Sie will die zur SPD und den Grünen abgewanderten Wähler zurückholen. Die Bürger, die sich aus Überzeugung oder Verzweiflung bei der AfD sammeln, sind ihr egal. Diese sollten daher auch in den kommenden Jahren nicht allzu viel von den C-Parteien erwarten – auch nicht unter Friedrich Merz.