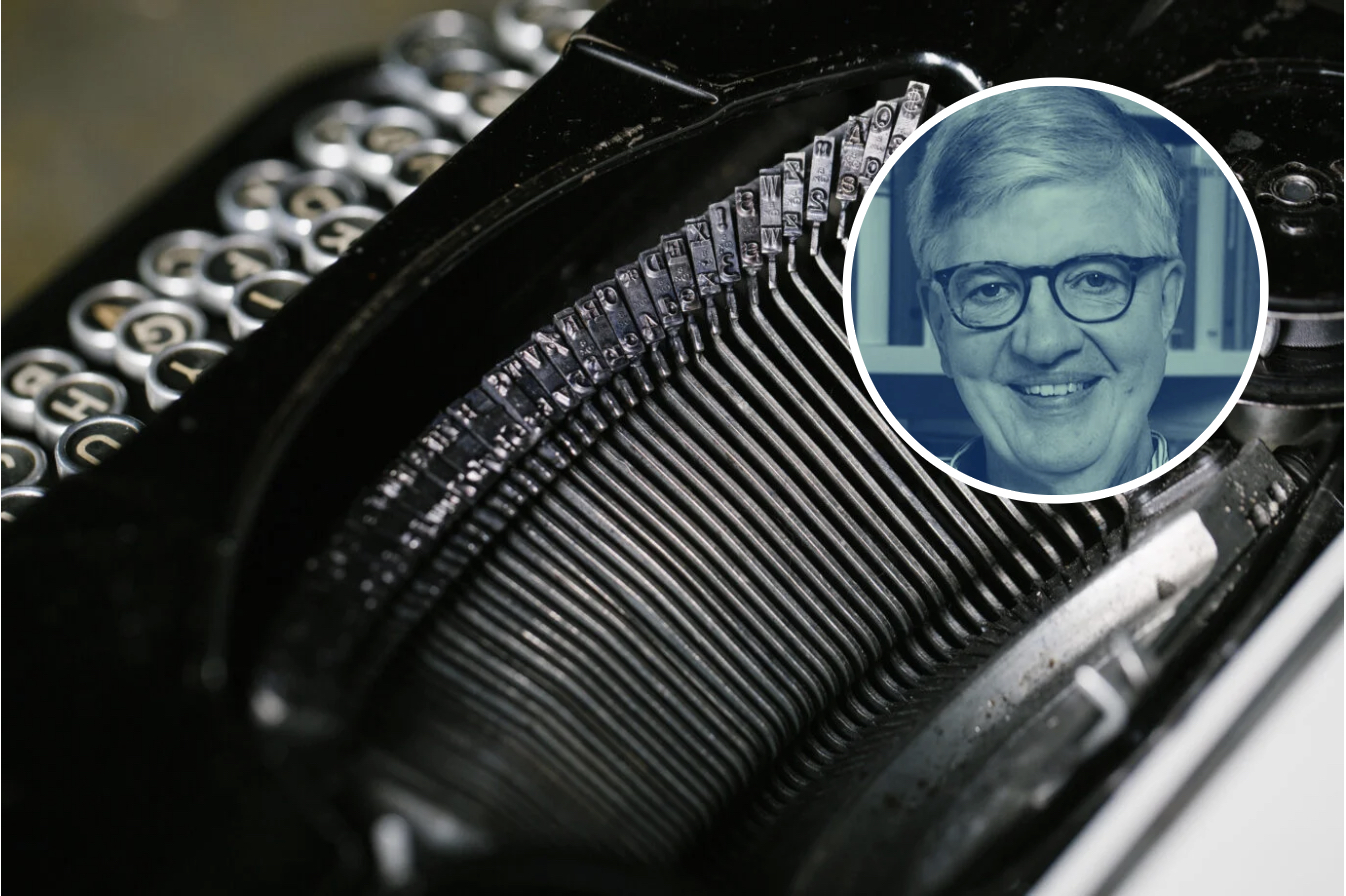Wenn von Politikern Texte veröffentlicht werden, ist nie ganz klar, wer sie geschrieben hat. Wahrscheinlich nicht sie selbst, sondern ein Profi, der dafür angestellt und bezahlt wird. Das darf man auch im Fall des Beitrags vermuten, den die Frankfurter Allgemeine Zeitung in der vergangenen Woche unter dem Namen des Bundestagspräsidenten Norbert Lammert abdruckte.
Nicht daß bezweifelt würde, daß das, was da steht, die Überzeugung Lammerts wiedergibt, aber viele Indizien sprechen gegen eine gründliche Auseinandersetzung mit der einschlägigen Literatur und für den Zettelkasten eines Redenschreibers. Ein Hinweis ist der Mix aus aktuellen Bezugnahmen und grundsätzlichen Erwägungen.
Konzentrieren wir uns auf das Grundsätzliche. Dazu gehört zuerst einmal die Behauptung, daß der Staat keine konkrete Größe ist – klassischerweise definiert über Staatsvolk, Staatsterritorium, Staatsgewalt –, sondern auf formalen Regeln und „gemeinsamen Bekenntnissen“ beruht.
Diese „gemeinsamen Bekenntnisse“ beziehen sich auch nicht auf irgend etwas Konkretes, sondern auf das, was man gemeinhin die „westlichen Werte“ nennt; bei Lammert geht es um die „Verfassung der Freiheit“. In der Konsequenz hält Lammert die Rede vom Volk, gar von „Volkssouveränität“, für eine Fiktion. Was das Volk im Sinne des Grundgesetzes sei, stehe jederzeit zur Disposition und könne demgemäß auch jederzeit umdefiniert werden.
Das Volk hat seine Schuldigkeit getan
Bei wohlwollender Deutung könnte man sagen, daß Lammert meint, die bestehende Ordnung rechtfertige sich durch ihr Funktionieren. Das Volk hat seine Schuldigkeit als „pouvoir constituant“ getan, als jene Größe nämlich, die die Verfassung schuf und dann beiseite trat, um den politischen Profis das Feld zu überlassen und Ruhe zu geben.
Diese Argumentation ist an sich nicht neu, hat allerdings im deutschen Fall schon den Schönheitsfehler, daß hier das Volk nach dem Zweiten Weltkrieg niemals über seine Verfassung abgestimmt hat, auch dann nicht, als das in Folge der Wiedervereinigung zwingend geboten schien (Artikel 146 GG, ursprüngliche Fassung).
Aber sehen wir von solchen Kleinigkeiten ab: Denn ein größeres Problem liegt darin, daß, wenn dem Volk schon zugestanden wird, daß es die Verfassung „konstituiert“, ein Volk da sein muß, bevor die Verfassung in Kraft tritt. Das heißt, es muß ein Ganzes bestehen, das als handelnde Einheit auftreten kann, weil sich die Zugehörigen als zugehörig erkennen.
Die Kriterien für die Zugehörigkeit mögen schwanken, aber die Gesinnung, die „gemeinsamen Bekenntnisse“, von denen Lammert spricht, sind kaum ausschlaggebend. Anders dagegen dieselbe Sprache, dasselbe Herkommen, dieselbe historische Erfahrung.
„Multikulturalität“ und Rechtspositivismus
Von alldem findet sich bei Lammert nichts. Kann sich nichts finden, weil er die faktische „Multikulturalität“ anerkennt und Demokratie nicht mehr als Volksherrschaft begreifen will, sondern als Ordnungsrahmen für „konkurrierende Interessen und Ideen, die in einem Wettstreit nach Mehrheiten streben“. Woher dieser Formalismus stammt, ist unschwer zu erkennen an dem Hinweis auf Hans Kelsen in Lammerts Text.
Kelsen war der bedeutendste Vertreter des Rechtspositivismus im 20. Jahrhundert. Sehr verkürzt könnte man sagen, daß sich für den Rechtspositivismus die Geltung des Rechts aus seinem faktischen Vorhandensein ergibt. Diese inhaltliche Leere ist unschwer als Problem zu erkennen, auch wenn man sie mit irgendwelchen Werten zu füllen sucht. Ein Schwachpunkt, auf den Kelsens Kontrahent Carl Schmitt immer wieder hingewiesen hat.
„Völkisch-autoritäre Revision von innen“
Der kommt bei Lammert nicht vor, aber bei Claus Leggewie, dessen Text den des Bundestagspräsidenten in der FAZ flankierte. Von Lammerts Bemühen um eine gewisse Sachlichkeit ist bei Leggewie nichts zu spüren. Bei ihm geht es gleich mit „Faschismus“ los. Dessen Fratze zeige sich heute in dreierlei Gestalt: „dschihadistischer Terror“, „Cyberwar“ und „völkisch-autoritäre Revision von innen“. Dem ersten Angreifer wird etwas, dem zweiten kaum, dem dritten besondere Aufmerksamkeit zuteil.
Das erklärt sich daraus, daß der Politikwissenschaftler Leggewie sehr genau weiß, welche Dynamik im Appell an „das Volk“ liegt, wie deutlich die von Schmitt analysierten Bruchlinien zwischen demokratischem und parlamentarischem Prinzip hervortreten, wenn eine politische Ordnung unter Druck gerät und sich nicht die übliche Frage nach der Legalität – der Gesetzmäßigkeit –, sondern die nach der Legitimität – der Rechtmäßigkeit – stellt.
Was, wenn die „Populisten“ die Mehrheit überzeugen?
Dieses Wissen hat bei Leggewie aber nicht nur mit Kenntnis der theoretischen Staatsrechtslehre zu tun, sondern auch mit persönlicher Erfahrung. Die „offene Gesellschaft“ war nicht seine erste politische Liebe. Die keimte und wuchs nur Stück für Stück, nachdem der Altachtundsechziger sich zu etablieren wußte und Aufnahme fand in jene Kreise, die er früher als Establishment verachtete. Aber die Erinnerung an „damals“ hat das nicht ausgelöscht.
Das heißt, Leggewie erinnert noch sehr genau, wie mächtig das Prinzip der „militant democracy“ wirken kann, wenn eine hinreichend entschlossene Gruppe mit einer gewissen Aussicht auf Erfolg den Herrschenden vorhält, die verfassungsmäßige Ordnung beseitigen zu wollen, indem sie den Volkswillen übergeht. Gar nicht zu reden davon, was geschehen kann, wenn die Populisten von heute anders als die von damals tatsächlich einen erheblichen Teil des realexistierenden deutschen Volkes auf ihre Seite bringen könnten.
JF 03/17