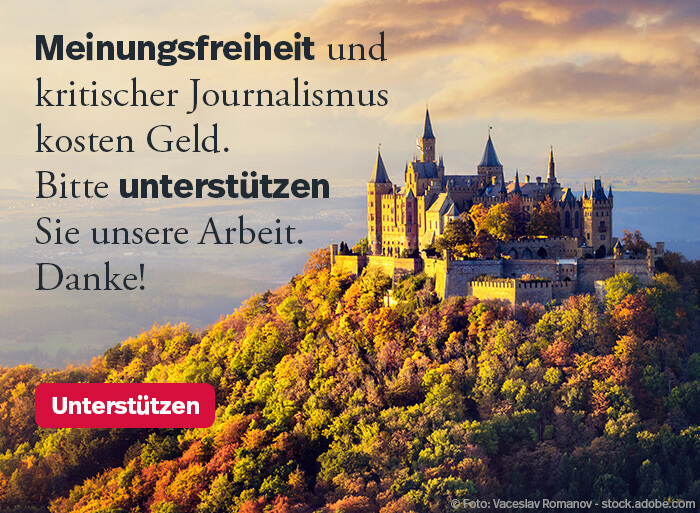Man weiß nicht genau, ob er in der Weihnachtszeit oder kurz danach geboren wurde, aber es würde passen. Mit einer Beflissenheit, die in seiner Epoche ihresgleichen sucht, spürte Thomas von Aquin dem Geheimnis des Mensch gewordenen Gottes nach und bemühte sich, das Wesen des Allmächtigen durch die Zuhilfenahme von allem, was ihm neben dem biblischen Zeugnis an philosophischer Erkenntnis und Gelehrtenweisheit zur Verfügung stand, zu ergründen, mehr noch: das, was sich seinem kolossalen Erkenntnisvermögen erschloß, zu einem stimmigen System, einem theologischen Erklärkompendium zu verweben.
„Summa theologiae“ hieß das prominente Ergebnis dieser Bemühungen, sein Opus magnum und die gewichtigste einer Vielzahl von Schriften, die einen Eindruck davon vermitteln, mit welcher Akribie und gedanklicher Tiefe der Gottesmann in die Glaubensmaterie eintauchte, die sein Leben von Anfang an begleitete und bestimmte.
Mystisch angezogen von der Lehre Jesu
Denn schon früh war der 1323 Heiliggesprochene, der irgendwann zwischen Ende 1224 und Anfang 1225 auf der Burg von Roccasecca das Licht der Welt erblickte, auf fast schon mystische Weise angezogen von den Inhalten der christlichen Lehre. Er entstammte dem Landadel der Grafschaft Aquino, gelegen zwischen Rom und Neapel. Seine Eltern Landulf und Theodora von Aquino hatten neun Kinder. Sein Bio-, besser: Hagiograph, Wilhelm von Tocco, berichtet von einer der Engelserscheinung Marias, der Mutter Jesu, nicht unähnlichen Verheißung eines Eremiten an Theodora, sie werde einen Heiligen zur Welt bringen.
Eine Schenkungsurkunde vom Mai 1231 läßt darauf schließen, daß der jüngste Sohn von Landulf und Theodora von seinem Vater bei den Benediktinern der Abtei Montecassino in die Schule geschickt wurde. Die Benediktinerregel ora et labora („bete und arbeite“), Kontemplation, Demut und Schlichtheit werden für das Kind zum prägenden Ideal. Die Folgen sind seinen Eltern schon bald nicht mehr geheuer. Die Wurzel für einen großen Konflikt im Leben des Theologen war damit eingepflanzt, der ausbrach, als er sich mit großer Entschlossenheit von den elterlichen Direktiven emanzipierte.
Thomas wird entführt
Da das Kloster von Montecassino zwischen den Fronten des Konflikts zwischen Papst und Kaiser steht, setzt der Schüler im zarten Alter von 15 Jahren seine Ausbildung mit einem Studium der freien Künste und der Philosophie an der Universität Neapel fort. Er entdeckt Aristoteles und damit eine der Grundlagen für seine späteren theologischen Erörterungen.
In Neapel kommt es zur Begegnung mit dem Bettelorden der Dominikaner, in den er 1244 aufgenommen wird, eine Karriereentscheidung, die bei seinen Eltern auf Unverständnis stößt. Es ist der Auftakt zu einem dramatischen Dissens, der nicht ohne erhebliche seelische Blessuren auf beiden Seiten bleibt. Auf dem Weg von Neapel nach Bologna, wohin der 19jährige dem Generaloberen der Dominikaner, Johannes von Wildeshausen, folgt, entführen zwei seiner großen Brüder ihn auf Geheiß der Mutter und verschleppen ihn nach Monte San Giovanni, wo die Familie ein Besitztum hat.
Thomas wird in eine Kammer gesperrt. Seine Brüder führen ihm eine aufreizend gekleidete Schönheit zu, um ihn seinem Gelübde abspenstig zu machen – ohne Erfolg. Die Versuchung mündet in die Bitte des Versuchten, Gott möge ihn mit ewiger Jungfräulichkeit gürten. Tocco weiß von Engeln zu berichten, die dem in die Enge Getriebenen den Beistand Gottes zusichern.
Albertus Magnus ist sein Lehrer
Die Gefangenschaft in Monte San Giovanni, die nach einem Jahr endet, ist der entscheidende Wendepunkt in der Biographie des Mannes aus Aquino. Die Würfel sind gefallen zugunsten eines Gott geweihten Lebens. Nicht nur die Eltern des Thomas erlitten eine Niederlage: Wie zur Bekräftigung des Triumphes der geistlichen über die weltliche Macht wurde parallel Kaiser Friedrich II., mit dessen Unterstützung die Entführung gelungen war, im Sommer 1245 von Papst Innozenz IV. abgesetzt.
Thomas kehrt nach Neapel zurück, nur um wenig später mit Johannes von Wildeshausen nach Paris aufzubrechen. Die dortige Universität, wo Thomas sich tiefer in philosophische Fragen einarbeitet, gilt damals als geistiges Zentrum der Christenheit. Albertus Magnus wird sein Lehrer und Mentor, dem er 1248 auch nach Köln folgt, wo er, inzwischen Assistent des großen Albert und damit selbst zum theologischen Lehrer aufgestiegen, die Priesterweihe empfängt. Man kann sich vorstellen, was es für den deutschen Gelehrten für eine Freude gewesen sein muß, von Gott mit einem Menschen zusammengeführt worden zu sein, bei dem man selbst bei kompliziertesten und abstraktesten Gedankengängen nicht in ein leeres, schwarzes Loch blickte, sondern auf eine geöffnete Tür, hinter der es sofort zu leuchten begann.
Die Arbeit an der „Summa theologiae“ beginnt
1252 kehrt der Bakkalaureus – entspricht dem heutigen Bachelor – zurück nach Paris, wird Magister der Theologie. 1259 ist er wieder in Italien. Als Magister in Rom beginnt er die hingebungsvolle Arbeit an der „Summa theologiae“, wagt, was heute nur Kopfschütteln auslöst: den Gottesbeweis. Von entwaffnender Logik ist sein zentrales Argument: Da es kein Perpetuum mobile gibt, aber trotzdem alles in unserer Welt in Bewegung ist, muß eine Urkraft existieren, die als unbewegter Beweger den Anstoß zu dieser Bewegung gegeben hat. Diese nennt er Gott.
1268 wird der „vollkommene Systematiker“, wie ihn David Berger in seinem Thomas-Buch „Leuchtturm des Abendlandes“ (2019) nennt, auf den Pariser Lehrstuhl für Theologie zurückbeordert. Seine letzten Jahre verbringt er wieder in Neapel. Eine geheimnisvolle Wendung nach innen macht sich bemerkbar. Von mystischen Entrückungen erzählt Tocco. Auch die Arbeit an seinem Lebenswerk, der epochalen „Summa“, stellt Thomas zur Überraschung seines Vertrauten Reginald von Piperno ein. Es ist, als hätte er einen Ruf aus der Ewigkeit vernommen.

Die „Summa theologiae“ widmet sich selbstverständlich auch dem Mysterium von Weihnachten. Die scheinbare Aporie von der parallelen Göttlichkeit und Menschlichkeit Jesu löst Thomas auf im Begriff der Hypostase. Christus ist eine einzige Person, die aber zwei Naturen trägt, und Gott in jedem Moment des Erdendaseins Jesu so präsent in ihm, wie er in sich selbst präsent ist. In hochkomplexen Gedankengebäuden hatte Thomas mit dem Begriff der Hypostase schon das Geheimnis der Trinität zu lüften versucht, bis heute eine der am schwersten erklärlichen dogmatischen Festlegungen des Katholizismus. Sohn und Heiliger Geist seien innergöttliche Relationen und Emanationen (Hervorgehungen) des Göttlichen, die man sich am besten wie Sonneneruptionen vorstellt, die auch im Hervorbrechen Teil des gasförmigen Planeten bleiben.
Weihnachten ist ein Liebes- und Gnadenakt
Weihnachten ist für den Kirchenlehrer ein Liebes- und Gnadenakt. In seiner kleineren Schrift „Compendium theologiae“ erklärt er die freiwillige Selbsterniedrigung, die die Menschwerdung für Gott bedeutet, so: „Des ewigen Vaters Wort […] wollte, um den durch die Sünde erniedrigten Menschen zur Höhe der göttlichen Herrlichkeit zurückzurufen, ‘kurz’ werden, indem es unsere ‘Kürze annahm’, ohne seine Erhabenheit abzulegen.“
Ein zentraler Gedanke bei Thomas ist die creatio ex nihilo, die Vorstellung, daß Gott aus dem Nichts zu schaffen vermag, aber selbst nicht geschaffen ist. Gott definiert er als absolutes, reines und allem zugrundeliegendes Sein, als Existenz sine qua non oder, wie der Scholastiker in Anlehnung an die griechische Philosophie formuliert, als ipsum Esse subsistens, als „das Sein selbst, das existiert“. Der hebräische Gottesname JHWH drückt für ihn genau diese Vorstellung aus.
„Alles, was in der Zeit verwirklicht wird, wird von uns im Nacheinander der Zeit erkannt, von Gott aber in seiner Ewigkeit, die über alle Zeit ist“, heißt es im ersten Teil der „Summa“. Jedes Geschöpf, für das Anfang und Ende Grundkonstanten seiner Wahrnehmung und Konditionierung sind, stößt hier an Grenzen des Denkens. Würde man die Überlegungen des Thomas mit zeitgenössischer Metaphorik veranschaulichen, sähe die vielleicht so aus: Der gesamte Kosmos in all seinen Dimensionen (einschließlich der Zeit) ist eine Schneekugel, die Gott, der den gesamten zeitlosen Raum um diese Kugel herum ausfüllt, in der Hand hält, nachdem er sie durch einen Akt seines Willens hervorgebracht hat.
Gott als das eigentliche Ziel
Er kann sie nach Belieben schütteln, aber auch in die Schneekugelwelt hineinschlüpfen, Thomas würde sagen: „kurz“ werden. Dabei hört Gott nicht auf, er selbst zu sein. Mit der Geburt Christi an Heiligabend wird eine besondere Art der Emanation, des Hervorgehens aller Dinge aus dem göttlichen Einen, zum historischen Momentum.
Nicht nur seinem Geist (und dem seiner Leser) verlangte der Dominikaner Höchstleistungen ab, sondern auch seinem Leib. Der Regel des Dominikus gemäß verschmähte er die Vorzüge des bequemen Reisens mit Pferd und Wagen. Thomas ging zu Fuß, und zwar auch, wenn es ins Ausland ging. Und so nimmt es nicht wunder, daß sein Körper früh entkräftet und ausgelaugt war. Bereits geschwächt macht sich der Hochangesehene auf Wunsch von Papst Gregor X. Anfang 1274 auf den Weg zum II. Konzil von Lyon.
Unterwegs wird ihm klar, daß seine Kraft nicht mehr reicht. Der Tod ereilt ihn in der Zisterzienserabtei Fossanuova (Region Latium) am 7. März 1274. Seine letzte Reise führt nicht mehr ans Ziel. Große Pein wird das dem zeit seines Lebens auf die Ewigkeit ausgerichteten Geistlichen nicht bereitet haben. Er wußte, daß das eigentliche Ziel all seiner Reisen nie Lyon gewesen war, auch nicht Paris, Neapel oder Rom, sondern das unvergängliche Reich Gottes.