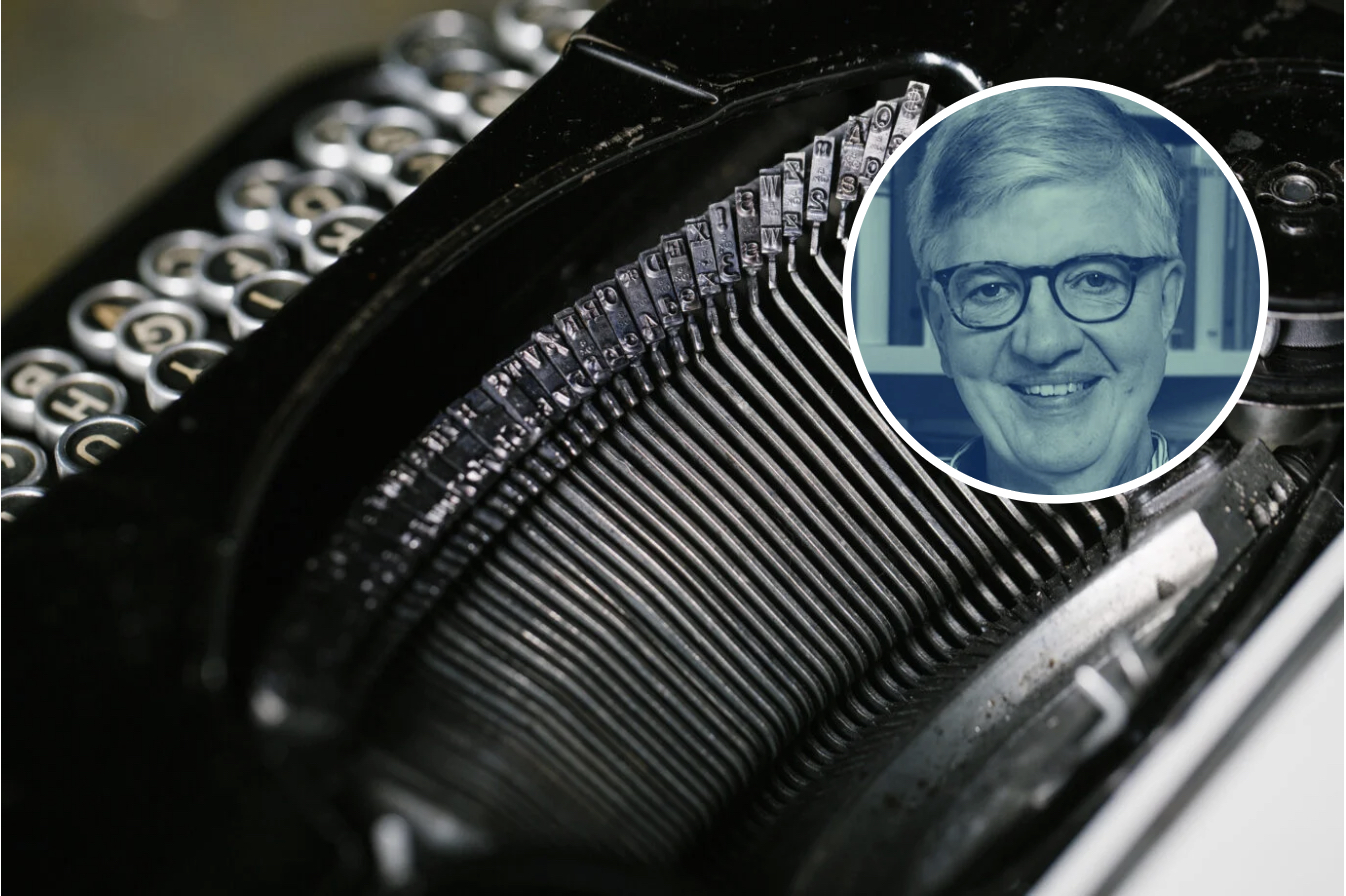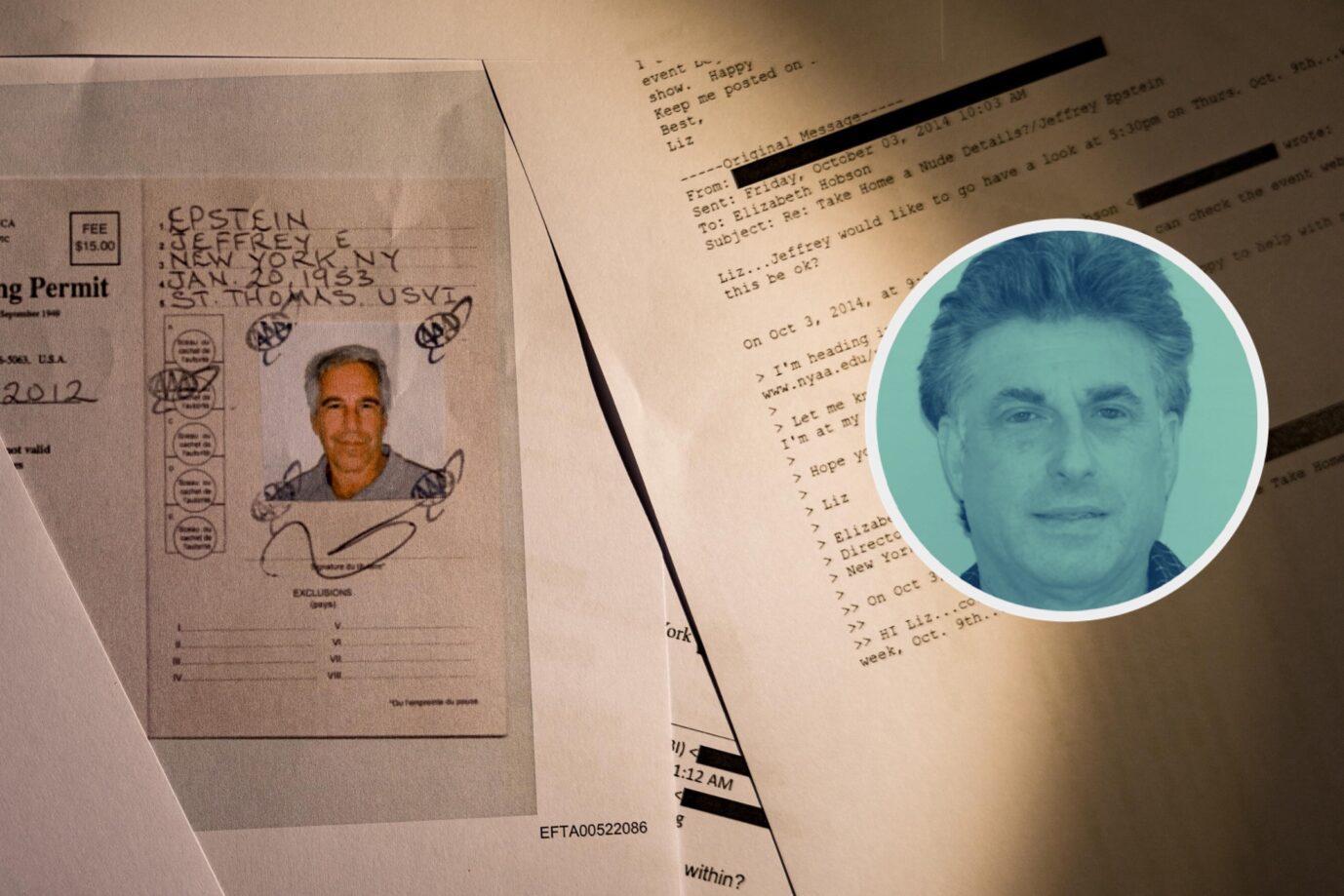Schwarze würden gegenüber Weißen im Bewerbungsverfahren diskriminiert, titelt die Frankfurter Allgemeine Zeitung. Laut einer US-amerikanischen Studie sei die Vergabe von Praktikumsplätzen noch immer von rassistischen Vorurteilen begleitet. Zu diesem Zwecke hatten Wissenschaftler des „Forschungsinstituts zur Zukunft der Arbeit“ mehrere fiktive Profile von Universitätsabsolventen erstellt und bei insgesamt 11.000 verschiedenen Firmen Bewerbungen für einen Praktikumsplatz eingereicht.
Da in den USA Fotos in den Bewerbungsunterlagen unüblich sind, ist für einen Arbeitgeber nicht ersichtlich, ob die Anwärter weiß oder schwarz sind. Um eine solche Unterscheidung dennoch zu ermöglichen, wurden fiktive Bewerberprofile mit eher schwarzen oder eher weißen Namen anglegt. Bewerbungen mit einem „schwarz“ klingenden Namen erhielten rund ein Viertel weniger Rückmeldungen.
Diskriminierung im mittleren Arbeitsmarktsegment
Die jüngste Studie ist nicht die erste ihrer Art. In den letzten 20 Jahren wurde dieser Befund immer wieder durch andere Wissenschaftler bestätigt. Doch läßt sich damit tatsächlich Rassismus auf dem amerikanischen Arbeitsmarkt beweisen oder ist die Wahrheit vielleicht komplexer? Tatsächlich gibt es bestimmte Namen, die fast nur unter Afroamerikanern verbreitet sind, auch wenn die meisten von ihnen klassische englische Vornamen tragen. Diese sind Teil einer eigenen schwarzen Identität, die sich auch durch die Abgrenzung von Weißen definiert.
Wie soziologische Untersuchungen zeigen, sind klassisch afroamerikanische Namen jedoch häufig ein Unterschichtenphänomen. Sie sind unter Schwarzen, die den sozialen Aufstieg schaffen und sich in mehrheitlich weißen Wohngegenden assimilieren, kaum verbreitet. Damit stellt sich die Frage, ob die typisch schwarzen Namen nicht eher eine Aussage über den sozialen Status treffen – also losgelöst von rassistischer Diskriminierung zu betrachten sind. In Deutschland haben Namen wie Kevin, Justin, Jacqueline oder Mandy schließlich auch einen schlechten Klang.
Unter Universitätsabsolventen dürfte nur eine kleine Zahl der Schwarzen typisch schwarze Namen tragen. In der Realität werden sie daher wohl eher – anders als in der genannten Studie – meist nicht vom Arbeitgeber als Schwarze erkannt werden. Zudem zeigen andere Studien: Diskriminierungen bei der Jobvergabe sind vor allem im mittleren Segment des Arbeitsmarkts (und dazu könnten die genannten Praktikumsplätze zählen) anzutreffen, kaum jedoch am oberen und am unteren Ende.
Nigerianer verdienen mehr als Weiße
Daß im Niedriglohnsektor keine Diskriminierung von Minderheiten besteht, ist intuitiv einleuchtend – denn gerade dort sind Minderheiten sehr stark vertreten. Daß die Aussage aber auch für den oberen Bereich des Arbeitsmarkts, also zum Beispiel für Führungspositionen in großen Firmen gilt, erscheint weniger offensichtlich – denn diese werden meist von Weißen bekleidet.
Doch diese Lücke läßt sich vor allem mit den schlechteren Bildungsabschlüssen von Minderheiten erklären. Ein Handwerksmeister verläßt sich bei der Einstellung von Lehrlingen oft nur auf sein Bauchgefühl, was Diskriminierung erleichtert. Große Firmen hingegen haben Personalabteilungen und berufen sich auf standardisierte Eignungstest.
Daß bei entsprechender Qualifikation Rassismus kaum noch eine Rolle spielt, zeigen beispielsweise die nigerianischen Einwanderer in den USA. Sie sind zumeist Akademiker, also eine Positivauswahl ihres Ursprungslandes. Ihr Durchschnittsverdienst liegt bisweilen sogar über dem der weißen Bevölkerungsmehrheit.