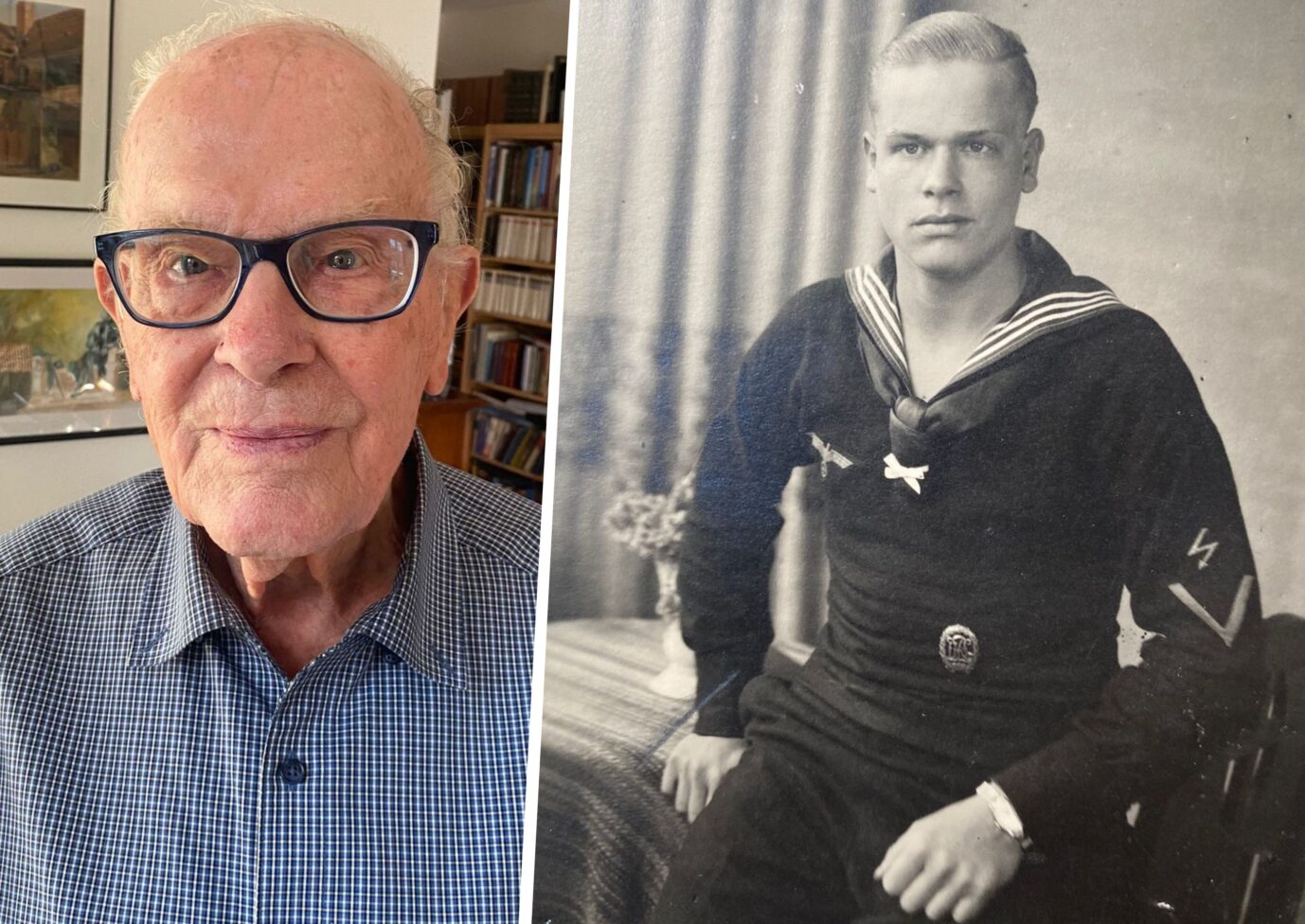Der Horizont ist kaum auszumachen, der hellgraue Himmel verschmilzt mit der baumlosen verschneiten Steppe. So weit das Auge reicht ragen jedoch seltsame Hügel hervor, an denen der Schnee kleine Verwehungen angehäuft hat. Tausende und Abertausende von diesen unbeweglichen dunklen Umrissen erheben sich aus der weißen Öde, hier, südlich von Stalingrad, wo nicht weit der gewaltige Wolgastrom seine Richtung nach Osten ändert.
Bei näherem Hinsehen entpuppen sich diese Erhebungen als Soldaten, die allein oder in kleinen Gruppen auf dem Erdboden kauern. Uniformteile verraten ihre Zugehörigkeit zur deutschen Wehrmacht. Einige liegen hingestreckt, die meisten Aneinandergelehnten wirken wie eingeschlafen. Lediglich der in den starren Gesichtern verfangene Schnee, die mit Eis und Reif überzogenen Mützen und hochgeschlagenen Mäntel verdeutlichen, daß hier auf vielen Hektar eine ganze Armee Erfrorener ihr Ende gefunden hat.
Fotos wie diese stammen von einer sowjetischen Kamera und lagen jahrzehntelang im Archiv. Lediglich in einer kurzen Spanne in den neunziger Jahren öffneten sich diese Dokumentensammlungen des Riesenreichs einen Spalt für Historiker, wie zum Beispiel für Alexander Jegorowitsch Epifanow. Der junge Geschichtsdozent an der Wolgograder Juristischen Hochschule veröffentlichte seinerzeit Bilder wie diese in seinen Aktenauswertungen über das Schicksal deutscher Kriegsgefangener.
Bundesdeutsche Geschichtswissenschaft ignorierte Archivfunde
In Deutschland, wo Angehörige und Nachfahren dieser Toten leben, stießen die völlig unbekannten Schreckensfotos jedoch auf weitgehendes Desinteresse. Nicht nur die Leitmedien, auch die bundesdeutsche Geschichtswissenschaft ignorierte die sensationellen Funde aus den sowjetischen Archiven weitgehend.
Tausende von nun zugänglichen Akten, die den Nebel über das ungewisse Schicksal unzähliger Kriegsgefangener hätten lichten können, vermochten die Zunft deutscher Historiker kaum zu mobilisieren. Dabei hatten nur eine Generation zuvor Organisationen wie der Deutsche Suchdienst nach diesen von ihren Müttern, Frauen und Kindern sehnsüchtig vermißten Soldaten ebenso verbissen wie ergebnislos geforscht.
Besonders im Fall Stalingrad, wo vor genau 75 Jahren die letzten Widerstandsnester in den Trümmern der Geschützfabrik „Rote Barrikaden“ kapitulierten und mit dem Fall des Kessels über 110.000 Soldaten in sowjetische Gefangenschaft gerieten, war das Verhältnis zu den wenigen Rückkehrern bis 1956 eklatant, von etwa zwanzig Soldaten sah praktisch nur einer die Heimat wieder.
Zehntausende erfroren in der Steppe bei Beketowka
Lange Zeit wurde dieser Umstand mit verschiedenen Faktoren erklärt: So waren die Männer, die sich Anfang Februar in den Ruinen von Stalingrad sammelten, völlig ausgezehrt und erschöpft. Viele waren verwundet, litten in ihrer unzureichenden Bekleidung bei bis zu minus 20 Grad an Erfrierungen und waren nach zwei Monaten rastlosen Kampfes im mit Lebensmitteln katastrophal unterversorgten Kessel unterernährt und erschöpft.
Tatsächlich erreichten Tausende die Gefangenen-Sammelpunkte im Umland von Stalingrad nicht, brachen taumelnd zusammen und wurden dann in der Regel von sowjetischen Begleitkommandos erschossen. Sie sollten zusammen mit den Zehntausenden von gefallenen Kameraden – und ebenso vielen Rotarmisten – die schrecklichen Leichenhaufen in allen Teilen der Stadt erweitern. Diese konnten meist erst Wochen später nach der Schneeschmelze in zahllosen Massengräbern verscharrt werden.
Entgegen bundesdeutscher Darstellungen aus der Nachkriegszeit, nach denen „große Strecken zu Fuß“ zurückzulegen waren, führte der Weg durch die tief verschneite Steppe jedoch selten weiter als fünfzig Kilometer, wie die Aufstellungen der Lagerverwaltungen verrieten. Allein den Lagerkomplex von Beketowka südlich von Stalingrad erreichten schätzungsweise 60.000 bis 70.000 Wehrmachtssoldaten.
Bereits am 3. Februar kamen dort, wo sich an den Ausläufern der riesigen Kalmückensteppe bereits aus der Zeit der Stalinschen Säuberungen ein Lager von Lawrenti Berijas Terrorpolizei NKWD befunden hatte, immer mehr Kriegsgefangene an. „Beketowka war wohl das katastrophalste Lager, das wir je zu sehen bekamen“, schilderte 1968 Hans Kurz, Hauptmann in der 13. Infanteriedivision, die Ansammlung von einigen kargen, ungeheizten Baracken inmitten der stürmischen Schneewüste.
Der 1922 geborene Josef Mairinger schildert in seinen 1982 erschienenen Erinnerungen, wie in der Nähe des bereits völlig überbelegten Lagers mehrere zehntausend Gefangene, in Viererreihen zu Hundertschaften eingeteilt, sich im Schnee niederlassen mußten, um auf versprochene Brotrationen zu warten, die dann nur für vielleicht tausend Soldaten reichten.
Kalkuliertes Massensterben
„Die nächsten acht Tage mußten wir Schnee und Eis lutschen, um nicht auszutrocknen. In dieser Woche gab es einmal oder zweimal einen Eßlöffel schwarzen Mehles, sonst nichts!“ Nur ein Teil dieser Masse konnte sich dann überhaupt wieder in Bewegung setzen, die meisten blieben erfroren und verhungert zurück. Womöglich stammen die russischen Fotografien aus den Wolgograder Archiven von diesen „Killing Fields“.
Als das NKWD im April 1943 erstmals einigermaßen verläßliche Zahlen zusammenstellt, wird die Dimension des Massensterbens deutlich. „Nach dem Ende der Stalingrader Schlacht wurden in den NKWD-Aufnahmestellen 73.092 Gefangene gemeldet. 7.869 wurden in Spitälern behandelt, 28.098 wurden in andere Lager befördert. (…) 36.230 sind gestorben, davon 24.364 schon in den Aufnahmestellen und 11.884 in den Hospitälern.“ Mit „Hospitälern“ sind primitive Lazarettbaracken gemeint, wo die immer häufiger auftretenden Seuchenfälle aufgenommen wurden.
Der bundesdeutsche Historiker Rüdiger Overmans, Experte am Militärgeschichtlichen Forschungsamt für die Verluste der Wehrmacht im Zweiten Weltkrieg, interpretierte dieses Massensterben später dennoch apologetisch. Es könne daraus „nicht geschlossen werden, daß es Ziel der sowjetischen Regierung gewesen wäre, die deutschen Kriegsgefangenen umkommen zu lassen“.
Tatsächlich offenbarte sich die Rote Armee schon 1942 als total überfordert, größere Massen von Kriegsgefangenen zu versorgen. Das völlige Fehlen von Vorkehrungen und Einrichtungen der Sowjets führte dazu, daß von den 1941/42 in Gefangenschaft geratenen 175.000 deutschen Soldaten nur knapp zehn Prozent überlebten. Allerdings gab es vielfach auch gewalttätige Übergriffe sowjetischer Soldaten bis hin zu Massenerschießungen unmittelbar nach der Gefangennahme, so daß höhere politische Stäbe sogar zur Mäßigung mahnten, um die Kapazitäten für die Zwangsarbeit nicht völlig zu vernichten.
Unter Putin wurde Zugang zu Archiven wieder erschwert
Overmans Analyse läßt dabei allerdings außer acht, daß diese äußeren Faktoren auch auf das menschenverachtende sowjetische System zurückzuführen sind. Bereits in den dreißiger Jahren hatte Stalin zur Genüge bewiesen, daß er vor Massenverbrechen mit Millionen Toten keinesfalls zurückschreckte. In Kriegsgefangenschaft geratene Soldaten, eben auch jene der Roten Armee, waren in seinen Augen nichts anderes als lebensunwerte Verräter.
Die Sowjetunion fühlte sich ohnehin nicht an kriegsvölkerrechtliche Übereinkünfte wie das Haager Landkriegsrecht gebunden, das insbesondere den Umgang mit Kriegsgefangenen genau regelte. Das war übrigens auch dem einfachen deutschen Landser bekannt. So begründete Erich Burkhardt, damals Melder in einer Division der 6. Armee, 2003 in einem Interview, warum viele Soldaten verbissen weiterkämpften: „Wir dachten gar nicht daran überzulaufen. Denn wir fürchteten die Gefangenschaft mehr als die Hölle im Kessel.“ Die Todeslager bei Beketowka sollten beweisen, daß diese Ahnung alles andere als unbegründet war.
Epifanow, der Mitte der neunziger Jahre mit seinen Forschungen gerade in Deutschland auf großes Interesse zu stoßen glaubte, traf übrigens nur bei Veteranenverbänden wie den „Stalingrader Spätheimkehrern“ auf Unterstützung. Deren Vorsitzender Hein Mayer veröffentlichte seine Arbeit unter dem Namen „Tragödie der deutschen Kriegsgefangenen in Stalingrad von 1942 bis 1956 nach russischen Archivunterlagen“ (Osnabrück 1996). So wie dieses Buch mit geringer Auflage haben auch die wenigen anderen Publikationen nie in die Aufmerksamkeitssphäre jenseits der Kleinst- und Samisdatverlage vordringen können.
Spätestens seit der Machtübernahme Wladimir Putins endete die „Glasnost“ für die Wissenschaft, der Zugang zu immer mehr Archiven erschwerte sich, manche Akten sind wieder so unerreichbar wie zu Sowjetzeiten. Eine Aufarbeitung dieses düsteren Kapitels dürfte heute wohl meist wieder vor den Archivtoren oder im bürokratischen Labyrinth der russischen Administration enden.
JF 6/18