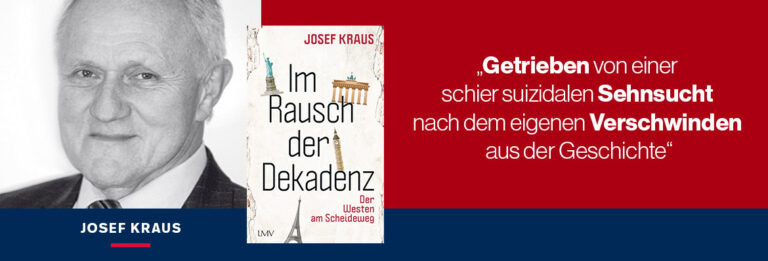Hans Filbinger ist eine Schicksalsfigur der Union. Die baden-württembergische CDU war dieser Tage dazu verdammt, die Kampagne, die vor fast dreißig Jahren ihrem erfolgreichsten Ministerpräsidenten das Amt gekostet hat, noch einmal zu durchleben. Und wieder hat sich gezeigt: Die Unionsparteien sind strukturell unfähig, der schwarzweiß malenden politisch-medialen Instrumentalisierung der NS-Jahre eine eigene geschichtspolitische Haltung entgegenzusetzen und auf diese Weise stereotypen links-antifaschistischen Kampagnen Paroli zu bieten. Sollte die Trauerrede von Ministerpräsident Günther Oettinger auf den verstorbenen Hans Filbinger der Versuch gewesen sein, das mit dessen Rücktritt 1978 verbundene Parteitrauma zu überwinden, so ist das Unterfangen gründlich mißlungen. Gewartet haben wohl einige in der Südwest-CDU auf eine Art Befreiungsschlag; das verraten die emphatischen Beifallsbekundungen von Bundestags-Landesgruppensprecher Brunnhuber. Das „Meisterstück“, das dieser dem Ministerpräsidenten attestiert hatte, hat sich durch Oettingers Widerruf in letzter Minute freilich ins Gegenteil verkehrt. Was war da schiefgelaufen? Fehl geht wohl, wer Oettinger strategisches Kalkül und geschichtspolitische Tapferkeit unterstellen wollte. Dem Vorsitzenden der Südwest-CDU ging es weder um Filbinger noch um differenzierende Gerechtigkeit für die Kriegsgeneration, sondern um simple Parteitaktik: Innerhalb der CDU hat Oettinger den Ruf des Liberalen, der gern zu den Grünen schielt. Vielleicht wollte er den konservativen Flügel umgarnen, vielleicht hat er sich angesichts zweier Gefahren – dem Groll der parteifreundlichen Todfeinde und dem Haß der Filbinger-Kampagnisten von einst und ihrer Erben in der Landtagsopposition – einfach nur der näherliegenden gebeugt: Jedenfalls hat er sich zu einer angreifbaren Äußerung hinreißen lassen, die nach den ehernen Gesetzen des institutionalisierten Aufstands der Anständigen gnadenlos ausgenutzt wurde. Oettinger wollte dabei wohl etwas Richtiges sagen, hat es aber falsch ausgedrückt. Gewiß, Filbinger war kein fanatischer Nationalsozialist, sondern innerlich eher distanziert gegenüber dem Regime; aber ein aktiver Gegner, wie die Formulierung der Gedenkrede implizierte, war er nun gerade nicht. Man kann ihm zugute halten, daß er, ohne sich selbst zu exponieren, Härten abzuwenden versuchte, man mag ihm nachsehen, daß er sich in Unabänderliches fügte und gegen Befehlshierarchien nicht aufbegehrte, man kann ihm nicht vorwerfen, daß er nicht wie manch selbstgerechter Nachgeborener im Frontsoldaten den Mörder und im Deserteur den wahren Helden erblickte – nur „Widerstand“ ist das alles eben nicht. Für derlei Differenzierungen fehlten Oettinger schlicht die Begriffe. Ins manichäische Schwarzweiß, mit dem die NS-Zeit üblicherweise betrachtet wird, paßt nur die Dichotomie „Nazi böse – Opfer gut“; allenfalls der Widerstandskämpfer wird noch auf der Seite der Guten geduldet. Oettinger glaubte wohl, Filbinger zu einem solchen ernennen zu müssen, wenn er denn kein „Nazi“ gewesen sein sollte – etwas dazwischen kennt man ja nicht mehr. In dieser unhinterfragten Anpassung an „antifaschistische“ Diskursregeln erweist sich der gegenwärtige Ministerpräsident Baden-Württembergs durchaus als Geistesverwandter Filbingers. Der ist weniger über seine Vergangenheit als vielmehr über seine Kommunikation gestürzt: Er hatte nicht den Mut, offensiv mit seiner Biographie und ihren Brüchen umzugehen und damit ein Vorbild für seine Generation, die Kriegsgeneration, zu geben; bequemer schien es, Grautöne wegzuretuschieren, um auch zu den Weißgemalten zu gehören. Das mußte schiefgehen, ebenso wie die Reprise durch den politischen Urenkel. Denn inzwischen gilt in der CDU das Wort der Kanzlerin, man habe auf seiten der Opfer zu stehen, „das macht den Kopf frei“. Die Konsequenz daraus ist, den selbsternannten Hütern des Antifaschismus die Deutungshoheit zu überlassen und ihre Verdikte gegebenenfalls selbst zu exekutieren. Gegen die konzertierten Rücktrittsforderungen der einschlägigen Lobbygruppen kann keiner durchhalten, wenn die eigene Parteivorsitzende als erste von ihm abrückt und alle anderen ängstlich schweigen. Erst recht nicht ein Oettinger, der sich lediglich parteitaktisch vergaloppiert hatte, aber kein echtes Kampagnenopfer war wie Martin Hohmann, der an seinem Standpunkt überdies festhielt bis zum Rauswurf. Es wäre nun wohl naiv, ausgerechnet von Angela Merkel, die selbst in einem totalitären Regime gelebt, sich angepaßt und aus Karrieregründen bis zu einem gewissen Grad „mitgemacht“ hat, Verständnis für eine Biographie wie die Filbingers zu erwarten. Der Widerspruch ist zwar etlichen Diskutanten in diversen Internetforen aufgefallen, aber keinem in der CDU – jedenfalls öffentlich. Kritik am schnellen Machtwort der Kanzlerin kam lediglich vom längst abservierten Konservativen Jörg Schönbohm. Pragmatisch mag der geschichtspolitische tabula-rasa-Kurs der Merkel-CDU, die mit fliegenden Fahnen vom antitotalitären auf den antifaschistischen Grundkonsens umgeschwenkt ist, ja sein; die Kanzlerin und ihre Entourage von Oettinger-Gegnern haben immerhin einen Konkurrenten zurechtgestutzt, der nun bundespolitisch nicht mehr gefährlich werden kann. Bezahlt wird dafür mit der Ermunterung zu Heuchelei und Anpassertum. Denn die Erfahrungen der Deutschen aus zwei totalitären Systemen, die nun mal nicht schwarzweiß sind, finden im öffentlichen Diskurs keine Entsprechung. Es rächt sich, daß die Union aus dem Sturz Filbingers nach der Mutter aller „antifaschistischen“ Kampagnen nichts gelernt und nie um einen eigenständigen bürgerlichen Standpunkt zu den totalitären Verstrickungen des zwanzigsten Jahrhunderts gerungen hat, der über die bloße Übernahme der Sichtweise der Sieger hinausgeht. Die Strafe ist, daß sie jederzeit wieder mit einer aus dem Hut gezauberten Kampagne vorgeführt werden kann. Zurück bleibt ein Scherbenhaufen. Unwidersprochen darf der Verstorbene weiter selbst mit abstrusen Verdrehungen als „Nazi“ diffamiert werden, während Leute, die als K-Gruppen-Aktivisten und Straßenkämpfer den Staat bekriegten, dem Filbinger als loyaler Demokrat diente, heute den „Staatsmann“ geben. Filbinger bleibt das Schicksal der Union: Nicht weil er selbst ein „furchtbarer Jurist“ gewesen wäre, sondern weil in seiner Partei die furchtbaren Opportunisten nach wie vor den Ton angeben.