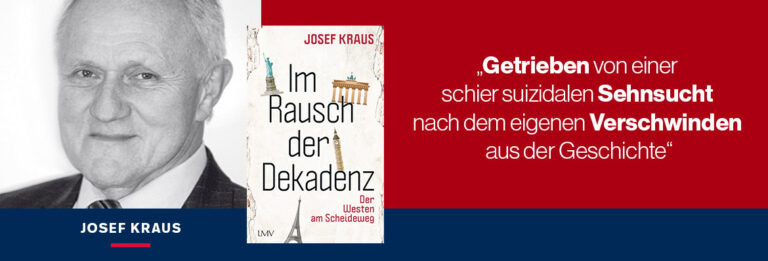Die zum Antifa-Milieu gehörende Amadeu-Antonio-Stiftung hat eine Ausstellung „Das hat’s bei uns nicht gegeben!“ auf die Reise geschickt. Sie wurde von 76 Schülern aus den neuen Ländern unter Anleitung von Historikern und Pädagogen erarbeitet. Die Ausstellung soll nachweisen, daß der Antifaschismus der DDR ein Mythos war, der das Fortwirken des Antisemitismus mehr schlecht als recht bemäntelte. Es geht um keine grundsätzliche Problematisierung des Kampfbegriffs „Antifaschismus“, sondern um dessen falsche Umsetzung. Stiftungsleiterin Anetta Kahane verbreitete, in den Familien in der DDR habe „keine Auseinandersetzung mit der Vergangenheit stattgefunden“. Dem ist entgegenzuhalten: In Deutschland, egal ob in Ost oder West, gab es keine einzige Familie, die von den Auswirkungen des Zweiten Weltkrieges verschont geblieben, in der mithin „die Vergangenheit“ nicht gegenwärtig gewesen wäre. Eine andere, konzeptionelle Schwäche, die sofort ins Auge springt: Zwischen Antisemitismus, Antizionismus und Kritik an Israel wird überhaupt nicht unterschieden. Obwohl die Ausstellung primitivste Standards verfehlt, wurde die Eröffnung feierlich im Wappensaal des Roten Rathauses, Amtssitz des Regierenden Bürgermeisters von Berlin, begangen. Im April war sie im Rathaus von Berlin-Lichtenberg zu sehen, bis Mitte Juli wird sie in Köpenick (Rathaus) und danach in Leipzig (Schulmuseum) gezeigt. Weshalb muß der Staat dafür Geld ausgeben? Das Echo in den großen Zeitungen und Medien war bisher durchweg positiv. Kritik kam dagegen aus kleinen linken Blättern. Die PDS, die in Lichtenberg die Bezirksbürgermeisterin stellt, kritisierte die Ausstellung in einer Presseerklärung als einseitig. Unter einem Vorwand wurden die meisten Schautafeln aus dem Sitzungssaal auf einen engen Flur verbannt. Diese Differenzierung innerhalb des antifaschistischen Spektrums ist bemerkenswert. Die Kritik der PDS trifft zu. Die Ausstellung löst Fakten aus ihrem Kontext, damit sie als Argument für eine politische Lehrmeinung zur Verfügung stehen. Eine plumpe Manipulation also. Das Plattmachen jüdischer Friedhöfe war gedanken- und pietätlos, sicher, aber als Beleg für Antisemitismus taugte es nur, wenn nachgewiesen werden könnte, daß die Abräumung sich exklusiv gegen jüdische Friedhöfe richtete. Davon kann keine Rede sein. Auch christliche Friedhöfe, die der Stadtplanung, dem Braunkohletagebau oder dem Ausbau der Grenzanlagen im Wege standen, wurden ohne viel Federlesens beseitigt. In Frankfurt/Oder, das nach 1945 Durchgangsstation für Hunderttausende deutsche Kriegsgefangene, Zivilverschleppte und Vertriebene war, die zu Tausenden starben und in Massengräbern ihre letzte Ruhe fanden, wurde noch in den achtziger Jahren ein Friedhof mit Wohnmaschinen überbaut. Die Ausstellung zeigt, daß es in den siebziger Jahren bei der Exhumierung von KZ-Opfern in Brandenburg zu einer spektakulären Leichenschändung kam. „Die Stasi brach Leichen das Zahngold heraus“, titelte die Berliner Zeitung. Ein zwingender Beweis für Antisemitismus ist auch das nicht. Wäre man bei nichtjüdischen Toten anders verfahren? In DDR-Gefängnissen wurde politischen Gefangenen Blut abgezapft, das anschließend in den Westen verkauft wurde. DDR-Bürger mit kulturhistorisch wertvollem Besitz wurden durch fingierte Anklagen ins Gefängnis gebracht, um ihre Möbel, Bilder, Bücher zu beschlagnahmen und gegen Devisen zu verscherbeln. Für diese Praxis steht der Name Schalck-Golodkowski, der dafür genausowenig belangt wurde wie die westdeutschen Hehler. Von einem Staat, der mit den eigenen Bürgern so rabiat umsprang, war Respekt gegenüber unbekannten Toten nicht zu erwarten. Ein Blick in die alten deutschen Ostgebiete hätte die Ausstellungsmacher darüber belehrt, daß solcher Leichenraub keine DDR- oder antisemitische Spezialität war. Ein anderer Schwerpunkt heißt „Politik und Medien“. Die Tatsache, daß die DDR politische Kontakte zu den arabischen Staaten suchte – während die Bundesrepublik an Israel Wiedergutmachung leistete -, soll ebenfalls antisemitische Ursprünge haben. Der Kontext des Kalten Krieges wird völlig ausgeblendet. Die DDR war ein Homunkulus der Niederlage und der Teilung. Ihre Abhängigkeit von der Sowjetunion war so groß, daß sie sich nicht einmal selber abschaffen durfte. Die von Bonn verhängte diplomatische Blockade („Hallstein-Doktrin“) ließ der DDR gar keine andere Wahl, als Kontakte zu den antikolonialistischen Regimes der arabischen Welt zu suchen. Israel dagegen wurde dem feindlichen Lager zugerechnet („Speerspitze des US-Imperialismus“). Irgendwelche Sonderbeziehungen nach Tel Aviv waren unmöglich, sie wären von Moskau auch niemals geduldet worden. Die Position der DDR zum Yom-Kippur-Krieg 1967 und zum Libanon-Krieg 1982 war damit ebenfalls vorgegeben. Doch nicht genug damit, daß die Ausstellung das alles ignoriert, sie nimmt die israelische Politik unkritisch als Maßstab, an dem die DDR sich moralisch messen lassen muß. Dadurch wird die Chance vertan, herauszuarbeiten, wo tatsächlich antisemitische Topoi durchschlugen. Es ist unbestreitbar, daß es im Zuge der scharfen antisemitischen Wendung, die die sowjetische Politik in Stalins letzten Lebensjahren nahm, in der DDR zu antizionistischer Polemik kam, doch anders als im übrigen Ostblock gab es keine großen Schauprozesse, die mit Todesurteilen gegen Juden endeten und von Säuberungswellen begleitet wurden. Für neonazistische Umtriebe in den achtziger Jahren machen die Ausstellung und Stiftungsleiterin Kahane einen in der DDR unangetastet gebliebenen „Bodensatz des Antisemitismus“ verantwortlich. Den wird es gegeben haben, nachdem der Antisemitismus zwölf Jahre lang Staatsdoktrin war. Doch eine Auseinandersetzung damit fand durchaus statt. Der westliche Kampfbegriff „Verdrängung“ führt hier nicht weiter, denn die Kommunikationsverhältnisse in der DDR waren völlig andere. Die Presse war nahezu ideologisch gleichgeschaltet, doch einen gewissen Öffentlichkeitsersatz bot die Literatur, die in der DDR eine viel größere Bedeutung hatte als in der BRD. 1952 veröffentlichte die Ikone der DDR-Literatur, Anna Seghers, ihre vieldiskutierte Novelle „Der Mann und sein Name“. Es geht um einen jungen SS-Mann, der die Identität eines kommunistischen Widerstandskämpfers annimmt und, als ihm ein Diebstahl angezeigt wird, herausplatzt: „Ein solcher Lump, bestiehlt sein Volk wie ein Jud.“ In den populären Romanen von Jurek Becker wurde das komplizierte Verhältnis der Juden zur DDR-Umwelt noch viel drastischer geschildert. Weitere Beispiele: In der vierten Klasse war das Kinderbuch „Die Jagd nach dem Stiefel“ Pflichtlektüre. Eine kommunistische Schülergruppe („die Rotschlipse“) überführt 1932 einen SA-Mann anhand eines Stiefelabdrucks als Mörder. Als zwei jüdische Schwestern in der Schule als „Judenaffen“ beschimpft werden, verpaßt ein „Rotschlips“ dem Krakeeler einen Kinnhaken. Die Botschaft war eine doppelte: Judenhaß ist etwas Gemeines, seine Bekämpfung für Kommunisten eine selbstverständliche Ehrenpflicht. Im Nachwort verriet der Autor, daß sein Buch auf Tatsachen beruhe und aus der Familie der Schwestern („harmlose, gute Menschen“) kein einziger die NS-Zeit überlebt habe. In der neunten Klasse wurde das Drama „Professor Mamlock“ von Friedrich Wolf – Vater des Stasi-Generals Markus und des Filmregisseurs Konrad Wolf – durchgenommen. Mamlock, Klinikleiter, Kriegsverwundeter, unpolitisch und strikt legalistisch, weist noch nach Hitlers Machtergreifung den Gedanken ans Exil weit von sich: „Wir bleiben in Deutschland, wir können nicht mehr aus diesem Land, wir sind ein Teil dieses Landes.“ Tief verbittert nimmt er sich schließlich das Leben. Konrad Wolf hat 1961 eine großartige Verfilmung von „Professor Mamlock“ vorgelegt, die ebenfalls auf dem Lehrplan stand. Der Rückgriff auf das Vokabular und die Symbole des NS-Regimes, der in den achtziger Jahren unter DDR-Jugendlichen vereinzelt vorkam, hat nichts mit einem Mangel an politischer Erziehungsarbeit, sondern – genau wie heute – mit dem Übermaß an Repression zu tun. Der Antifaschismus war die wichtigste ideologische, politische und moralische Legitimationsquelle der SED-Führung. Das Bekenntnis zum Nationalsozialismus war ein inakzeptables, unreifes, aber aufsehenerregendes Verfahren, seinen Widerwillen zu demonstrieren. Der Schriftsteller Thomas Brasch (Sohn des jüdischen Kommunisten und stellvertretenden Kulturministers Horst Brasch) schildert in dem Buch „Vor den Vätern sterben die Söhne“ eine Diskussion zwischen einem kommunistischen Spanienkämpfer und einem jungen Mann, der die Flucht in den Westen plant. Der Junge kann die Antifa-Litanei nicht mehr hören, er will „diese Nabelschnur durchreißen. Die drückt mir die Kehle ab.“ Diese Problematik können Schüler, die nach 1989 geboren wurden, nicht kennen. Es wäre die Pflicht der Pädagogen, Historiker, der Amadeu-Antonio-Stiftung und der aus der DDR stammenden Anetta Kahane gewesen, das Material sinnvoll zu ordnen. Statt dessen haben sie den Tunnelblick des Ressentiments kultiviert. Die Stoßrichtung der Ausstellung gegen den DDR-Antifaschismus muß die PDS beunruhigen. Denn erstens genießt sie als dessen Hüterin in den neuen Ländern breite Zustimmung. Zweitens haben die Überschneidungen mit dem bundesdeutschen Antifaschismus ausgereicht, ihr auch im Westen eine – wenn auch widerwillige – Akzeptanz zu verschaffen. Trotz ihrer Herkunft aus der SED ist ihr Ansehen viel größer als das der kleinen Rechtsparteien. Die Ausstellung hebt dagegen die Unterschiede hervor. Der DDR-Antifaschismus hatte seine Wurzeln im Marxismus-Leninismus, der Antisemitismus war darin keine zentrale Größe, sondern eine Unterfunktion reaktionärer Politik, mit der Beseitigung des Privateigentums an Produktionsmitteln konnte ihm die Grundlage entzogen werden. Für den BRD-Antifaschismus ist er dagegen ein Numinosum. Die materialistische Deutung der DDR, die ihn auf politisch-ökonomische Ursachen zurückführt, ist unvereinbar mit der gegenwärtigen Neudefinition des kollektiven Selbstverständnisses, die den Holocaust zum epiphanischen Ereignis erhebt. Indem die Schüler in der Ex-DDR sich das BRD-Verständnis aneignen, „bewältigen“ sie gleichzeitig die Vergangenheit ihrer Eltern. Das alarmiert die PDS, deren Stärke zum großen Teil auf alten Loyalitäten beruht. Anetta Kahane agiert als eine Speerspitze der Erziehungsarbeit. An ihrer Kompetenz gibt es Zweifel, die jugendlich-erregten Auftritte der 53jährigen legen nahe, daß die Ressentiments und der Tunnelblick der Ausstellung auch Teil ihrer ganz persönlichen Bewältigungsstrategie sind. Kahanes Vater war einer der bekanntesten Auslandsjournalisten der DDR, Anetta hat als Kind und als Studentin jahrelang im nichtsozialistischen Ausland gelebt, ein ungeheures Privileg. Trotzdem hat sie acht Jahre lang für die Stasi als IM gearbeitet, aus welchen Gründen auch immer. Um damit fertigzuwerden, kann die DDR für sie rückblickend nicht schlimm genug gewesen sein, nach dem Motto: „Nicht ich, die DDR ist es gewesen!“ Ein falsches DDR-Bewußtsein sucht Heilung in der nicht minder falschen Vergangenheitspolitik der Bundesrepublik. „Meine Schwierigkeit war und ist es, einen Ort im Täterland zu finden.“ Vor allem bewahrt ihre „Schwierigkeit“ sie davor, für die Öffentlichkeit nichts weiter als eine auf Hartz IV gesetzte IM-Frau zu sein. Ihre persönlichen Irrungen und Wirrungen prägen nun die Arbeit der Amadeu-Antonio-Stiftung. Weshalb muß der Staat dafür Geld ausgeben? Stichwort: Amadeu-Antonio-Stiftung: Die linksradikale Amadeu-Antonio-Stiftung ist Teil des engmaschigen Netzwerkes aus meist öffentlich finanzierten Initiativen und Vereinen, die sich dem „Kampf gegen Rechts“, gegen Rechtsextremismus, Antisemitismus und Rassismus verschrieben haben. Ziel der Stiftung ist, eine „zivile Gesellschaft zu fördern, die antidemokratischen Tendenzen entschieden entgegentritt“. Dafür, so erklärt die Stiftung sibyllinisch, „werden Gruppen unterstützt, die kontinuierlich gegen Rechtsextremismus vorgehen“ – von der Antirassistischen Initiative bis zu den Schülern gegen Rechts in Mecklenburg-Vorpommern.