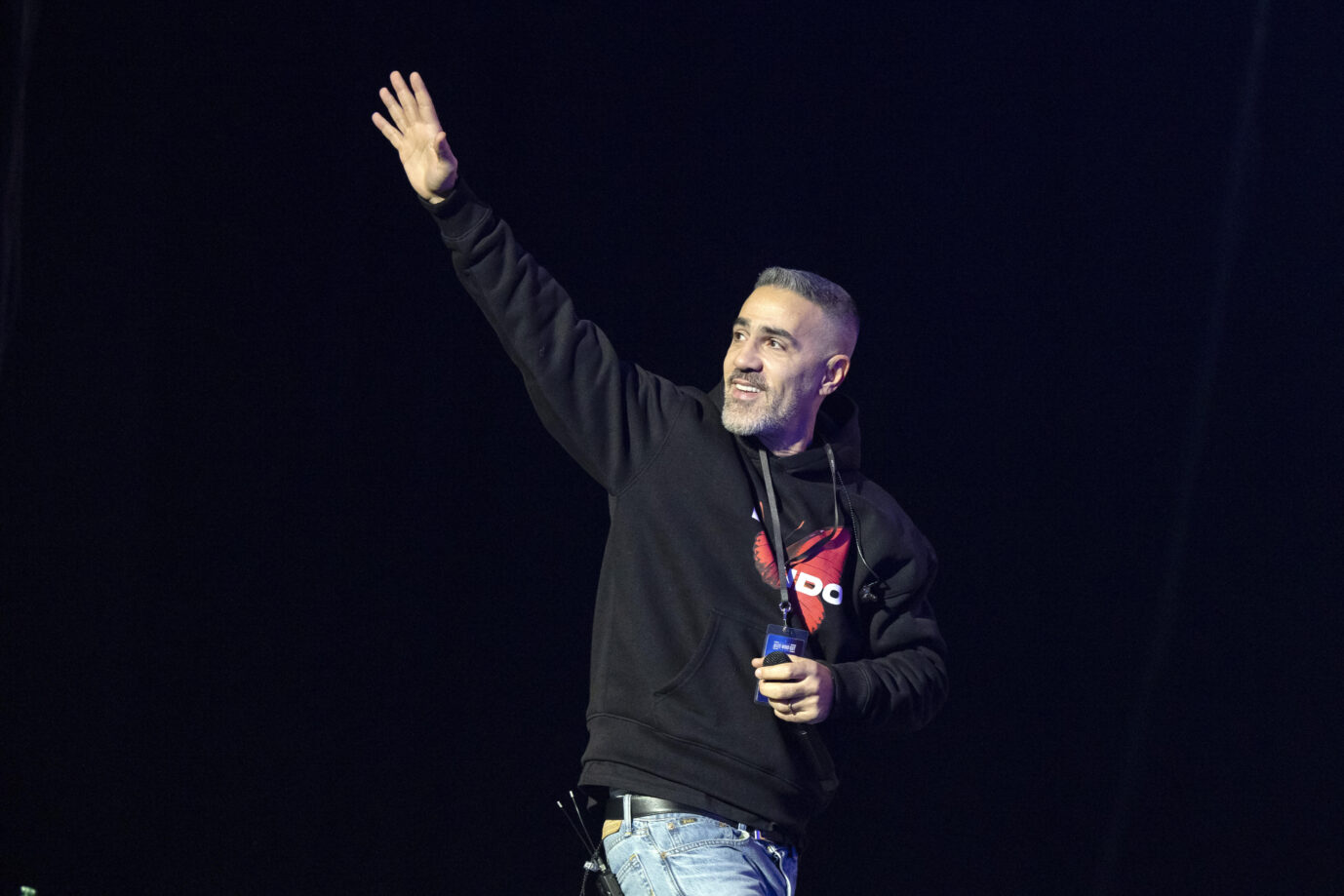Hochstimmung beim Inlandsgeheimdienst und in der Politik. „Wir haben auf ganzer Linie obsiegt“, strahlte Thomas Haldenwang, Präsident des Bundesamts für Verfassungsschutz (BfV), in die Kameras. „Die Sonne lacht über Köln, über Münster und über die freiheitlich demokratische Grundordnung“. Das Oberverwaltungsgericht (OVG) Münster hatte geurteilt, das BfV habe die AfD zu Recht als „rechtsextremistischen Verdachtsfall“ eingestuft und dürfe die Öffentlichkeit darüber unterrichten.
Damit bestätigte das Gericht nach sieben Verhandlungstagen das Urteil der Vorinstanz, so daß das Amt auch weiterhin nachrichtendienstliche Mittel zur Beobachtung der Partei einsetzen darf. Dies gilt auch für die Jugendorganisation „Junge Alternative“ (JA). Verdeckte Informanten, sogenannte V-Leute, verwanzte Räume und abgehörte Telefonate gehören also weiterhin zum Alltag der AfD-Führung.
Das ist zweifellos für eine politische Partei eine gewaltige Einschränkung, die das Gericht gebilligt hat. Ein weiterer Nachteil: Da der AfD nur eine Presseerklärung des Gerichts, nicht aber die ausführliche Begründung des Urteils vorliegt, kann sie sich in der aktuellen politischen Diskussion nur unzureichend verteidigen.
Die Partei wird Nichtzulassungsbeschwerde vor dem Bundesverwaltungsgericht erheben
Doch möglicherweise haben sich Haldenwang und die Seinen zu früh gefreut. Denn das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Zwar haben die fünf Richter eine Revision nicht zugelassen, aber möglich ist eine sogenannte Nichtzulassungsbeschwerde. Nach Darstellung des AfD-Prozeßvertreters Roman Reusch hat das OVG die rund 470 Beweisanträge der AfD „einfach vom Tisch gefegt“ und damit „klassische Revisionsgründe“ geliefert.
„Es ist mir völlig schleierhaft, wie das Gericht eine Gesamtwürdigung vornehmen konnte, wenn es nur das belastende BfV- Material vor Augen hatte“, betonte der frühere Leitende Oberstaatsanwalt gegenüber der JUNGEN FREIHEIT. Die Partei wird also Nichtzulassungsbeschwerde vor dem Bundesverwaltungsgericht in Leipzig erheben, um die Revision des Münsteraner Urteils zu erreichen.
Das AfD-Bundesvorstandsmitglied verwies darauf, das Gericht habe das BfV auch inhaltlich zurechtgestutzt. Heftig umstritten ist der in der AfD gängige „ethnisch-kulturelle Volksbegriff“, in dem die Verfassungsschützer grundsätzlich eine Abwertung aller Menschen sehen, die nicht in diese Kategorie fielen, etwa weil sie einen Migrationshintergrund aufwiesen.
Der Senat sieht eine „Mißachtung der Menschenwürde“
Dazu heißt es in der Presseerklärung des Gerichts: „Verfassungswidrig und mit der Menschenwürde unvereinbar ist nicht die deskriptive Verwendung eines ‘ethnisch-kulturellen Volksbegriffs’, aber dessen Verknüpfung mit einer politischen Zielsetzung, mit der die rechtliche Gleichheit aller Staatsangehörigen in Frage gestellt wird.“ Ein Punkt für die AfD. Allerdings führt das Gericht weiter aus, „hier bestehen hinreichende tatsächliche Anhaltspunkte für derartige Zielsetzungen“. Hier folgt der 5. Senat der Argumentation des BfV, die AfD verfolge Bestrebungen, „die mit einer Mißachtung der Menschenwürde von Ausländern und Muslimen verbunden sind“. Punkt für den Verfassungsschutz.
Um diesen zentralen Vorwurf zu entkräften, bedarf es vor dem Bundesverwaltungsgericht einiger Überzeugungskraft der AfD-Prozeßvertreter. Sie dürften auf die Feststellung des OVG verweisen, es entspreche den politischen Zielsetzungen „jedenfalls eines maßgeblichen Teils der AfD, deutschen Staatsangehörigen mit Migrationshintergrund nur einen rechtlich abgewerteten Status zuzuerkennen“. Reicht ein „maßgeblicher Teil“ aus, um die Einstufung der Gesamtpartei als „rechtsextremistischen Verdachtsfall“ zu rechtfertigen?
Wird Leipzig das OVG-Urteil zur erneuten Entscheidungsfindung nach Münster zurückverweisen? Das erwarten zumindest die AfD-Prozeßvertreter. Sie werden sich auch auf die einschränkende Feststellung des Gerichts berufen, „in der AfD gebe es Anhaltspunkte für demokratiefeindliche Bestrebungen, wenn auch nicht in der Häufigkeit und Dichte wie vom Bundesamt angenommen“.
VS soll bereits an einem Folgegutachten arbeiten
Reusch wandte sich vehement gegen den Vorwurf der Prozeßverschleppung durch Schaufensteranträge. Die AfD hatte zunächst auf die Verlesung aller 470 Anträge bestanden, um sicherzustellen, daß auch die zwei ehrenamtlichen Richter genau über die komplizierte Beweislage informiert werden. Aus Erfahrung wisse er, daß Laienrichter oft keinen vollständigen Zugang zu den Akten hätten, meinte der langjährige Leitende Oberstaatsanwalt, der bis 2021 für die AfD im Bundestag saß.
Unabhängig von der Fortsetzung des Rechtsstreits muß die gerichtlich bestätigte Einstufung als „rechtsextremistischer Verdachtsfall“ vom BfV jetzt regelmäßig „ergebnisoffen“ geprüft werden. Das bedeutet, der Verdacht kann sich nicht bestätigen, oder mittels weiterer Prüfungen aufrechterhalten werden. „Oder es kann eben in letzter Konsequenz auch eine Hochstufung zum erwiesenen Beobachtungsobjekt erfolgen“, betonte Haldenwang vor seinem Amtssitz in Köln. Was im konkreten Fall geschehe, hänge auch entscheidend von dieser neuen Bewertung unter Einbeziehung der Urteilsgründe des OVG ab.
Medienberichten zufolge arbeitet der Verfassungsschutz bereits an einem Folgegutachten, um die Gesamtpartei als „gesichert rechtsextreme Bestrebung“ weiter hochzustufen. Erstmals soll das Verhältnis zu Rußland eine Rolle spielen. Das BfV lehnt eine Stellungnahme dazu ab. Es wird sich aber an der Feststellung des Senats messen lassen müssen: „Was für einen Verdacht verfassungsfeindlicher Bestrebungen ausreicht, führt aber auch nicht zwangsläufig zur Annahme einer erwiesen extremistischen Bestrebung“.
Debatte um das AfD-Verbot ist neu belebt
Erwartungsgemäß hat der Richterspruch die Debatte über ein AfD-Verbot neu belebt. Vertreter der Bundesregierung hielten sich zurück. Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD), Dienstherrin von Haldenwang, zeigte sich zufrieden über das Urteil, reagierte aber verhalten. „Wir werden die rechtliche Bewertung weiter von der politischen Auseinandersetzung, die wir in Parlamenten und öffentlichen Debatten führen, klar trennen.“
Die sächsische Justizministerin Katja Meier (Grüne) forderte eine Initiative der Länder. „Nun muß die Prüfung der Erfolgsaussichten eines Verbotsverfahrens konkret erfolgen.“ Ausgerechnet die Innenpolitikerin der SED-Nachfolgepartei Linke, Martina Renner, verlangte rasches Handeln. „Ein Verbotsantrag ist die Selbstverteidigung der Demokratie gegen ihre Feinde.“
Im Osten bekommt man die Partei nicht mehr klein
Daß Renners früherer Parteichef Bernd Riexinger 2020 auf einer Linken-Konferenz einer Teilnehmerin, die von der Erschießung reicher Menschen sprach, geantwortet hatte: „Wir erschießen sie nicht, wir setzen sie schon für nützliche Arbeit ein“, darauf machte AfD-Chefin Alice Weidel nach dem Urteil aufmerksam. Ein Aufschrei sei damals unterblieben. Hier werde mit zweierlei Maß gemessen.
Der frühere Ostbeauftragte und sächsische CDU-Bundestagsabgeordnete Marco Wanderwitz will weiter für einen Verbotsantrag im Bundestag werben. Über seine Beweggründe macht er kein Hehl. „Gerade im Osten bekommt man die Partei auf politischem Weg nicht mehr klein.“ Ein Antrag auf Parteienverbot kann vom Bundestag, der Bundesregierung oder dem Bundesrat gestellt werden. Ob es zu einem Verbot kommt, entscheidet anschließend das Bundesverfassungsgericht.