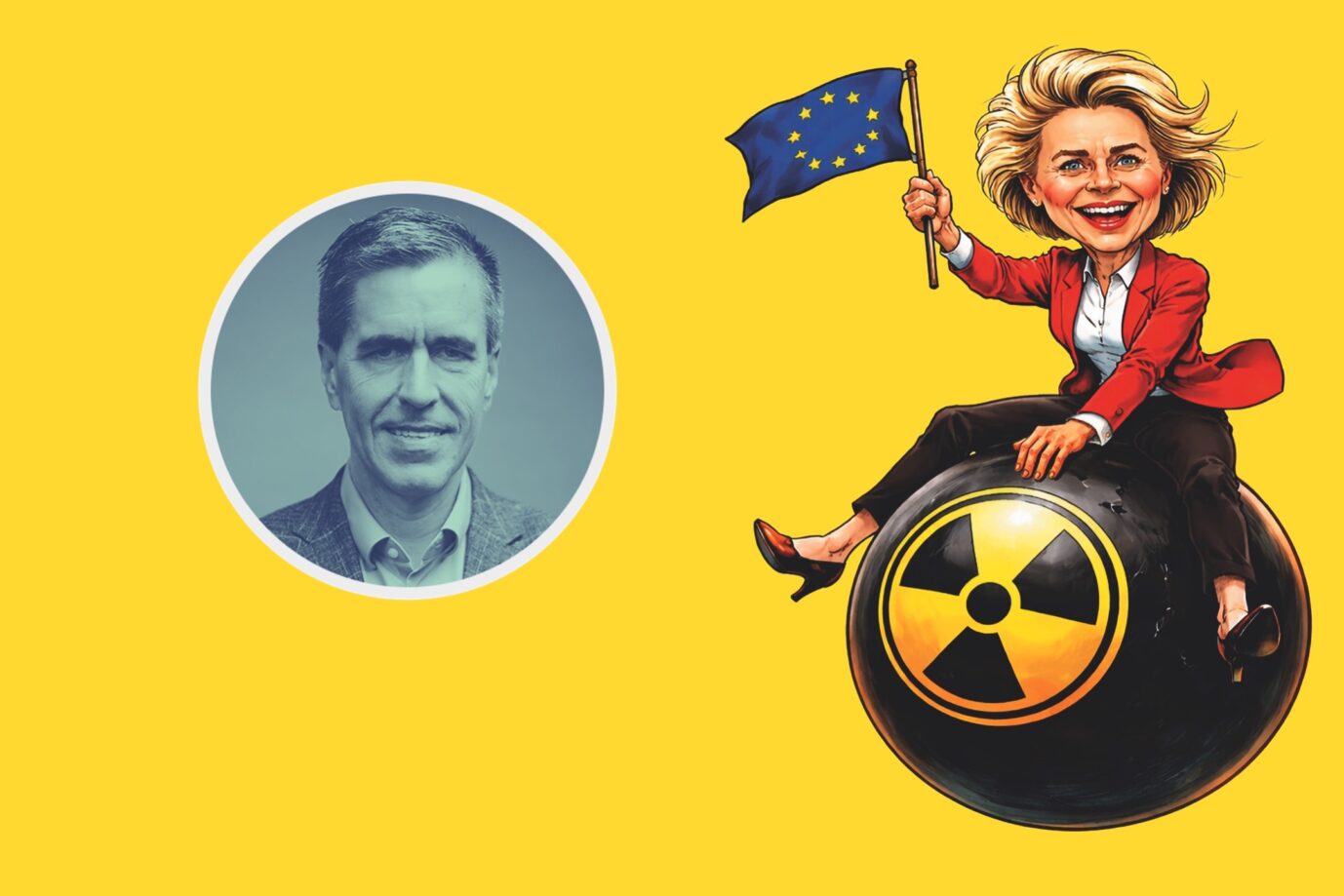BERLIN. Die Schleswig-Holsteins Bildungsministerin Karin Prien (CDU) hat sich dafür ausgesprochen, die Wirtschaftsmigration nach Deutschland einzuschränken. Zwar habe die Bundesrepublik eine historische Verantwortung für politisch verfolgte Menschen und solle diese aufnehmen, sagte sie der Nachrichtenagentur dpa. „Aber wir müssen uns auch ehrlich machen, viele kommen nach Europa und besonders gerne nach Deutschland, weil sie ein besseres Leben für sich und ihre Familie wollen. Und da müssen wir zu einer Reduzierung der Zahlen kommen“, fügte die Vize-Vorsitzende der Christdemokraten hinzu.
Die starke Zuwanderung von Asylbewerbern könne Deutschland auf Dauer nicht bewältigen, nicht in den Kommunen, Schulen und Kitas, äußerte Prien. Zur Aufnahme von ukrainischen Kriegsflüchtlingen habe sich Deutschland jedoch „sehr klar bekannt“ – wie die CDU-Politikerin sagte, seien das mehr als eine Millionen Ukrainer innerhalb eines Jahres gewesen, die eingereist seien.

Prien: Besser Außengrenzen schützen als Binnengrenzen
Die Asyl-Vorschläge der Europäischen Union müßten mit „Tempo“ umgesetzt werden – das ist der sogenannte Migrationspakt. Damit die Aufnahme von Asylbewerbern und Flüchtlingen weiterhin gesellschaftlich akzeptiert werde, „werden wir wirksame Möglichkeiten zur Begrenzung finden müssen“, betonte Prin. Dafür sei ihr jeder Schutz der Außengrenzen lieber als weitere Maßnahmen im Inland. Für qualifizierte ausländische Fachkräfte müsse die Bundesrepublik aber weiterhin offenbleiben. „Das ist der Spagat, den wir in Deutschland schaffen müssen.“
„Alle demokratischen Parteien“ sollten ihre Zuwanderungskonzepte überprüfen, erklärte Prien weiter, denn das Thema beschäftige sehr viele Deutsche. „Aber nicht, um den AfD-Wählern zu gefallen, sondern, weil wir Lösungen brauchen.“ Wegen des großen Vertrauensverlustes in das demokratische System müßten sich alle Parteien „größte Sorge machen und nicht aufeinanderzeigen“. Im Juli hatte eine Studie des Rheingold-Meinungsforschungsinstituts gezeigt, daß zwei von drei der Befragten der Politik nicht vertrauten und 73 Prozent „sehr wütend“ seien, wie in Deutschland politisch gehandelt werde. (ca)