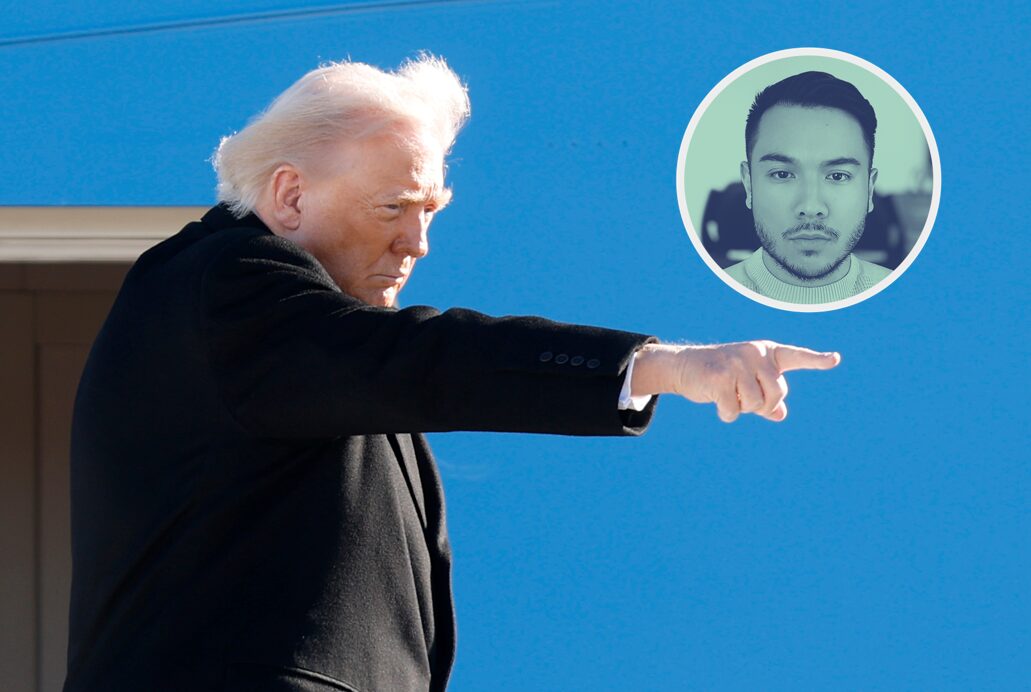BRÜSSEL. Die EU-Kommission hat mit ihrem Vorhaben einer anlaßlosen Überwachung von Messengerdiensten eine schwere Niederlage erlitten. Die dänische Ratspräsidentschaft hat die sogenannte „Chatkontrolle“ aus den Gesetzesplänen zum Kampf gegen Darstellungen sexuellen Mißbrauchs gestrichen (die JF berichtete bereits).
Der Vorschlag der Kommission sah vor, daß Anbieter wie WhatsApp, Signal oder Facebook künftig private Nachrichten ihrer Nutzer automatisch durchsuchen müßten, angeblich um Mißbrauchsdarstellungen aufzuspüren.
Datenschützer sprachen von einem „Generalverdacht gegen alle Bürger“, während selbst liberale EU-Abgeordnete vor einem „Ende der digitalen Privatsphäre“ warnten. Insbesondere Deutschland hatte sich gegen die Einführung der Chatkontrolle gestellt. Zwar gab es Befürworter in Teilen der schwarz-roten Regierungskoalition, doch Bundesjustizministerin Stefanie Hubig (SPD) lehnte eine Zustimmung ab. Auch Österreich hatte sich im EU-Rat gegen das Vorhaben ausgesprochen.
Freiwilligkeit statt Chatkontrolle
Der dänische Justizminister Peter Hummelgaard begründete den Rückzug der Pläne damit, daß andernfalls keine Einigung auf neue EU-Regeln möglich gewesen wäre. „Es bestand die ernsthafte Gefahr, daß wir ohne rechtliche Grundlage dastehen würden“, erklärte er. Statt einer verpflichtenden Überwachung sollen Onlineplattformen weiterhin freiwillig Systeme zur Erkennung einschlägiger Inhalte einsetzen dürfen.
Eine Pflicht zum Ausspähen privater Kommunikation soll es nicht geben. Besonders Messenger mit Ende-zu-Ende-Verschlüsselung behalten damit ihre Unabhängigkeit – Behörden haben keinen Zugriff auf die Inhalte der Nutzer. Hummelgaard lamentierte, daß der Kompromiß „nicht die Offensive gegen Kindesmißbrauch“ sei, die er sich gewünscht habe. Dennoch sei die Einigung „besser als ein echter Rückschritt“. (rr)