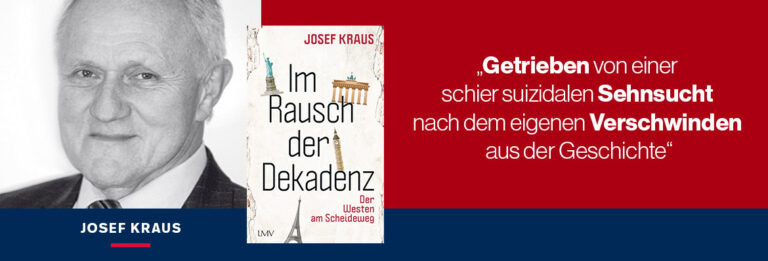ANJAR. Gerade mal drei Kilometer sind es von der 2.400-Einwohner-Kleinstadt im Ost-Libanon bis zur syrischen Grenze. Die dumpfen Explosionen, die nachts aus der Ferne zu hören sind, scheinen die Nachfahren christlich-armenischer Flüchtlinge aus der Türkei nicht zu beunruhigen. Hier, ein wenig abseits der Hauptstraße zwischen Beirut und Damaskus haben sie sich ihre kleine Ruhe-Oase geschaffen. Die Außenwände der örtlichen „Schule der Friedenserziehung“ sind mit bunten Parolen geschmückt: „Demokratie“, „Menschenrechte“, „Konfliktlösung“. Im edlen Straßenlokal der Hauptstraße speisen auch wohlhabende Muslime aus den Nachbarsiedlungen. Man lebt getrennt – doch Respekt sei wichtig, so die Gesprächspartner. Dass der Bürgerkrieg aus dem großen Nachbarland übergreifen könnte, glaubt hier niemand.
Früher war der deutsche Paß eine Sicherheits-Garantie
Doch der Schein trügt. Trotz einer Absprache mit den Anwohnern, die nichts dagegen einzuwenden hattten, wenn jemand die Nacht unter freiem Himmel verbringt, hat sich am nächsten Morgen ein Kommando aus einem Dutzend Lokalpolizisten und Militärgeheimdienst eingefunden. Ziemlich rabiat werden mir Plastik-Handfesseln hinter dem Rücken angelegt. Eine halbe Stunde dauert die Autofahrt ins Militärlager.
Man entkleidet mich, durchwühlt die Sachen – und sperrt mich in einen Soldaten-Schlafraum. In den Verhören klärt sich das Problem: Die Armee vermutet, einen deutschen Syrien-Dschihadisten inhaftiert zu haben. Von rund 170 muslimischen Männern aus der Bundesrepublik geht Verfassungsschutz-Präsident Maaßen mittlerweile aus, die sich dem „Heiligen Krieg“ in der Levante verschrieben hätten. Daß ich nicht dazugehöre, hat sich nach guten vier Stunden geklärt. Im geräumigen Geländewagen eines Mannes, der sich als „General“ vorstellt, geht es zurück nach Beirut. „Diese Gegend ist nicht gut für Dich“, meint er scherzend in Bezug auf die angespannte Bekaa-Ebene.
Europäische Touristen gelten als letzte Hoffnung
Von den gut 30.000 deutschen Touristen, die noch 2011 im Zedernstaat ihren Urlaub verbracht haben, kann der Libanon mittlerweile nur noch träumen. Die zweimonatige Geiselhaft zweier Piloten der Turkish Airlines, die unlängst ihr Ende fand, nachdem syrische Rebellen neun gefangenen schiitischen Pilgern die Rückkehr in den Libanon gestatteten, schreckt dazu nicht nur Reisende aus der Türkei, sondern auch aus den arabischen Golfstaaten ab. Sie gelten schiitischen Milizen als Faustpfand zur Freipressung weiterer Angehöriger aus den Händen sunnitischer Krieger in Syrien. Infolge dessen haben sich Hotels und Bars zunehmend geleert, die Angehörigen von Staaten strikter Islam-Gesetzgebung bisher als Rückzugsort galten, um Alkohol zu trinken oder sich mit Freudenmädchen zu vergnügen. Noch im vergangenen Jahr hatte Tourismusminister Fadi Abboud auf der Berliner ITB unter dem Motto „Überraschend anders: Der neue Libanon“ um verstärkten Fremdenverkehr aus Deutschland geworben, und verkündet: „Im Libanon hatten wir den Arabischen Frühling bereits vor 30 Jahren.“
Tatsächlich steht das Land im Zuge der syrischen Flüchtlingsströme vor einer Bewährungsprobe, wie sie zuletzt die Migration von Palästinensern nach der Staatsgründung Israels 1948 dargestellt hat. Und doch: Mit ein wenig Umsicht lassen sich als deutscher Reisender problemlos in der kleinen Mittelmeer-Republik interessante kulturelle Ausflüge vollziehen.
Kaiser Wilhelm rettete Kulturgut
In die antiken Tempelruinen von Baalbek zum Beispiel. Die Anlage im Nordosten präsentiert einige der größten und besterhaltenen Bauwerke kaiserzeitlich-römischer Architektur im Nahen Osten. Erst im zweiten oder dritten Jahrhundert nach Christus errichtet, ging die Stadt etwa drei Jahrhunderte später aus unbekannten Gründen unter.
Es war Kaiser Wilhelm II., der bei einem Ausritt am 11. November 1898 mit seiner Gattin Auguste Victoria tiefe Begeisterung für den versunkenen Kulturschatz empfand. Er veranlaßte eine groß angelegte Ausgrabungsaktion, welche unter Leitung des deutschen Archäologen Professor Puchstein von 1900 bis 1905 vollzogen wurde.
Später setzten französische und libanesische Forscher die Arbeiten fort. Die kaiserliche Gedenktafel am besonders ansehnlichen Bacchus-Tempel wurde 1918 durch britische Militärs entfernt – und erst Anfang der 70er Jahre auf Initiative der deutschen Botschaft neu aufgehängt. Neben dem Land Brandenburg traten auch Firmen wie die Commerzbank, Siemens oder die Lufthansa als Sponsoren für das heutige Museum auf.
Die letzten Patrioten setzen auf Naturdenkmäler
Auf der anderen Seite des Libanongebirges, 20 Kilometer nordöstlich von Beirut, war es der Deutsch-Libanese Dr. Nabil Haddad, der sich im Auftrage der Regierung der weltberühmten Jeita-Grotten annahm. 1836 durch einen amerikanischen Missionar entdeckt, gilt die 7,8 Kilometer lange Höhle als eine der großartigsten Naturattraktionen Libanons. Der promovierte Maschinenbauer ließ die durch den Bürgerkrieg zerstörte Außenanlage wieder aufbauen – inklusive einer Gondelbahn österreichischer Produktion.
Mit hohen Eintrittsgeldern und einem knallharten Fotografierverbot gelang eine finanziell erfolgreiche Vermarktung. Bei 16 Grad Celsius und 82 Prozent Luftfeuchtigkeit kann der Besucher auf Booten einen kleinen Abstecher auf dem unterirdischen Nahr el-Kalb („Hundefluß“) absolvieren. Die künstliche Beleuchtung der Tropfsteine und die Ruhe der Isolation vermitteln einen Hauch von Romantik im ansonsten wilden Orient.
Um den Schutz der verbliebenen Zedern kümmerte sich in Aris, rund 2.000 Meter hoch, im Herzen Libanons, die maronitische Kirche. In Sichtweite des Bergkamms, wo sich stets die Nebelausläufer brechen, ließen die Christen ein letztes Stück Wald im ansonsten kargen Grasland ummauern – und bieten das gesicherte Gelände heute zur Besichtigung. Von 2.000 bis 3.000 Jahre alten Bäumen sprechen die Anwohner – von rund 1.000 Jahren die westliche Literatur. Ansehnlich sind die bis zu 30 Meter hohen Riesen in jedem Fall. Aus den Geschichtsbüchern heißt es, einst sei die gesamte Region von ihnen bewaldet gewesen – bis die Phönizier zum Bau ihrer legendären Schiffe den Großteil abholzten. Das Nationalsymbol dieses bedrohten Landes, verewigt auf der Staatsflagge, erscheint wie das letzte Aufbäumen trotziger Beständigkeit.