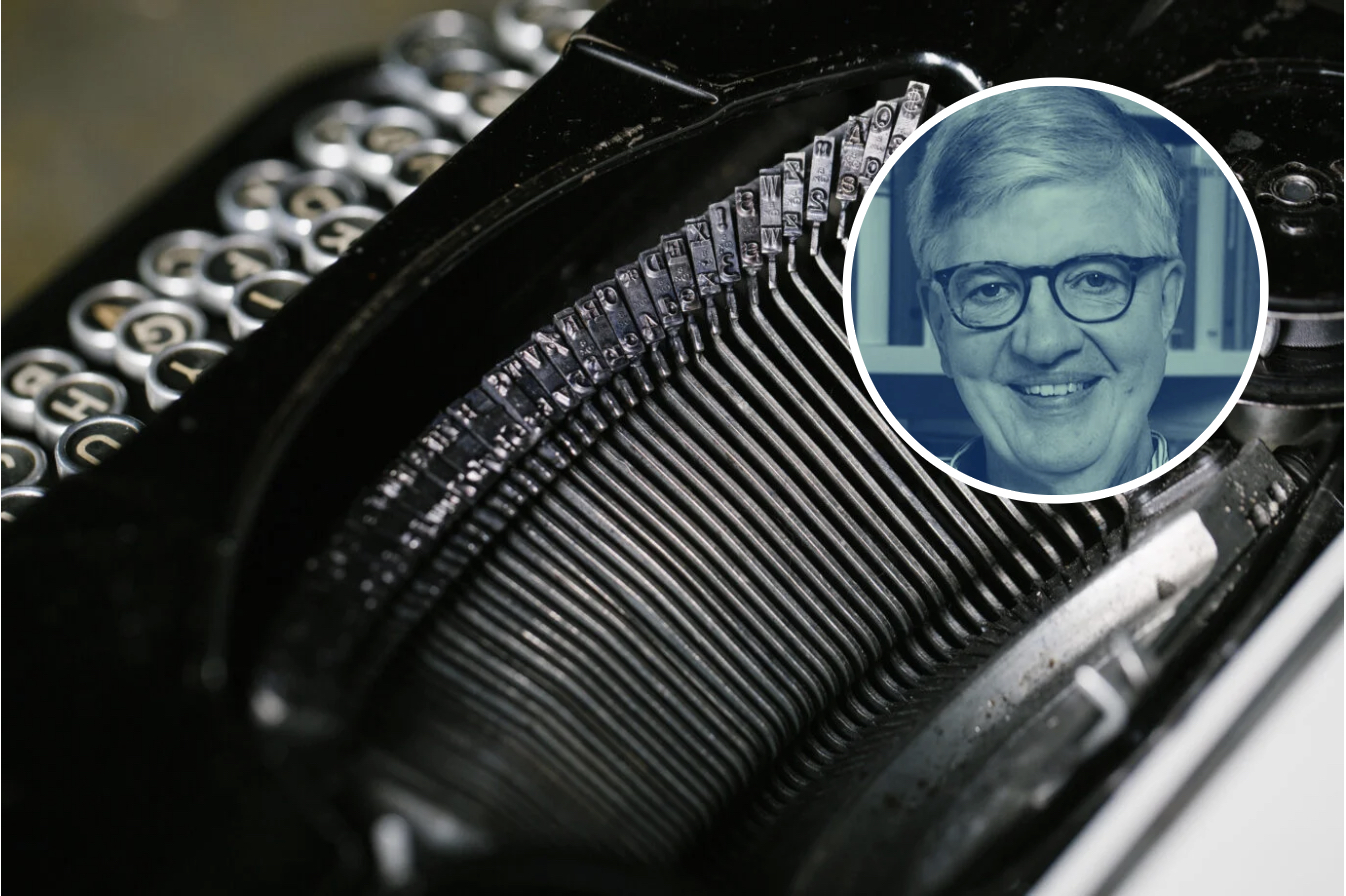Wie schreibt man die Kulturgeschichte einer Nation, die, nach den Worten ihres amtierenden Staatsoberhaupts – Emmanuel Macron –, gar keine spezifische Kultur besitzt? Der Historiker Volker Reinhardt hat sich entschlossen, die Aufgabe dadurch zu lösen, daß er an Stelle eines Monumentalgemäldes ein Mosaik setzt, dessen Elemente die Werke bedeutender Persönlichkeiten bilden.
So ist ein Buch entstanden, das den Leser vom Chanson de Roland, in dem zum ersten Mal die Formel „France dolce“, also das „schöne“, aber auch das „milde“ Frankreich, auftaucht, bis zu den Gebäuden der „Historischen Achse“ führt, die Macrons Vorgänger François Mitterrand in Paris hat ziehen lassen, und die die Place de la Concorde mit der „Grande Arche de la Fraternité“, dem „Großen Bogen der Brüderlichkeit“, verbindet.
Reinhardt sieht hier zu Recht den Versuch des Sozialisten, sich in die Kontinuität einer Staatsarchitektur zu stellen, die vom Versailles des „Sonnenkönigs“ Ludwig XIV. über die Repräsentationsbauten Napoleons bis in die Gegenwart fortgesetzt wird, um die „weltumspannende und weltbeglückende Kulturmission“ Frankreichs in Szene zu setzen. Allerdings kann der Autor nicht recht nachvollziehbar machen, wie die Vorstellung eines solchen Kontinuums entstehen und bis in die Gegenwart Glauben finden konnte.
Ein Mosaik ohne Mörtel
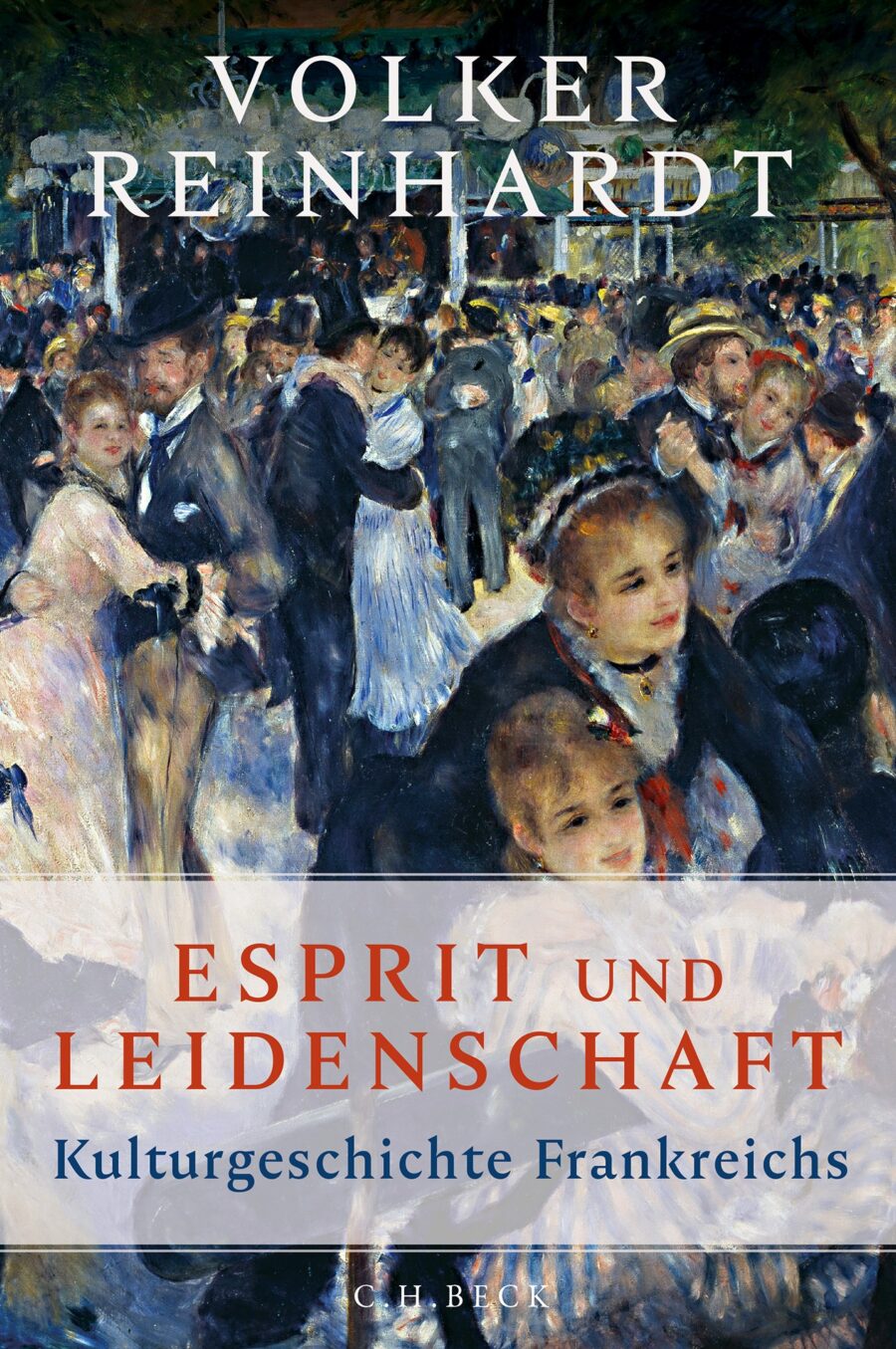
Eine Ursache dafür ist das von Reinhardt gewählte Verfahren, um die bunten Mosaiksteine nebeneinanderzustellen. Selbstverständlich hat es seinen Reiz, in kurzen Kapiteln möglichst viele verschiedene Autoren, Philosophen, Maler, Architekten, Komponisten, Schriftsteller und Wissenschaftler präsentiert zu bekommen: von Abt Suger, der Saint-Dénis, die Grablege der französischen Könige, nach seiner „Theologie des Lichts“ erbauen ließ, über Chrétien de Troyes und den Minnesang, die Ideen eines Rabelais, eines Montaigne, Descartes oder Pascal, bis hin zu den Arbeiten der Existentialisten Sartre und Camus, die Werke eines Racine und eines Corneille, eines Rameau und eines Debussy, eines David und der großen Impressionisten.
Aber es geht an mehr als einer Stelle – man möchte sagen: zwangsläufig – der Zusammenhang verloren. Das hat auch damit zu tun, daß die politische Geschichte bei Reinhardt nur am Rande vorkommt, oder auf ein paar Hinweise – die mühsame Durchsetzung der Monarchie im Mittelalter, die Bedeutung des Bertrand du Guesclin und der Jeanne d’Arc, Richelieus, des Absolutismus und Robespierres – beschränkt wird. Hier wird offenbar ein Maß an Kenntnissen vorausgesetzt, das vielen fehlen dürfte.
Seine Verlierer der Geschichte bleiben unberücksichtigt
Doch schwerer als das wiegen zwei andere Schwächen: Gewichtung und Wertung. Was die Gewichtung angeht, wird man bis zum Einschnitt, der mit der Revolution von 1789 gegeben war, kaum Einwände erheben müssen, Reinhardt bewegt sich in einem konsensfähigen Rahmen. Aber das sieht danach anders aus. So ist nicht nur fragwürdig, ob man die Kulturgeschichte Frankreichs im 19. Jahrhundert behandeln kann, ohne wenigstens punktuell auf die gegenrevolutionäre Linie zu sprechen zu kommen, die Ideen der „Frühsozialisten“ zu erwähnen oder den außerordentlichen Einfluß eines Kopfes wie Ernest Renan.
Man findet auch weder etwas zu Auguste Comte und Émile Durkheim, die an der Wiege der Soziologie standen, noch zum ersten Schulhaupt der „Lebensphilosophie“ Henri Bergson, und ein Autor wie Maurice Barrès wird mit einem Halbsatz erledigt, während Brigitte Bardot immerhin sieben Zeilen bekommt, ohne Verweis auf ihre faschistoiden Anschauungen in reiferen Jahren. Der Verdacht, daß das kein Zufall ist – etwa dem begrenzten Raum geschuldet – erhärtet sich, wenn im Fortgang auch alle anderen bêtes noires des Geisteslebens fehlen: von Charles Péguy über Pierre Drieu la Rochelle bis zu Louis Férdinand Céline und Henry de Montherlant, an deren Einfluß im Ernst kein Zweifel bestehen kann.
Sie gehören alle auf die Seite jenes Frankreich, das für Reinhardt als Verlierer aus der Geschichte hervorgegangen ist, und werden dem Vergessen überantwortet. Das Vergessen spielt allerdings auch eine Rolle, wenn es um die problematischen Seite der Entwicklung geht, die Reinhardt mit solchem Wohlwollen nachzeichnet.
Die blinden Flecken der Aufklärung
Womit man zu den Maßstäben der Bewertung kommt. Wie problematisch die sind, ist schon am Fehlen jedes Hinweises auf die Dimension des jakobinischen Terrors abzulesen, der mit einer Art „innerfranzösischem Völkermord“ (Reynald Sécher) einherging. Es gibt auch keine Auseinandersetzung mit der notorischen Kriegstreiberei wie dem Revanchismus der Radikalen der Dritten Republik, der Korruption als ständigem Begleiter des parlamentarischen Systems, oder Sartres Sympathie für den Maoismus, dann die Mörder der Roten Armee Fraktion.
So steht zuletzt alles, was auf den „Roten Mai“ 1968 zuläuft – samt „Sexueller Befreiung“, Emanzipation der Frau und dem widerwärtigen Rassismus eines Frantz Fanon – in einem milden Licht, und nirgends keimt der Zweifel, welche fatalen Folgen der Siegeszug der „French Theory“ hat oder die Skepsis gegenüber den „Ideen von 1789“, die die Grande Nation aus der Geschichte verschwinden lassen könnten, nachdem sich der Traum von der universalen Menschheitsrepublik als Karikatur im Multikulturalismus der Gegenwart realisiert.