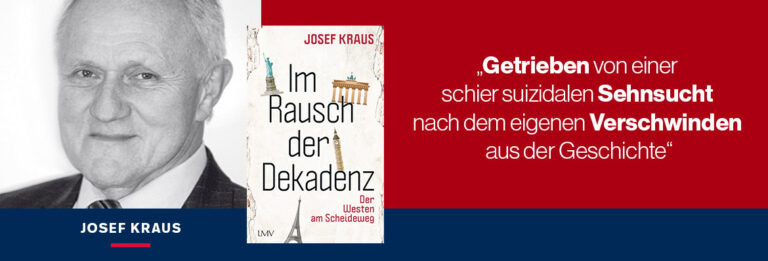Vor einiger Zeit meldete Bild: „Deutsche Innenstädte immer ähnlicher“. Die Meldung bezog sich auf eine Studie der Immobilienfirma Brockhoff & Partner, in der 528 Fußgängerzonen in 308 Städten untersucht wurden. Große Filialketten verdrängen danach immer mehr den regionalen Einzelhandel aus den Innenstädten, zunehmend bestimmt das standardisierte „Outfit“ der großen Ketten von Burger King über Tchibo, New Yorker, Schlecker bis hin zu Thalia das Erscheinungsbild der Fußgängerzonen. Die globalisierte Ökonomie hat die Innenstädte erreicht. Egal, in welcher Stadt man sich befindet, die „Shopping“-Meilen sind überall gleich. Kennt man eine Innenstadt, kennt man alle. Überall das gleiche Angebot, überall die gleichen verbraucherfreundlichen Glaspaläste und die funktionale Rechteckarchitektur. Die Städte werden unidentifizierbar, weil sie zunehmend gleich aussehen. Man bewegt sich in einer „global city“, die am Rhein genauso aussieht wie an der Weichsel oder am Mississippi. Die Globalisierung bügelt nicht nur die Mentalitäten der Weltbürger gleich, sie bemächtigt sich auch des Stadtbildes, das – in früheren Zeiten zumindest – Ausdruck von nationalen, regionalen und kulturellen Unterschieden und Eigenheiten war. Traditionell hatten die Städte in Europa und ganz besonders in Deutschland immer ein eigenes Gesicht. Der die Stadt umfassende Kulturraum prägte deren Erscheinungsbild. Nur noch wenige „Monumente“ aus alter Zeit, die heute von den immer gleichen Park- und Kaufhäusern umzingelt sind, zeugen davon. Gerade in Deutschland hat sich im ausgehenden Mittelalter eine einzigartige „städtische Kultur“ herausgebildet. Der Historiker Hartmut Bookmann schreibt dazu: „Deutschland war am Ende des Mittelalters eine durch und durch städtisch geprägte Welt. Auch wenn nur bestenfalls ein Fünftel der Bevölkerung in Städten lebte, auch wenn keine dieser Städte mehr als fünfzigtausend Einwohner zählte, waren es doch die Städte und nicht die Burgen oder Klöster auf dem Lande, in denen sich die Wege der Waren und die Bahnen der Gedanken kreuzten.“ Der süddeutsche Städtebund und speziell die Hanse geben von dieser Entwicklung Zeugnis. Insbesondere die freien Reichsstädte gaben den Untertanen Freiheiten („Stadtluft macht frei“), in den Städten bildete sich eine bürgerliche Kultur des Bürger- und Gewerbefleißes. In den deutschen Städten des Mittelalters bildeten sich zuerst die Prinzipien einer kommunalen Selbstverwaltung aus, noch Freiherr von Stein bezog sich bei seiner Reform der preußischen Städteordnung von 1808 auf die mittelalterliche Freiheit der „selbständigen Gemeinde“. Nach Max Weber, dem Altmeister der Soziologie, sind die freien Bürgerstädte ein Spezifikum des Abendlandes, während sich die Städte im Orient, wo sie sich als erstes entwickelt haben (Jericho gilt als älteste Stadt der Welt), nie von der feudalen oder königlichen Herrschaft haben befreien können. Nach Weber ist im ökonomischen Sinne eine Stadt dann gegeben, „wenn die ortsansässige Bevölkerung einen ökonomisch wesentlichen Teil ihres Alltagsbedarfs auf dem örtlichen Markt befriedigt, und zwar zu einem wesentlichen Teil durch Erzeugnisse, welche die Ortsansässigen und die Bevölkerung des nächsten Umlandes für den Absatz auf dem Markt erzeugt oder sonst erworben hat“. Kennt man eine Innenstadt, kennt man alle. Überall das gleiche Angebot, überall die gleichen verbraucherfreundlichen Glaspaläste und die funktionale Rechteckarchitektur. Die Städte werden unidentifizierbar, weil sie zunehmend gleich aussehen. Aus dieser dominanten Stellung des Marktes resultieren auch die Freiheitsrechte der Stadtbürger. Wie Hans Paul Bahrdt in seinem Klassiker „Die moderne Großstadt“ dargelegt hat, impliziert das marktvermittelte Stadtleben eine „unvollständige Integration“ des Bürgers. Die Logik des Marktes sprengt die Fesseln der vollständigen sozialen Integration des Feudalsystems, da beim Kauf oder Verkauf auf dem Markt der Bürger kurzfristige, funktional spezifische Kontakte zu anderen Personen aufnimmt, ohne als geschlossene soziale Gruppe auftreten zu müssen. Es kommt, wie Elisabeth Pfeil in ihrer „Soziologie der Großstadt“ schrieb, zu „Teilbegegnungen“, zu „erlebnisgleichgültigen Spezialbeziehungen“. Der Stadtraum als Markt sprengte das geschlossene Feudalsystem und ermöglichte bürgerliche Freiheiten. Wie es grundsätzlich zu Stadtbildungen kam, darüber streiten noch heute die Historiker. Stefan Breuer behauptet, daß sich die Städte aus „Zeremonialzentren“ gebildet haben, also aus einfachen Zentralplätzen, an denen religiöse Kulte der umliegenden Bevölkerung gefeiert wurden und die so zu Zentren der politischen und frühen staatlichen Herrschaft herausgeformt wurden. An diesen Zentren bildete sich ein Herrschaftshaushalt, ein „Oikos“, wobei sich in der unmittelbaren Umgebung Subzentren bildeten, weil die Bevölkerung in die zunehmend arbeitsteilige Produktion für „Prestigegüter“ des Herrschaftshaushaltes einbezogen wurde. Wie der Soziologe Bernhard Schäfers schreibt, bildete sich das Prestigegütersystem in der Zweiteilung von Tempel und Palast, von „bürokratisch-redistributiven und religiösen Aufgaben“ aus, wobei der Einfluß des Palastes nach und nach größer wurde als der des Tempels und seiner Priester. Die ersten Städte in Deutschland und Mitteleuropa waren römischen Ursprungs. Nach der Völkerwanderung brach das städtische Leben weitgehend zusammen, um ab dem Jahre 800 wieder aufzublühen. Ausgangspunkt der Stadtbildung waren sogenannte „Villikationen“, Herrenhöfe mit den dazugehörigen in Feudalabhängigkeit befindlichen Bauernhöfen, die einen „Oikosverband“ bildeten. Solche Villikationen mit einem großen Versorgungsanspruch der Herren wie Pfalzen oder Klöster bildeten nach und nach marktähnliche Strukturen aus und führten zur Stadtbildung. Typisch für diese Entwicklung sind Goslar (als Kaiserpfalzstadt), Würzburg (als Herzogspfalzstadt), Paderborn und Münster (als Bischofsstädte), Fulda und Quedlinburg (als Kloster oder Stiftsstadt). Mit wachsender Bevölkerungsdichte in Deutschland (von 5 auf 14 Personen pro Quadratkilometer von 800 bis 1150) wuchs die Zahl der Städte von 40 auf 200 in diesem Zeitraum. Um 1350 gab es über 3.000 Städte, in denen etwa zehn Prozent der Bevölkerung lebten. Mit der Entstehung der Hanse in Norddeutschland und des süddeutschen Städtebundes um 1350 ist der Höhepunkt der mittelalterlichen Stadtentwicklung erreicht. Was macht den besonderen Reiz der mitteleuropäisch älteren Städte aus? Es ist die Kombination von Redundanz und Varietät. Die Städte verfügen generell über eine topographische Grundstruktur, etwa einen zentralen Marktplatz, von dem aus strahlenförmig die Hauptstraßen ausgehen, die wieder durch Nebenstraßen miteinander verbunden sind, oder die Häuser gruppieren sich ringförmig um einen Berg mit Burg, wobei in einem ersten Ring die Patrizierhäuser lokalisiert sind, in einem zweiten Ring die Bürgerhäuser und unten im Tal die einfacheren Häuser der Ackerbürger und Tagelöhner, so daß gleichsam von oben nach unten die Sozialstruktur der Stadt architektonisch dokumentiert wird (beispielhaft dafür ist Marburg an der Lahn). Auch bei den Häusern finden wir diese spezifische Kombination von Redundanz und Varietät, indem also beispielsweise bei den Fachwerkhäusern eine bestimmte Grundstruktur konstant gesetzt wird, aber innerhalb dieser Vorgaben (etwa Grundstücksgröße an der Straße) eine variable Formensprache zum Ausdruck kommt, die einzigartig ist. Diese Verschränkung von Einheitlichkeit und Unterschiedlichkeit wird sofort ersichtlich, wenn man sich die Straßenzüge von mittelalterlichen Städten wie Celle, Goslar oder Quedlinburg genauer anschaut, jedes Haus ist anders und doch kopiert es eine universelle Grundstruktur. Der Zweite Weltkrieg stellte sich für die deutschen Städte als reine Katastrophe dar. Im alliierten Bombenhagel wurde ihre historische und kulturelle Substanz fast komplett ausradiert. Militärisch gesehen war diese Operation völlig sinnlos, es ging – neben der vermeintlichen „Zermürbung“ der Zivilbevölkerung – darum, Deutschland von seiner Geschichte zu „befreien“. Der für Deutschland von den Alliierten konzipierte Neubeginn brauchte keine Zeugen der Vergangenheit. Nach dem Krieg ging der Raubbau an der historischen Substanz der deutschen Städte weiter. Im Schnellverfahren wurden viele Städte wieder aufgebaut, Funktionalität stand dabei im Vordergrund. Auf die alten Stadtbilder wurde dabei wenig Rücksicht genommen. Früh, jedoch ohne große praktische Folgen, ist die Misere erkannt worden. Bereits 1971 schrieb der Architekt Max Bächer: „Häuserfronten, die in einem Wachstumsprozeß von Jahrzehnten und Jahrhunderten entstanden waren und der Straße ihre Unverwechselbarkeit gegeben hatten, werden liquidiert und durch die Monotonie einer einheitlichen Konsumarchitektur ersetzt, deren Aussagekraft sich nach Abschreibungsgrundsätzen orientiert. Wo früher ein unerschöpfliches Repertoire verschiedenster Formen, Türmchen, Erker, Balkone und Portale ein vielfältiges und lebendiges plastisches Bild ergaben, herrscht heute die Armut einer Baulinienarchitektur, die alle Erhebungen, Auskragungen und Vorsprünge in den Straßenraum als mögliche Verkehrshindernisse betrachtet und in die Fläche bügelt.“ In einem Fachwerkhaus aus dem 16. Jahrhundert ist ein Döner-Imbiß installiert, in einem gotischen Fachwerkhaus residiert ein arabischer Händler mit einem Wasserpfeifengeschäft. Über dem Eingang steht: „Wer auf Gott vertraut, der hat gut gebaut.“ In den Kleinstädten, die nicht dem Bombenhagel zum Opfer gefallen sind, finden wir indes noch viel historische Bausubstanz. Doch gerade diese Städte sind heute massiv bedroht. Eine Stadt wie Quedlinburg mit ihren 1.200 Fachwerkhäusern und knapp 23.000 Einwohnern, von denen jeder vierte arbeitslos ist, ist mit der Aufgabe der Sanierung der Altstadt völlig überfordert. So sehr sich die Deutsche Stiftung Denkmalschutz auch bemüht, der ganze Schloßberg droht einzustürzen. Fünfzehn Millionen Euro wären erforderlich, um dieses einmalige, von der Unesco zum Weltkulturerbe erklärte Kleinod zu retten, lediglich zwei Millionen stehen dafür von der Europäischen Union, dem Bund und dem Land zur Verfügung. Gefahr droht den historischen Zentren der Kleinstädte auch noch von anderer Seite. Da die deutsche Bevölkerung das Wohnen in modernen Vorstädten vorzieht, sind die mittelalterlichen Stadtkerne mit Leerständen konfrontiert oder werden zunehmend von Migranten bevölkert. Der Altstadt-Flaneur erfährt so permanente „kognitive Dissonanz“: In einem Fachwerkhaus aus dem 16. Jahrhundert ist ein Döner-Imbiß installiert, in einem gotischen Fachwerkhaus residiert ein arabischer Händler mit einem Wasserpfeifengeschäft. Auf dem Querbalken über dem Eingang steht in altdeutscher Schrift: „Wer auf Gott vertraut, der hat gut gebaut.“ Der Gesamteindruck solcher „multikulturell“ genutzter Häuser ist dahin, die Häuser haben ihr Gesicht verloren. Besondere Probleme bereitet die „Stadtsanierung“ im Osten Deutschlands. Die Bevölkerungsschrumpfung macht auch den Innenstädten zu schaffen. Allein in Leipzig, das von über 700.000 Einwohner in alten DDR-Zeiten auf heute 500.000 Einwohner geschrumpft ist, stehen über 40.000 Wohnungen leer. Über 2.500 Altbauten aus der Gründerzeit, reich drapiert im Stil der Spätgotik, Renaissance oder Jugendstil, stehen vor dem Abriß. Der Abriß dieser historischen Bausubstanz wird vom Staat noch gefördert: 60 Euro pro Quadratmeter wird aus dem Fördertopf „Stadtumbau Ost“ gezahlt. Bei tatsächlichen Abrißkosten von unter 40 Euro pro Quadratmeter macht man damit noch Gewinn, die Wohnungs- und Baugesellschaften sanieren nicht die Städte, sondern sich selbst durch Abriß. Immerhin, 12.500 Altbauten wurden alleine in Leipzig saniert. Doch der kontrollierte Abriß einzelner Häuser führt zu einer „Zahnlückenbebauung“, der Ensemble-Charakter geht unwiderruflich verloren. Die Prognose für unsere Städte ist nicht gut, auch wenn es einen Trend zurück zur Stadt in weiten Teilen der Bevölkerung gibt. Werden die Innenstädte zu reinen „Shopping-Centern“, zu Schaufenstern der globalisierten Ökonomie degradiert? Wird der Bevölkerungsrückgang einen fragwürdigen „Rückbau“ auch und gerade in der sozialen Infrastruktur nach sich ziehen? Wird die Stadt in ethnische und kulturelle Ghettos zerfallen? Wie auch immer: Eine Nation, die noch immer mit ihrer Geschichte hadert, wird auch mit dem historischen Erbe ihrer Städte nicht so verantwortungsvoll umgehen können, wie es notwendig wäre. Prof. Dr. Jost Bauch lehrt Soziologie an der Universität Konstanz. Auf dem Forum der JUNGEN FREIHEIT schrieb er zuletzt „Schuld ist immer die Gesellschaft“ (JF 16/07). Foto: Innenstadt von Ulm: Große Filialketten verdrängen den regionalen Einzelhandel aus den Innenstädten, zunehmend bestimmt das standardisierte „Outfit“ der großen Ketten das Erscheinungsbild der Fußgängerzonen