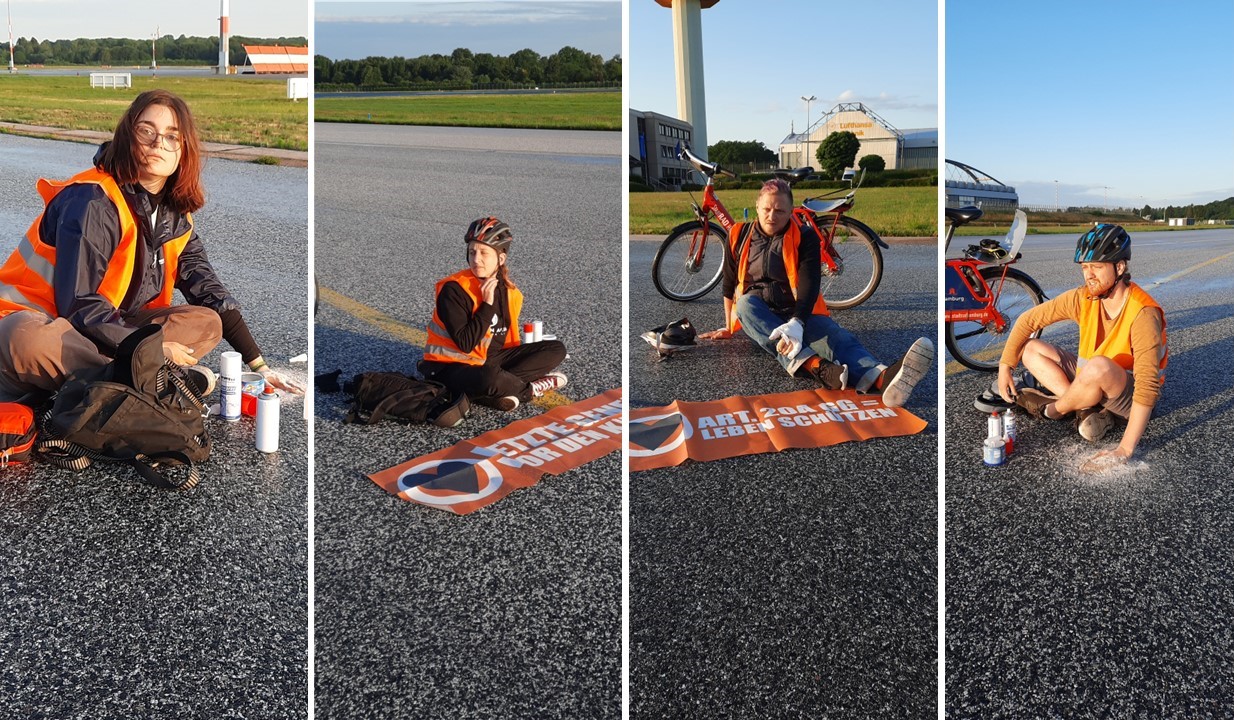HAMBURG/BERLIN. Die Hamburger Bürgerschaft hat mehrheitlich für die Einleitung eines AfD-Verbotsverfahrens gestimmt. Der gemeinsame Antrag von SPD und Grünen erhielt mit den Stimmen von SPD, Grünen und Linkspartei eine Mehrheit. Er fordert den Senat auf, eine Arbeitsgruppe zwischen Bund und Ländern zu bilden.
Das soll nach Willen der Unterstützer jedoch nur passieren, wenn das Verwaltungsgericht Köln im aktuellen Rechtsstreit mit der AfD die Einstufung der Partei als „gesichert rechtsextrem“ bestätigt. Sollte die Arbeitsgruppe aus Bund und Ländern es dann für geboten halten, ein Verbotsverfahren einzuleiten, sollte sich nach dem Willen der Antragsteller der Hamburger Senat dafür einsetzen, ein Verbotsverfahren durchzuführen – oder die Partei von der Parteienfinanzierung auszuschließen.
Grüne argumentiert für nüchterne Prüfung der Sachlage
SPD und Grüne begründeten den Antrag mit der existentiellen Gefahr, die von der AfD für den Staat ausgehe. Die Fraktionschefin der Hamburger Grünen, Sina Imhof, sagte, es sei „eine Zumutung“ und ein Alarmzeichen für die Demokratie, daß 77 Jahre nach Inkrafttreten des Grundgesetzes ein Parteiverbot diskutiert werden müsse. Ein Verbot dürfe nur als äußerste Notwehr eingesetzt werden, wenn eine Partei systematisch die Verfassung angreift. Verbote, um politische Gegner loszuwerden, seien „der Bankrott der Demokratie“, betonte Imhof. Sie appellierte daher an eine nüchterne Prüfung der Sachlage unter Zuhilfenahme von gerichtsfestem Beweismaterial.
Der Chef der SPD-Fraktion, Dirk Kienscherf, begründete den Antrag mit der Hamburgischen Verfassung. Dort heißt es, Menschenwürde müsse anerkannt, Freiheit gesichert und die Demokratie geschützt werden. Daraus folge notwendigerweise die Verpflichtung, jene zu bekämpfen, die dagegen vorgehen. Parteien könnten einander nicht verbieten, das sei – nach sorgfältiger Prüfung – Sache der Gerichte. Hamburg sollte ein Signal setzen, entsprechende Prüfungen einzuleiten.
Hamburgs Innensenator Andy Grote (SPD) zeigte sich ambivalent bei der Debatte: Der Selbstschutzmechanismus des Grundgesetzes erlaube ein Parteiverbot, wenn die Partei systematisch auf die Abschaffung der Verfassung hinarbeite. Ein Verbot sei dennoch „die absolute Ultima Ratio, gewissermaßen eine Notwehrmaßnahme“. Ob die AfD tatsächlich verboten werden sollte, sei „im Moment nicht sicher und seriös zu beantworten“, betonte der Sozialdemokrat. Die AfD entscheide alleine, ob sie die Schwelle zu einer solchen Maßnahme überschreite.
Hamburg ist kein Einzelfall
Die Hamburger AfD reagierte empört auf die Debatte. Fraktionschef Dirk Nockemann warf den Antragstellern vor: „Sie prüfen ein Verbotsverfahren gegen die stärkste Partei im Land und sichern sich dadurch Ihren Machterhalt. Die Demokratie ist Ihnen völlig egal.“ Den Chef der SPD-Fraktion, Kienscherf, bezeichnete er als Antidemokraten, den die Angst vor dem eigenen Machtverlust antreibe.
Hamburg ist nicht das erste Bundesland, das mit einem förmlichen Beschluß die eigene Landesregierung dazu auffordert, sich im Bund für ein Verbotsverfahren einzusetzen. Auch Bremen, Berlin und Schleswig-Holstein haben entsprechende Beschlüsse bereits getroffen. (st)