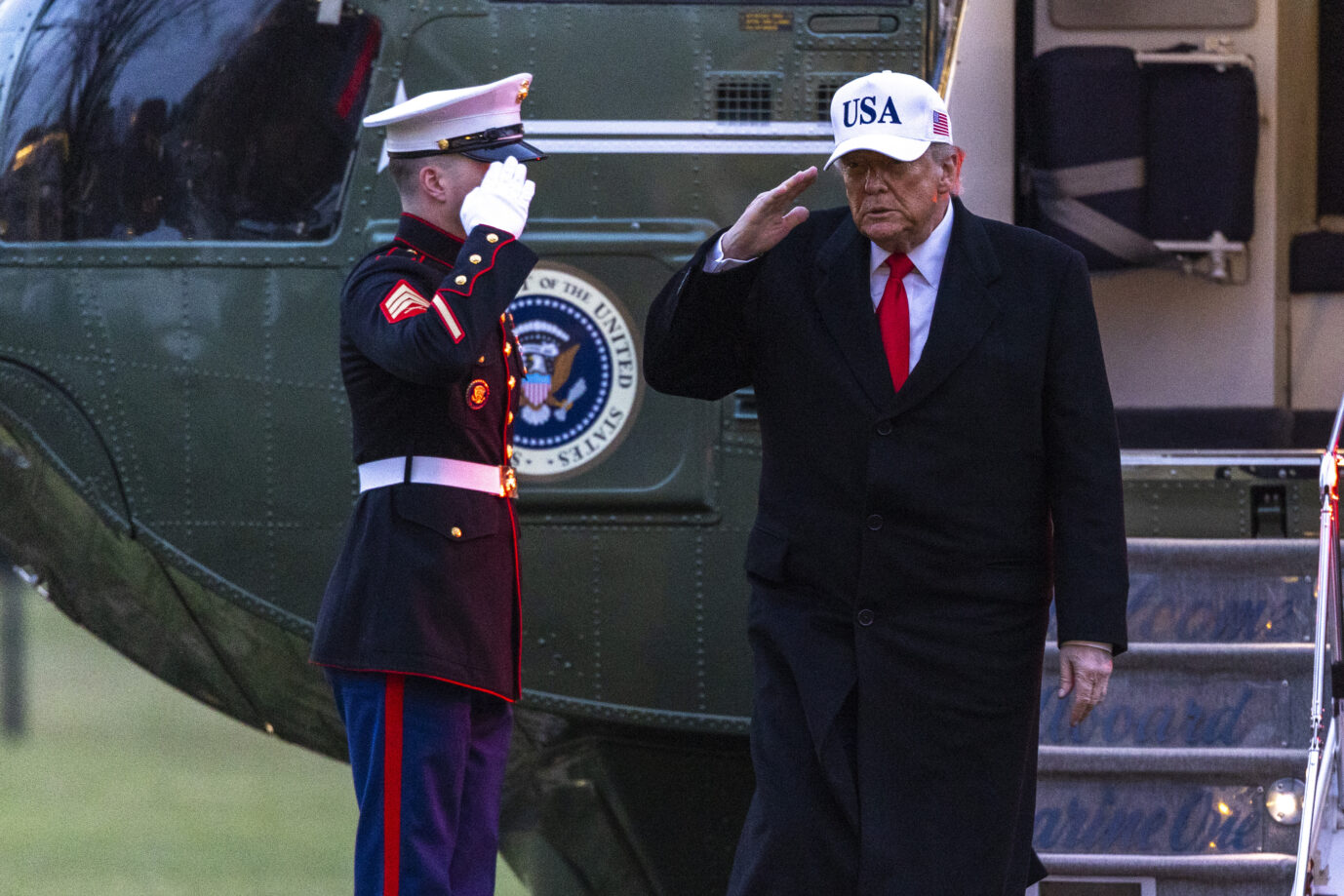Oriana Skylar Mastro lehrt Politische Wissenschaft an der Universität Stanford in Kalifornien und ist eng mit dem indo-pazifischen Kommando der US-amerikanischen Luftwaffe verbunden. Bei ihrer Analyse des Aufstiegs Chinas zur Großmacht hat sie sich unter anderem von den Erfolgsgeschichten junger Unternehmen, der Start-ups, inspirieren lassen. Wachstum ist möglich, indem Unternehmen oder Länder einem Vorbild folgen, Marktlücken oder Schwachpunkte des Vorbilds ausnutzen oder innovativ werden beziehungsweise neue Wege beschreiten. Dabei sollten nicht nur die eigenen Stärken oder komparativen Kostenvorteile, sondern vor allem auch die wahrscheinlichen Reaktionen berücksichtigt werden, die der dominante Akteur gegen den Aufsteiger ergreifen könnte – im Falle des aufstrebenden China also die USA.
Als China sich unter Deng Xiaoping in den achtziger Jahren dem Weltmarkt zuwandte, hatten die USA zweifellos die Macht, China den Zugang zu erschweren. Stattdessen hatten sie eine liberale Weltwirtschaftsordnung geschaffen, die es der aufstrebenden Macht erleichterte, zum Herausforderer heranzuwachsen. Die liberalen Auffassungen der Amerikaner machten außerdem einen Präventivkrieg gegen China undenkbar.
China flog unter dem Radar der USA
Für China war es wichtig, daß die USA nicht zu früh den Herausforderer als Gefahr erkannten. Deshalb hat China im Gegensatz zur Sowjetunion mit den USA nicht schon militärisch rivalisiert, als die ökonomische Basis dazu noch schwach war. Stattdessen hat China dem US-amerikanischen Vorbild zaghaft folgend wirtschaftliche Freiheiten eingeführt und sich in die amerikanisch dominierte Weltwirtschaft eingeordnet, was in den USA in den ersten Reformjahrzehnten begrüßt wurde, weil die Amerikaner damals noch an den Freihandel glaubten.
Diese grundsätzliche und erfolgreiche Weichenstellung der Chinesen hätte eigentlich nahe gelegt, zuerst die chinesische Wirtschaftspolitik und danach erst die chinesische Diplomatie und Sicherheitspolitik zu analysieren. Merkwürdigerweise hat Mastro aber eine andere Reihenfolge gewählt, der der Rezensent nicht folgen will. Denn Mastro zeigt gleich am Anfang, welchen Beitrag die Wirtschaft zum Aufstieg Chinas zur Weltmacht geleistet hat.
Die Währung ist noch immer schwach
Zu Reformbeginn war die US-Volkswirtschaft noch 16mal so groß wie die chinesische. Noch 2000 verfügte China nur über drei Prozent der globalen Wirtschaftsleistung. Die Mannschaftsstärke der chinesischen Streitkräfte von damals vier Millionen konnte obsolete Ausrüstung und schlechte Ausbildung nicht kompensieren. Mastro bezweifelt, ob die chinesischen Atomstreitkräfte damals zum Zweitschlag überhaupt in der Lage waren. Heute besteht daran kein Zweifel mehr. Jetzt verweist Mastro auf die moderne Ausrüstung des Militärs und die größte Flotte der Welt und darauf, daß Chinas Wirtschaft größer als die Japans oder aller europäischen Mächte ist und daß China für die meisten Länder der Welt ein größerer Handelspartner als die USA geworden ist.
Die Chinesen haben ihre Wirtschaft nicht nur teilweise nach westlichen Vorbildern reformiert und auf globale Märkte hin ausgerichtet, sondern immer auch Industriepolitik betrieben, mit Staatsbetrieben, Subventionen, günstigen Krediten und administrativen Eingriffen zugunsten mancher und zulasten anderer Unternehmen. Die Forschung wird massiv gefördert. Industriespionage, Korruption und ökonomische Sanktionen gegen unliebsame Partnerländer werden bereitwillig eingesetzt. In Anbetracht des Kontrollbedürfnisses der Kommunisten ist es den Chinesen allerdings bisher nicht gelungen, ihre Währung als weit verbreitetes Zahlungsmittel im internationalen Handel oder gar als nennenswerte Reservewährung zu etablieren. Da liegt der chinesische Yuan immer noch weit abgeschlagen sogar hinter dem Euro.
Wirtschaftliche Partnerschaften statt militärische Bündnisse
Um die Amerikaner nicht allzu früh herauszufordern, haben die Chinesen im Gegensatz zu den USA darauf verzichtet, ein Bündnissystem und überall auf der Welt Militärstützpunkte aufzubauen, von einem einzigen Stützpunkt in Dschibuti abgesehen. Statt auf Bündnisse setzt China auf strategische Partnerschaften, die eher auf wirtschaftliche als auf militärische Zusammenarbeit ausgerichtet sind. Die amerikanische Neigung, sich überall auf der Welt – etwa Vietnam, Irak, Libyen und Afghanistan – militärisch zu engagieren, hält man in Peking ohnehin für eine Verzettelung der Kräfte.
Bei seiner Aufrüstung geht es China bisher weniger um die globale Einsatzfähigkeit seiner Streitkräfte als darum, den USA einen denkbaren Einsatz in chinesischen und taiwanesischen Gewässern zu erschweren. Die atomare Rüstung Chinas ist bisher nur auf die Abschreckung eines nuklearen Angriffs ausgerichtet und verzichtet auf mit taktischen Atomwaffen verbundene Eskalationsoptionen und erst recht auf erweiterte Abschreckung zugunsten anderer Länder.
Ein gutes Buch – mit seltsamen Thesen
Statt nach US-amerikanischem Vorbild befreundete Streitkräfte auszubilden und auszurüsten hat China sich dafür entschieden, die Polizeikräfte von Entwicklungsländern unabhängig von deren politischer Ausrichtung auszubilden und auszurüsten und damit dort Unterstützung für chinesische Anliegen zu finden, etwa bei Abstimmungen bei der Uno. Auch in der Entwicklungshilfe ist China innovative Wege gegangen. Statt humanitärer Hilfe setzt China auf Infrastruktur-Investitionen. Bei der Kreditfinanzierung sind die chinesischen Zinssätze in der Regel höher als westliche. Außerdem verlangt China mehr Sicherheiten für seine Kredite.
Das Buch ist eine nützliche Ergänzung der nur ökonomisch ausgerichteten Analysen zum Aufstieg Chinas. Es enthält allerdings auch einige fragwürdige politische Empfehlungen, etwa zur Einschaltung Chinas bei Friedensbemühungen in der Ukraine oder zu amerikanischen Reaktionen auf denkbare chinesische Herausforderungen.