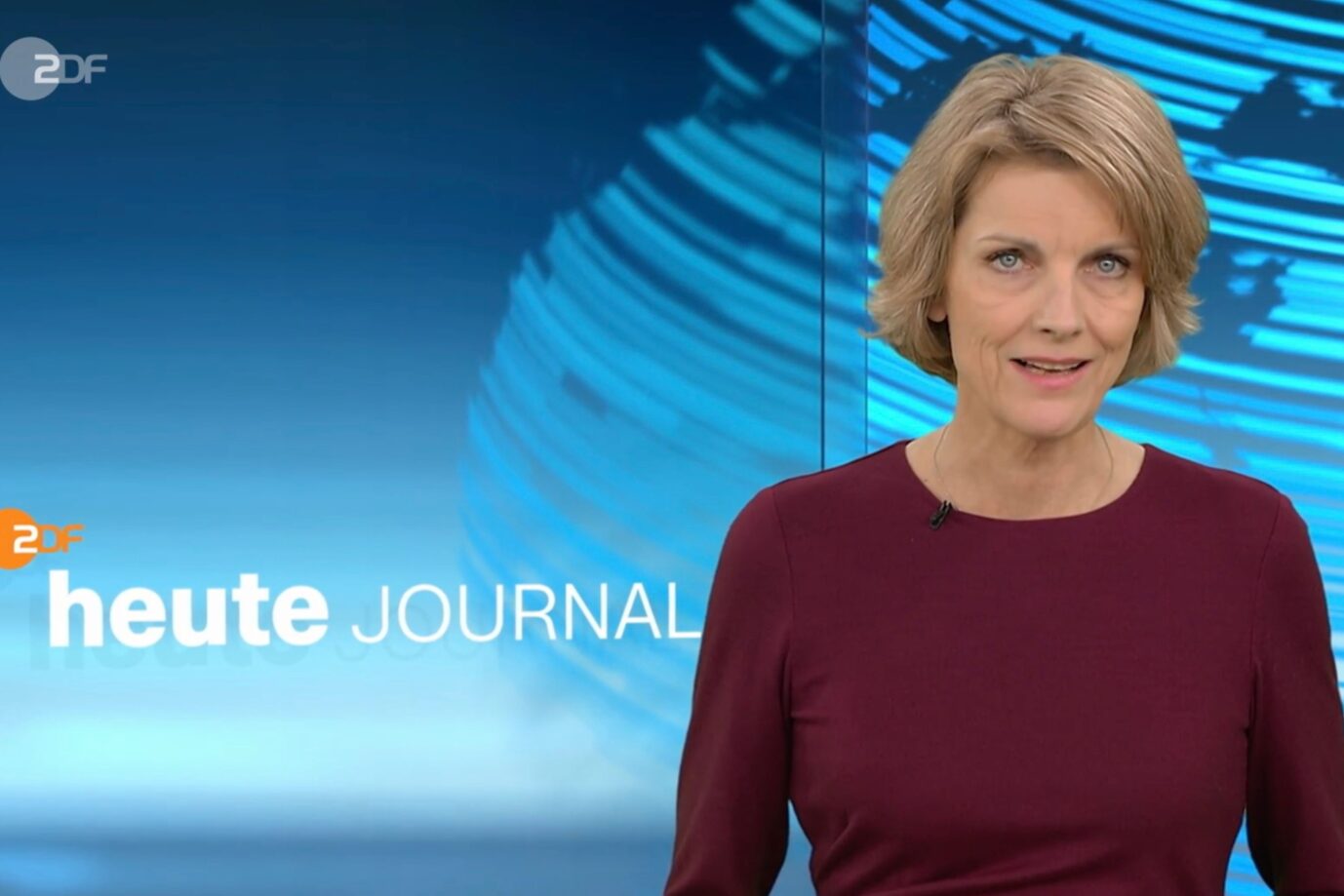Das Bundesverfassungsgericht (BVG) hat eine Entscheidung gefällt. Eine Entscheidung gegen die AfD. So weit, so erwartbar. Jedenfalls dürfte kaum jemand überrascht gewesen sein, daß die „Hüterin der Verfassung“ Maßnahmen verweigert, die der AfD Zugang zum Amt eines stellvertretenden Bundestagspräsidenten verschaffen. Die Begründung ist im wesentlichen formaler Art, und wenn die etablierten Parteien oder die Qualitätsmedien dazu Stellung nehmen, dann im Ton klammheimlicher Freude, allenfalls besorgt, daß da der von der AfD angeblich gepflegte „Opfermythos“ (so die Frankfurter Allgemeine Zeitung) wieder einmal Nahrung bekommen könnte.
Auf Beistand oder wenigstens Sachlichkeit ist hier nicht zu hoffen. Anders bei denen, die die Dinge aus der Distanz betrachten. Jedenfalls hält Fatina Keilani, die Kommentatorin der Neuen Zürcher Zeitung, die Entscheidung des BVG für fatal und keineswegs für einen „Sieg … der Demokratie“. Schon das Scheitern von sechs AfD-Kandidaten in 18 Wahlgängen für eines der höchsten Staatsämter sei ein beschämendes Schauspiel gewesen. Mehr noch: Hier habe man den sinnfälligen Beweis, daß den Verantwortlichen die Einsicht in die zentrale Aufgabe des Parlaments fehle, das als „Hohes Haus“ das ganze Volk – also auch die Wähler, die für die AfD stimmten – zu repräsentieren habe. Stattdessen konzentriere sich eine Allparteienkoalition unter Ausschluß der AfD darauf, „die eigene, vermeintlich richtige Gesinnung ins Schaufenster zu stellen“.
Die wichtigsten Stichworte sind hier „unwürdig“ und „Gesinnung“. Tatsächlich verfestigt sich der Eindruck, daß es gerade in jenen Kreisen, die sich gern als die einzig „demokratischen“ betrachten – von der Linken über die Grünen und die FDP bis zur CDU/CSU – an der notwendigen Wertschätzung der Institutionen unserer Republik fehlt. Man betrachtet sie nur mehr als Mittel zu eigenen Zwecken: Sie sollen der eigenen Versorgung und dem eigenen Machterhalt dienen. Jenes Ansehen im Volk, das sie sich in der Nachkriegszeit erworben haben, gibt man leichten Herzens preis.
Die AfD hat keine Chance auf fairen Wettbewerb
Das kritisch festzustellen, bedeutet nicht, zu überschätzen, was Politik sein kann. Selbstverständlich gehört zu ihrem Wesen auch „politique politicienne“: jenes oft unschöne und ruppige Vorgehen, wenn der Kampf um die Macht im Handgemenge ausgetragen wird. Aber berufene Politiker wissen doch, daß das nicht alles ist und zu den Geboten der Klugheit gehört, Maß zu halten und darauf zu achten, daß nicht beschädigt wird, was sehr schwer wiederhergestellt werden kann: das Vertrauen der Bürger in die Legitimität der bestehenden Ordnung.
Wenn solche Erwägungen für die Akteure keine Rolle mehr spielen, dann, weil sie weder berufen noch maßvoll noch klug sind. Sie halten sich für unantastbar. Es fehlt ihnen an heilsamer Phantasie, jener Vorstellungskraft, die es ihnen erlauben würde, sich vorzustellen, wie es wäre, als Schwächerer ohne institutionellen Schutz anzutreten, das heißt unter Bedingungen, unter denen die AfD seit ihrer Gründung antritt: keine Chance auf fairen Wettbewerb, jeder Unterstellung und jeder Denunziation preisgegeben, die Mitglieder und Repräsentanten, wenn nicht an ihrem Eigentum geschädigt oder körperlich attackiert, dann doch leichthin dem sozialen Tod ausgeliefert.
Nur die Sicherheit, daß man immer auf der Seite stehen wird, die die Kontrolle hat, die geltenden Vorurteile regelt, verfemt, Parias bestimmt, Feindbilder festlegt, Sündenböcke markiert und in die Wüste jagt, erlaubt, sich so aufzuführen, wie es die Politische Klasse unseres Landes tut.
Dahinter steht, was die Alten „Hybris“ nannten: Frechheit und Hochmut, von der Überzeugung getragen, alternativlos zu sein und die Zukunft für sich zu haben. Hybris geht mit Verblendung einher, und an solcher Verblendung ist schon mehr als ein Gemeinwesen zu Grunde gegangen.