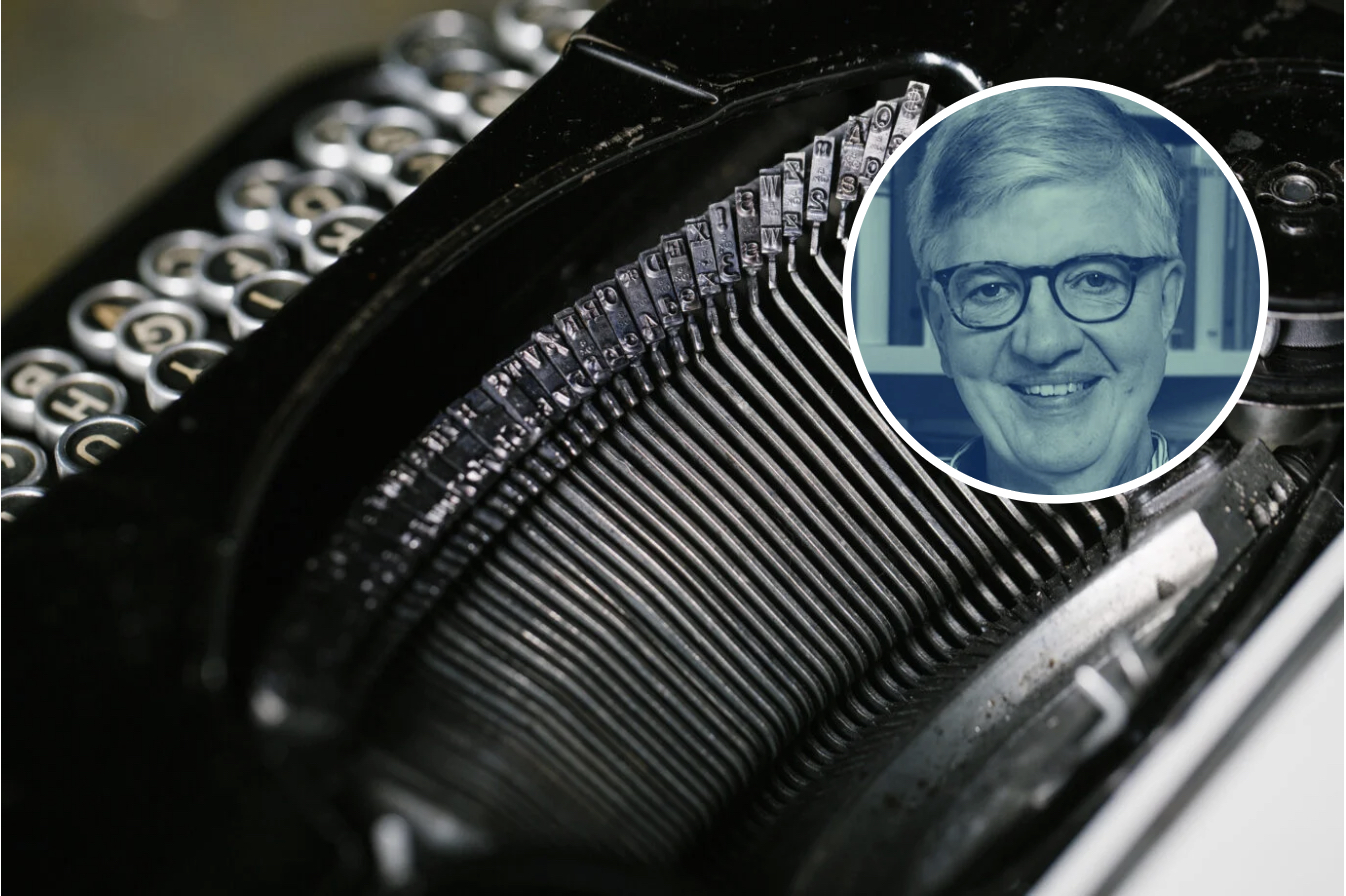Ein sprunghafter Donald Trump, sein unklares Handeln im Ukrainekrieg und bei der Nato, ein sich durch die Sanktionen gegenüber Rußland selbst schwächender Westen, dazu ein rasant wachsendes US-Staatsdefizit und der Zollstreit haben zu einem Vertrauensverlust der USA geführt. Zwar ist der Dollar weiter die privilegierte Reservewährung, doch ist sein Anteil an den globalen Reserven der Notenbanken seit 1999 bereits von 73 auf nunmehr 58 Prozent gesunken – Tendenz fallend. Ist der Dollar noch ein „sicherer Hafen“?
Dieser muß eine sehr geringe Ausfallwahrscheinlichkeit verbunden mit einer hohen Liquidität bieten. Die großen Volumina bei geringer Zinsänderung machen solche Anleihen ideal handelbar. Bislang flüchteten Anleger in Krisenseiten weltweit in US-Staatspapiere (Treasuries). Doch die jüngsten Krisen zeigten ein anderes Bild: Der Dollar wertete ab, die US-Zinsen stiegen. Zugleich stieg die Zinsdifferenz von kurz- zu langlaufenden US-Staatsanleihen, was gemeinhin als Zeichen eines schwindenden Vertrauens in deren langfristige Ausfallsicherheit gewertet wird.
Der Euro kann vom schwächelnden Dollar nicht profitieren
Bisher kann der Euro als Reservewährung allerdings nicht profitieren, was auch den Nachwirkungen der Euro-Krise und den EZB-Anleihekaufprogrammen geschuldet sein mag. So stieg sein Anteil nach der Euro-Einführung bis 2010 auf 28 Prozent, doch fiel er 2015 auf etwa 20 Prozent. Dies entspricht in etwa dem Niveau der D-Mark, deren Anteil an den weltweiten Devisenreserven im Zeitraum von 1980 bis 1996 durchschnittlich 14,5 Prozent betrug und 1990 sogar auf 19 Prozent anstieg.
Hinzu kommt, daß es keine supranationalen Anleihen der EU-Kommission oder der EZB in großem Umfang gibt, was für einen liquiden Markt notwendig wäre. Das gleiche gilt für die einzigen Staatsanleihen mit AAA-Rating, die von Deutschland, den Niederlanden und Luxemburg. Deren Volumina sind für eine weltweit gehandelte sichere Anlage zu gering.
ESBies sollen Europas Antwort sein
Doch warum sind sichere Anleihen generell wichtig? Staaten, die solche Schuldpapiere ausgeben, profitieren von einer Verschuldung zu niedrigen, gar sinkenden Zinsen, was in Krisenzeiten von Vorteil ist. Anleger wiederum können kurzfristig umschichten, und Versicherern bieten sie langfristige, verläßliche Anlagen zur Bedienung zukünftiger Forderungen etwa aus Lebensversicherungspolicen. Zudem unterliegen Banken und Versicherungen aufsichtsrechtlichen Vorgaben, die teils nur sicherere Anlagen mit AAA-Rating erfüllen.
Wegen der Zweifel an den US-Treasuries kommen Europäische sichere Anleihen (European Safe Bonds/ESBies) aktuell wieder in die Diskussion. Das Konzept stammt ursprünglich vom Europäischen Ausschuß für Systemrisiken (ESRB) – mit dabei der frühere Präsident der Zentralbank von Irland und heutige EZB-Chefvolkswirt Philip Lane. Die ESBies-Idee wurde anläßlich der Euro-Staatsschuldenkrise 2011 vorgeschlagen, ohne daß bislang jedoch eine Umsetzung erfolgte. Neben dem Bedarf nach einer sicheren Anleihe stand zudem die Finanzstabilität der Eurozone im Fokus, indem der Teufelskreis zwischen Staaten- und Bankenrisiken durchbrochen werden sollte. Hintergrund war damals der hohe Bestand an Staatspapieren von Krisenstaaten bei nationalen Geschäftsbanken, die dort zu Wertverlusten und drohender Überschuldung führten.
ESBies sind ein Bündel aus Staatsanleihen von Eurostaaten, deren Anteile beispielsweise gemäß ihrem Bruttoinlandsprodukt (BIP) gewichtet werden. Der finanztechnische Trick besteht dabei in der Teilung in zwei Tranchen unterschiedlicher Ausfallsicherheit: Die Senior-Tranche (70 Prozent) genießt vorrangige Bedienung; die Junior-Tranche (30 Prozent) ist der Sicherheitspuffer. Damit entspricht die Senior-Tranche der sicheren Anleihe, da ausfallende Kredite erst die nachrangige Junior-Tranche treffen. Doch was pfiffig klingt, wird auf dem freien Kapitalmarkt von Finanzdienstleistern nicht angeboten – warum nicht?
Verbriefung rechnet sich kaum
Als Referenz kann die Durchschnittsrendite des gesamten Portfolios an Staatsanleihen genommen werden, denn dieses kann am Markt problemlos von potentiellen Herausgebern von ESBies (Emittenten) erworben werden. Doch nur wenn die Rendite der beiden Tranchen (Zinskosten) zusammen geringer ist als die Durchschnittsrendite des gesamten Portfolios (Zinsertrag), kann ein Emittent aus einer Verbriefung eines ESBies einen Gewinn erzielen. Theoretisch wäre dies zwar unter gewissen Annahmen vorstellbar, doch die Praxis spricht offensichtlich dagegen.
Damit kommen nur EU-Institutionen wie die EZB als Emittentin infrage. Sie hat aus ihren Anleihekaufprogrammen noch etwa 3,7 Billionen Euro in ihren Büchern – überwiegend Staatsanleihen. Aus diesen könnte sie entsprechende ESBies bilden. Das Problem: Sie würde hohe Verluste einfahren, da die in der Niedrigzinsphase angekauften Staatsanleihen erheblich geringere Zinsen abwerfen, als die EZB für ihre ESBies derzeit bieten müßte.
Nur der Markt entscheidet über Sicherheit
Sodann sind ESBies zwar keine „Eurobonds“ mit gesamtschuldnerischer Haftung der Mitgliedstaaten. Jedoch werden deren unterschiedliche Risikoprämien zusammengelegt. Da im Falle einer Krise das Kapital nicht mehr in einzelne als sicher betrachtete Mitgliedstaaten fließt, sondern in die sichere ESBies-Tranche, dürfte die Sicherheitsprämie der AAA-Staaten reduziert werden und sich deren Kreditnahme zukünftig verteuern.
Umgekehrt würden hochverschuldete Staaten von einer geringeren Ausfallprämie profitieren und tendenziell länger Zugang zum privaten Kapitalmarkt haben. Der Kreditzins als Maß für das Kreditrisiko von Staaten würde seine Signal- und Lenkungsfunktion verlieren. Sollte die Junior-Tranche aufgrund eines hohen Ausfallrisikos am Markt nicht mehr verkäuflich sein, könnte sie von der EZB selbst aufgekauft und gehalten werden – ein zumindest indirekter Verstoß gegen das Verbot der monetären Staatsfinanzierung (Artikel 123 AEUV). Sie wäre Käufer der letzten Not und würde zur Bad Bank für Europa, bei der Banken ihre ausfallgefährdeten, am privaten Kapitalmarkt nicht mehr handelbaren Staatspapiere unterbringen könnten.
Fazit: Den Status einer sicheren Anlage muß man sich erst am Kapitalmarkt verdienen. Nicht ohne Grund mahnte jüngst Otmar Issing, ein Vorgänger von Philip Lane: „Notenbanken müssen immer wieder deutlich machen, was die Geldpolitik zu leisten vermag und was nicht“, so der erste Chefvolkswirt der EZB (1998 bis 2006). „Ihre zentrale Aufgabe, Preisstabilität zu gewährleisten, ist schwierig genug.“