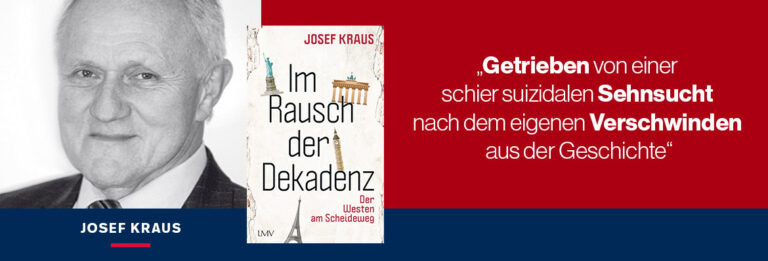TRIPOLI. Die Bomben explodierten am gleichen Tag, dem 23. August 2013. Mindestens 47 Menschen starben im nordlibanesischen Tripoli, rund 500 wurden verletzt. Fünf Personen mit Verbindungen zur syrischen Regierung werden nun offiziell beschuldigt, für das Blutbad verantwortlich zu sein.
„Sie wollten von dem Gasangriff ablenken und die Muslime für ihren Einsatz in Syrien bestrafen“, geben sich Sunniten im Straßengespräch überzeugt. Daß nur wenige Tage zuvor im Schiiten-Viertel von Beirut die Detonation eines präparierten Autos ebenfalls über 20 Menschen getötet hat, beweist den frustrierten Einwohnern umso mehr, daß „eine kriminelle Verschwörungsmafia“ am Werk sei.
In der Umgebung beider Tripolitaner Moscheen, wo das Freitagsgebet im Inferno endete, liegen noch vier Wochen später die zusammengetragenen Schuttberge. Doch im Umkreis der Salam-Moschee des eher vornehmen Al-Mina sind die zerbrochenen Scheiben der umstehenden Hochhäuser bereits erneuert worden. Im eher armen Al Zahirija/Tabbaneh, wo die Takwah-Moschee Ziel des Angriffs war, ist das anders.
Sunniten trommeln gegen „die Ungläubigen“
Jugendliche führen mich in die engen Gassen des anliegenden Wohnviertels. Der Gestank stellt alles in den Schatten, was mir bisher in Tripoli untergekommen ist – der Müll türmt sich, Hühner rennen umher. Während eine Horde Kinder über den Besuch eines Ausländers in Jubelstürme ausbricht, stellt ein Mann mit seinem Messer zur Schau, daß er Fremde nicht möge.
Für die schlechten Verhältnisse, so heißt es, werde man schon bald an den „Kuffar“, den Ungläubigen, Rache nehmen. Das Feindbild ist hier sehr konkret: Die alawitische Minderheit auf dem Berg-Viertel Dschabal Mohsen. Getrennt sind sie beide ironischerweise von der „Syrien-Straße“.
In Feindschaft leben sie schon seit Jahrzehnten, Schußwechsel sind normal. Doch im Mai 2013 eskalierte der konfessionelle Haß infolge der Schlacht im gerade mal 100 Kilometer entfernten syrischen Kussair: Mindestens 24 Menschen starben rechts und links der Grenztrasse, dazu wurde von 160 Verletzten berichtet.
Das Militär zu fotografieren ist verboten
Für oder gegen den syrischen Präsidenten Assad – das ist auch hier die Frage. Die Armee hat die Lage vorerst beruhigt – und ist mit zahlreichen Schützenpanzern und Mannschaftswagen anwesend. Sie zu fotografieren ist nicht gestattet. Doch die Kriegsschäden abzulichten und sich frei umzuschauen – damit haben die Soldaten kein Problem.
Ganze Häuserfassaden sehen nach der Schusswaffen-Bearbeitung aus wie ein Leopardenfell. Sogar Panzerfäuste sind im Nachbarschaftskrieg zum Einsatz gekommen. Alawitische Zivilisten jenseits der Stacheldrahtverhaue zeigen triumphierend Bilder ihrer üppigen Bewaffnung und laden zum Kaffee.
Sie sind stolz auf den syrischen Staatschef, den sie „unseren Löwen“ nennen. Sein Konterfei, sowie Bilder des Vaters Hafis al-Assad hängen überall. Besonders stolz ist man auf die militärisch-martialischen Darstellungen, die in Wirklichkeit gar nicht dem Naturell Baschar al-Assads entsprechen.
Unverschleierte Frauen bei den Alawiten
Gegenüber einem fremden Besucher wirken die Alawiten gelassen – auch wenn viele von ihnen ein schlichtes Leben führen und keine Fremdsprache beherrschen. Dennoch wirkt ihr Viertel offener und sauberer als die Siedlungen am Fuße des Berges. Viele Frauen laufen ohne Schleier umher. „Es gibt viele Sunniten, die behaupten, wir wären Ungläubige“, sagen einige junge Männer, die auf ihren Stühlen sitzend am Straßenrand Wasserpfeife rauchen und Tee trinken. „Aber wir sind Muslime.“
Nahostkenner Peter Scholl-Latour berichtet, die „Geheimsekte“ führe jedoch auch schamanische Kulte aus und bete Mohammeds Schwiegersohn Ali als Inkarnation Allahs an. Sollten sich die Aufständischen im Nachbarland durchsetzen, würden sie die Alawiten massakrieren, sind sich auch die hiesigen Gesprächspartner gewiß. „Aber keine Sorge“, feixen sie, „wir haben mehr im Kopf als diese Leute.“ Nicht zu Unrecht verweist er darauf, daß in Dschabal Mohsen auch sunnitische Libanesen lebten – „ohne Probleme“.
„Du wirst unser Denken auch in 100 Jahren nicht verstehen“
Beim Rückweg kommt es doch noch zu einem Problem: Das Militär will nicht, dass ich allein im Dunkeln zu meiner Unterkunft zurücklaufe. „Es gibt hier im Moment so viele Probleme“, so der Einsatzleiter. Er warnt vor Scharfschützen und Kriminellen. Er wolle mich zum Geheimdienst bringen, damit mich dieser „sicher“ nachhause geleiten könne.
Das ungute Gefühl trübt nicht: Vier Stunden lang werde ich verhört, muß mich bei einem Offizier nach dem anderen vorstellen. Als am Ende ein englischsprachiger Agent vom „Typ Arnold Schwarzenegger“ erscheint, beruhigt er: „Das sind hier die Regeln.“ Und wer auf Abenteuer aus sei, könne sich doch darüber freuen.
Nach kurzem Grübeln setzt er nach, daß er nie etwas vergessen würde: „Ich kenne Dich aus dem Fernsehen: Du bist der Typ, der in Syrien gefangen war.“ Das Verhältnis entspannt sich. „Weißt Du“, setzt der Agent nach, „uns ist das egal, ob Leute nach Syrien gehen, um dort zu kämpfen. Nur Eure Waffen dürft Ihr nicht mit nach Libanon bringen.“ Er spricht von „etwa 60 deutschen Dschihadisten“, welche im Bürgerkrieg des Nachbarlandes kämpften.
Ich berichte vom sunnitischen Schuhhändler Omiros, der mit tiefer Inbrunst bekundet hatte, wie sehr er sich einen Krieg im Libanon wünsche, „um die schlechten Leute zu beseitigen“. Der muskulöse Geheimdienstler muß lachen. „Ja, ohne uns würden die Araber sich gegenseitig umbringen. Wir sind aggressiv gegeneinander, bekriegen uns bis aufs Blut, aber ganz ehrlich: Wir haben auch ein gutes Herz.“ Die Syrer könnten ihre Probleme allein nicht lösen – zu sehr befänden sich die unterschiedlichen Gruppen mittlerweile in Angst voreinander. Eine politische Lösung müsse von außen aufgezwungen werden. Zum Abschluss gibt der Verhörmann noch einen Rat: „Du wirst unser Denken auch in 100 Jahren nicht verstehen.“