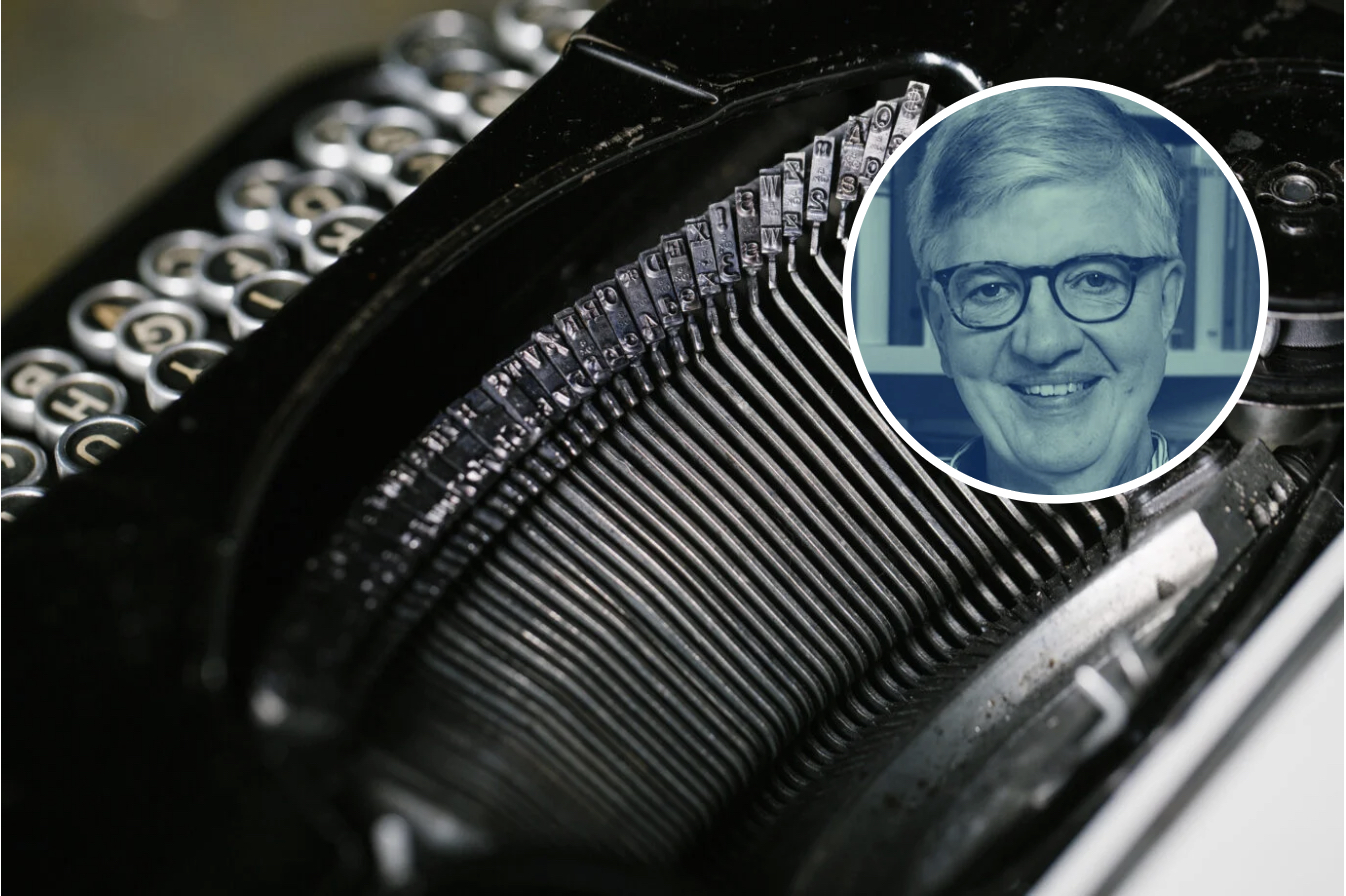Zu den verblüffendsten Entwicklungen der letzten Jahre zählen die Annäherung der politischen Linken an die Kräfte des Islam und parallel dazu die wachsende Gleichgültigkeit gegenüber jüdischen Interessen und Befindlichkeiten im Inland und die Abwendung von Israel bis hin zu offener Feindschaft. Verblüffend ist die Entwicklung auch deswegen, weil der Holocaustbezug und das projüdische Bekenntnis lange ein Hauptelement der Linken in ihrem Kampf gegen Rechts darstellte. Eine Schrift des französischen Philosophen Alain Finkielkraut aus dem Jahr 1982, die jetzt erstmals auf deutsch erscheint, gibt Aufschluß über einige der historischen, weltanschaulichen und politischen Hintergründe.
Einen Einschnitt bedeutete der Auftritt des Literaturwissenschaftlers Robert Faurisson (1929–2018), der seit den siebziger Jahren als Holocaust-Revisionist von sich reden machte. 1980 veröffentliche er sein „Mémoire en défense“ („Memorandum zur Verteidigung“), in dessen Mittelpunkt „la question des chambres à gaz“ („die Frage der Gaskammern“) steht. Faurisson erhielt sogar Gelegenheit, in einer Rundfunksendung seine Auffassung einem größeren Publikum vorzustellen. Damit rückte „die Faurisson-Affäre durchaus (ins) Zentrum unseres geistigen Lebens“, so Finkielkraut.
Faurisson setzte fort, was der Historiker Paul Rassinier (1906–1967) begonnen hatte. Sie bestritten die Existenz von Gaskammern oder hielten sie – in den Worten des Front-National-Gründers Jean Marie Le Pen – für ein aufgeblähtes „Detail in der Geschichte“. Beide waren NS-Sympathien unverdächtig. Rassinier war sogar ein dezidierter Linker – zunächst Kommunist, dann Sozialist – gewesen und mehrere Jahre im KZ Buchenwald inhaftiert, wo er schwere Gesundheitsschäden erlitt. Woher also sein „Revisionismus von links“?
Von der Dreyfus-Affäre zum Holocaust
Finkielkraut geht bis zur Affäre um den jüdischen Offizier Alfred Dreyfus zurück, der 1894 aus antisemitischen Motiven als deutscher Spion beschuldigt und zu lebenslanger Haft verurteilt worden war. 1899 kam es auf dem Gesamtkongreß der Französischen Sozialisten zu einem Eklat über Wilhelm Liebknecht, der zweiten großen Gestalt der deutschen Sozialdemokratie neben August Bebel. Liebknecht hatte in mehreren Zeitungsartikeln die Schuld Dreyfus‘ für erwiesen gehalten. Liebknecht war kein Antisemit, vielmehr argumentierte er mit der marxistischen Geschichtslogik, mit der Logik des Klassenkampfes.
On this day in 1894, a Jewish officer in the French army by the name of Alfred Dreyfus is falsely convicted of treason for supposedly passing military secrets to Germany. The revelation that he is in fact innocent will later rock France. pic.twitter.com/AmZL4uQp8L
— Military History Now (@MilHistNow) December 22, 2023
Als Angehöriger einer privilegierten Schicht konnte Dreyfuß unmöglich ein grundloses Opfer der Klassenjustiz sein, deren Aufgabe es doch war, die privilegierten Schichten zu schützen. Denn das hätte bedeutet, den Antisemitismus als ein eigenständiges, alle Klassen und Schichten transzendierendes Phänomen anzuerkennen und den Proletarier als das absolut entfremdete Opfer der kapitalistischen Gesellschaft zu entthronen, was wiederum die ihm zugedachte Rolle als weltgeschichtliches Subjekt, das die Entfremdung und Unterdrückung ein für allemal aufhebt, zu entwerten.
Der Antisemitismus war aus linker Perspektive lediglich ein effektives Manöver der herrschenden Klassen, um das Proletariat von seiner Aufgabe abzulenken. So bestritt der Politikwissenschaftler Franz Neumann, ein Angehöriger der Frankfurter Schule und selber Jude, noch 1942 im amerikanischen Exil die ersten Berichte über Judenmassaker in Osteuropa mit der Begründung: „Das politische Interesse am Antisemitismus verhindert, daß die Juden vernichtet werden.“
Einfluß des Islam und seine Wirkung auf die Linke
Nach dem Zweiten Weltkrieg hatten linke Gruppierungen in Frankreich kein Interesse daran, den Holocaust hervorzuheben; er paßte nicht ins Raster. Vielmehr wurde der Krieg als ein Zusammenstoß unterschiedlicher Kapitalinteressen interpretiert: Deutschland hatte sich unter Hitler angeschickt, zum dominanten „Pol“ des Weltkapitals zu werden, was den Widerstand der alliierten Konkurrenz hervorrief, die 1945 ihrerseits die „Weltherrschaft“ antrat. Finkielkraut: „Erstmals scheint der Wille erkennbar, Hitler zu vermenschlichen, das heißt ihm jedes unheilvolle Privileg zu entziehen, um aus ihm einen Vertreter der Unmenschlichkeit des Kapitals unter anderem zu machen.“
Finkielkraut formuliert hier als Vorwurf, was die natürliche Aufgabe eines Historikers ist: Die handelnden Figuren als geschichtliche Erscheinungen zu erklären, zu historisieren, anstatt sie als Inkarnation eines absolut Bösen (oder absolut Guten) auf ein sakrales Podest zu stellen. Zu der hier skizzierten altlinken Position trat nach dem Schock, den Alexander Solschenizyns „Archipel Gulag“ in den siebziger Jahren gerade in der französischen Linken auslöste, ein neulinker, von der Totalitarismus-Theorie geprägter „Revisionismus“. Finkelkraut kritisiert auch ihn, weil er dem Nationalsozialismus gleichfalls seine Exklusivität im Bösen nahm und die Holocaust-Negationisten beflügelte.
Ganz anders der linke Reformpädagoge und Aktivist Jean-Gabriel Cohn-Bendit – der ältere Bruder des Studentenführers –, der die Holocaust-Exklusivität selber für eine ideologische Zweckbehauptung hielt. Sie sollte einen „absoluten Wesensunterschied“ zwischen dem Nationalsozialismus und dem Stalinismus markieren und die Sowjetunion, die zum Sieg über Hitler beigetragen hatte, auf die Seite des Guten ziehen. „Das Nazi-Regime, dessen Symbol die Gaskammern sind, wird als das absolut Böse wahrgenommen, es fällt aus der Geschichte heraus.“
Buch macht Vorgänge bei Linken verständlich
Das aber entspricht eher einem religiösen Dogma als einer wissenschaftlich fundierten Feststellung. Daher verteidigte Cohn-Bendit das Recht Faurissons auf Meinungsfreiheit, ohne dessen Meinung und Behauptung zu teilen.
Finkielkrauts Schrift ist stark in der Beschreibung der verschlungenen linken Gedankengänge, doch schwach in seinem Anti-Antitotalitarismus. Außer Betracht bleibt die internationale Holocaust-Fokussierung, die ab Mitte der siebziger Jahre von den USA ausging. Was er noch nicht ahnte, war der wachsende Einfluß des Islam und seine Wirkung auf die politische Linke. Leider läßt das kluge, weiterführende Nachwort von Niklaas Machunsky dieses Problem außer Betracht. Dennoch ist die späte Veröffentlichung der Schrift in Deutschland nützlich. Die Lektüre trägt dazu bei, die bizarr anmutenden Vorgänge im linken Spektrum besser zu verstehen.
————————————————————————————————
Alain Finkielkraut: Revisionismus von links. Überlegungen zu Fragen des Genozids. Aus dem Französischen von Christoph Hesse. ça ira Verlag, Freiburg 2025, broschiert, 200 Seiten, 26 Euro.