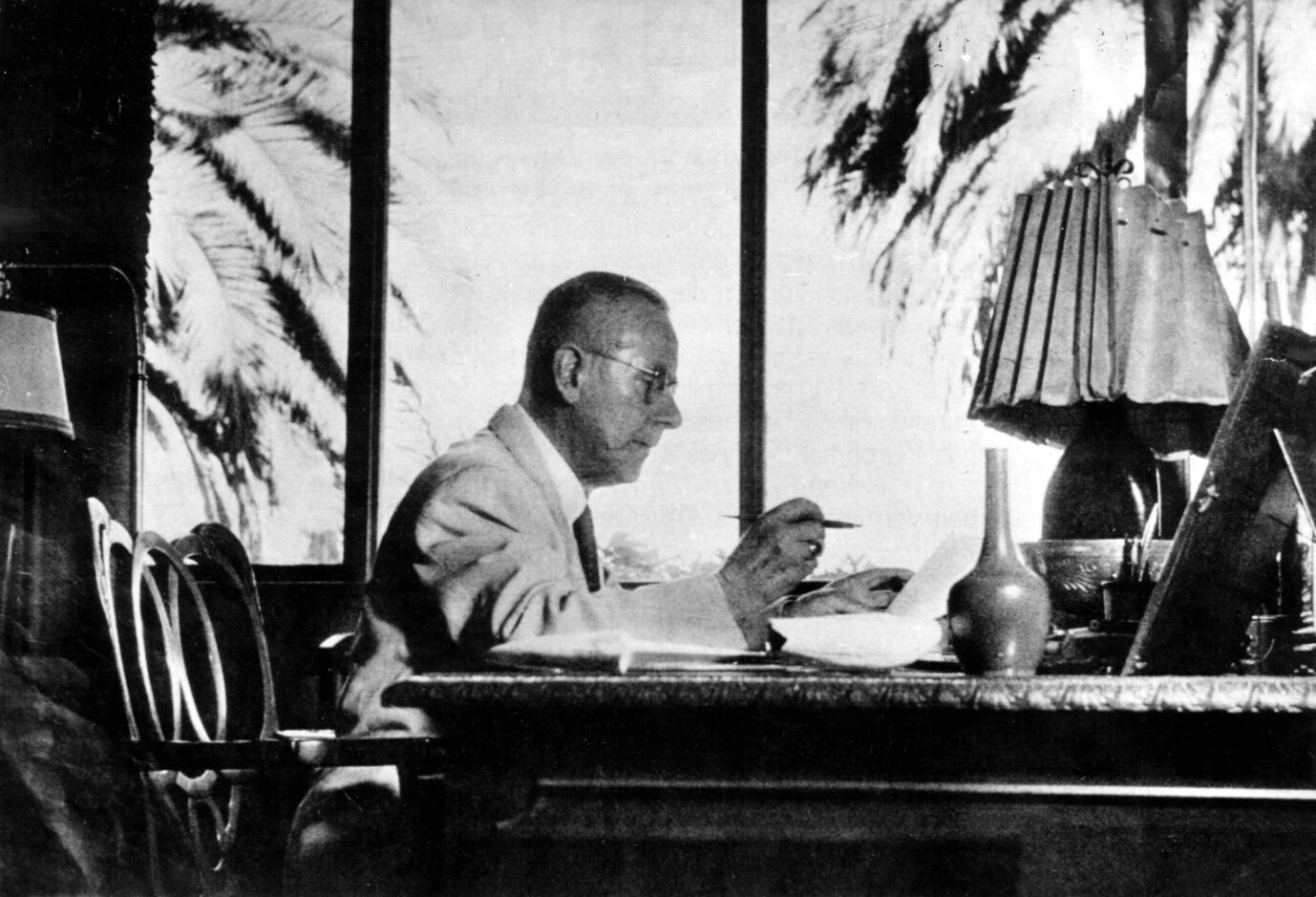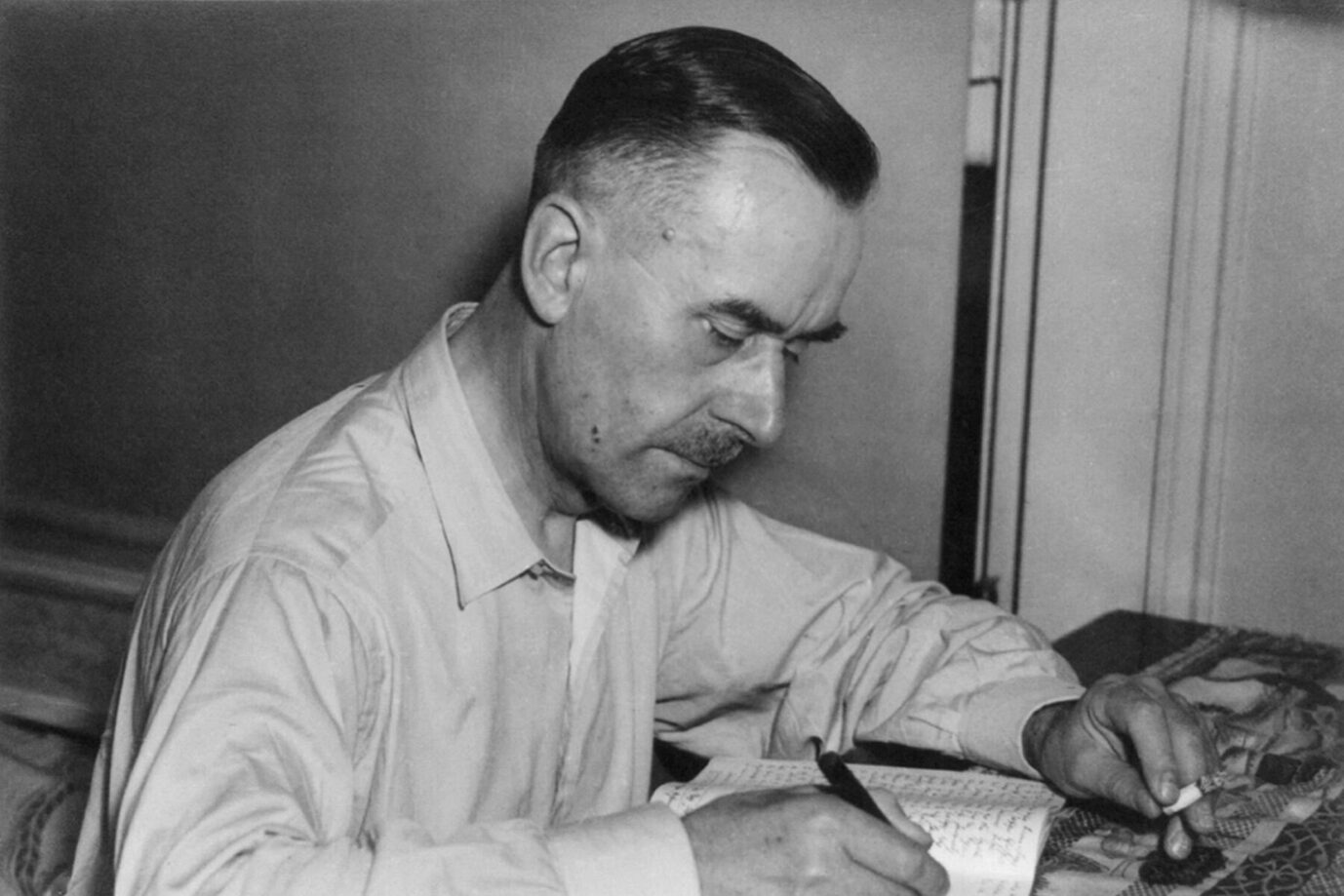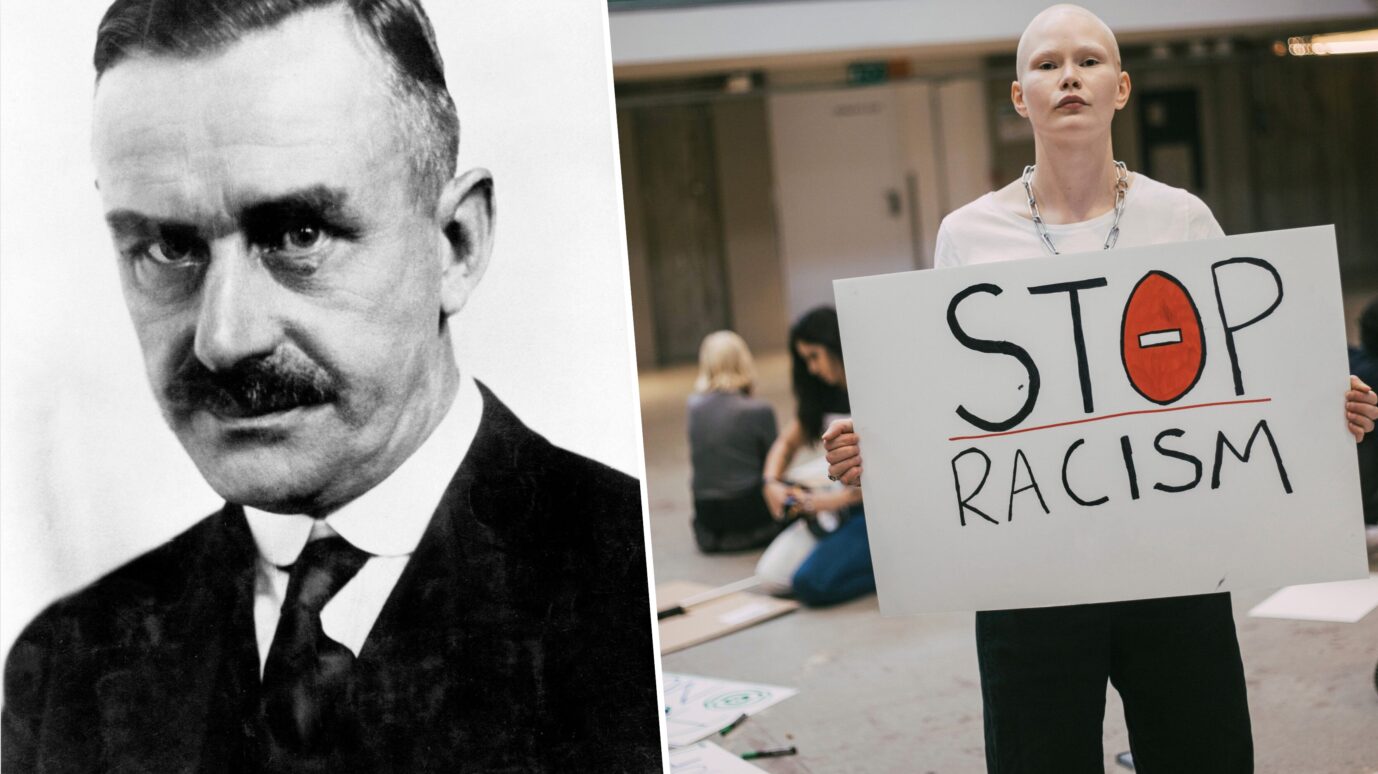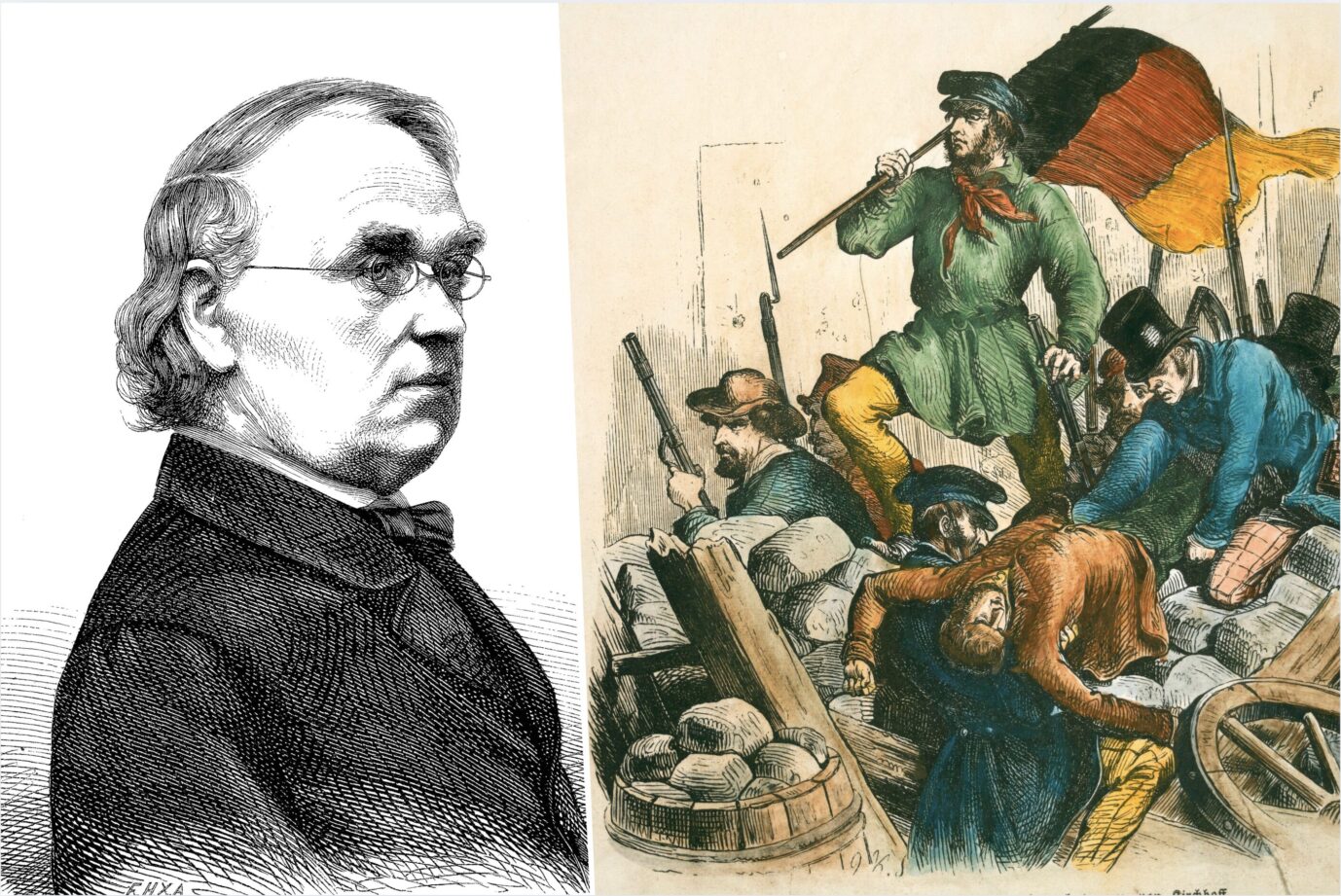Im Jahr 1924 erscheint „Der Zauberberg“, ein Roman, der zu den großen der Weltliteratur gehört. Die Handlung, die vordergründig diesem vielschichtigen, philosophischen, metaphysischen, von Liebe, Siechtum und Tod handelnden Werk zugrunde liegt, beginnt mit der Anreise Hans Castorps. Er besucht seinen lungenkranken Vetter Joachim Ziemßen auf dem Berghof. Drei Wochen beabsichtigt Hans Castorp in diesem Sanatorium oberhalb Davos zu bleiben. Sein Aufenthalt wird sieben Jahre dauern.
Kaum ist er angekommen, fühlt er sich fiebrig. „… denn er bemerkte, daß die Röte, die ihm vorhin in die frisch rasierten Wangen gestiegen war, nicht daraus weichen wollte …“ Schon bald nach seinem Einzug wundert sich einer der Ärzte, Dr. Krokowski, dem Hans Castrop vorgestellt wird, darüber, daß er sich als gesunden Menschen bezeichnet.
Castorp will wissen, was draußen geschieht
Als Hans Castorp sich auf Anraten des geschäftstüchtigen Chefarztes Hofrat Dr. Behrens einer Röntgenuntersuchung unterzieht, scheint es fast schon zwangsläufig, daß eine feuchte Stelle auf der Lunge attestiert wird, die eine Behandlung notwendig macht. Die Monate, die Jahre vergehen. „… So verging die Zeit, – es waren Wochen, wohl drei bis vier, von uns aus geschätzt, da wir uns auf Hans Castorps Urteil und messenden Sinn unmöglich verlassen können.“ Sein Vetter Joachim verläßt den Berghof, um in den Krieg zu ziehen, kehrt aber bald wieder zurück und stirbt an Tuberkulose.
Je länger Hans Castorp in dem Sanatorium verweilt, desto mehr verflüchtigt sich sein Interesse an der Welt draußen, an dieser Anderswelt, die Thomas Mann Flachland nennt. Hans Castorp sagt: „An wen sollte ich wohl Briefe schreiben? Ich habe niemanden. Ich habe keine Fühlung mehr mit dem Flachland, die ist mir abhanden gekommen …“ Ebenso abhanden gekommen ist ihm das Zeitgefühl. „Ich bin seit langer Zeit hier oben (…) seit Jahren und Tagen – genau weiß ich es nicht (…) habe ich mich dem Prinzip der Unvernunft, dem genialen Prinzip der Krankheit unterstellt, dem ich freilich wohl von langer Hand und jeher schon unterstand, und bin hier oben geblieben…“
Mann nimmt die Bewohner in Augenschein
Auf den Gedanken, eine Geschichte in einem Lungensanatorium spielen zu lassen, kommt Thomas Mann, als er seine Frau Katia in einer solchen Einrichtung in Davos besucht. Ein humorvolles Pendant zu seiner 1912 erschienenen Novelle „Tod in Venedig“ schwebt dem späteren Nobelpreisträger vor, als er im Juli 1913 mit dem Schreiben des „Zauberbergs“ beginnt.
Humorvoll zu nennen ist der fast 1000seitige Roman allemal. Bedenkt man nur die Darstellungen der skurrilen Bewohner des Berghofes, die vor allem während der Einnahme der Mahlzeiten im Speisesaal in Augenschein genommen und vorzüglich beschrieben werden. Da wäre zum Beispiel jene hasenzähnige Frau Stöhr, Musikergattin aus Cannstatt, die ungebildet ist, aber gerne das Gegenteil wäre und ein Faible für Fremdworte hat, was zu allerlei Stilblüten führt. Ferner der nicht näher benannte junge Mann „mit dünnem Schnurrbart und einem Gesichtsausdruck, als habe er etwas Schlechtschmeckendes im Mund …“
Eine der skurrilsten Szenen ist die Abschiedsrede des Mynheer Pieter Peeperkorn vor einem Wasserfall. „Und plötzlich begann er zu sprechen. Dieser wunderliche Mann! Es war unmöglich, daß er seine eigene Stimme hörte, geschweige daß die anderen eine Silbe hätten verstehen können von dem, was er verlauten ließ, ohne daß es verlautete …“ In der darauffolgenden Nacht setzt der Mynheer, der keinen Satz zu Ende spricht, mit nachgebauten, giftigen Schlangenzähnen seinem Leben durch eigene Hand ein Ende.
Parallelen zum „Tod in Venedig“ bemerkbar
Aber „Der Zauberberg“ wäre nicht Jahrhundertroman genannt, bildete er nicht wie unter einem Brennglas die gesamteuropäische, fiebrige, auf eine reinigende Kraft hoffende Epoche vor dem Ersten Weltkrieg ab. In einer Liste der französischen Zeitung Le Monde mit den hundert besten Büchern des zwanzigsten Jahrhunderts belegt der Roman Platz vierzig.
Als Krankheit, die spiegelbildlich für die Überreizung der Vorkriegszeit steht, wählt Mann statt der Cholera aus „Tod in Venedig“ die Tuberkulose. Beide Krankheiten führten zu Beginn des zwanzigsten Jahrhunderts in den häufigsten Fällen zum Tode.
Statt des bedauernswerten Gustav von Aschenbach aus „Tod in Venedig“ agiert im „Der Zauberberg“ als Hauptperson der farblose Hans Castorp, dreiundzwanzig Jahre alt, mit einem trägen Gemüt geschlagen und dennoch angehender Schiffsbau-Ingenieur aus Hamburg.
Eine Russin wird zum Ziel der Sehnsüchte Castorps
Anstelle des verführerischen Knaben Tadzio ersinnt Thomas Mann die schöne Russin Clawdia Chauchat mit den „schlechthin zauberhaft geschnittenen Kirgisenaugen“, welche Hans Castorp – allerdings erst im Kapitel vier nach einem seiner unzähligen Träume – an die Augen eines Schulkameraden mit Namen Pribislav Hippe erinnern. Fortan ist die schöne Russin für Castorp nicht nur ein Türen zuschlagendes Ärgernis, denn das Geräusch einer zufallenden Tür hat er schon immer gehaßt. „Sie sollte die Tür ordentlich zumachen! (…) Immer läßt sie sie zufallen. Das ist doch eine Unmanier.“
Sie avanciert zum Ziel seiner Sehnsüchte und sexuellen Begierden. In der letzten Nacht vor ihrem Weggang, in der Walburgisnacht, erhört sie ihn. Sie reist ab, er bleibt zurück und wartet auf sie. Als sie nach zwei Jahren zurückkehrt, ist sie in Begleitung des Mynheer Pieter Peeperkorn, mit dem Hans Castorp schon bald eine Freundschaft verbindet.
Was aus Castorp wird, bleibt unklar
Zwei weitere Akteure aus dem „Zauberberg“ sind Lodovico Settembrini und Leo Naphta. Mehr noch als Hans Castorp sind sie im Laufe der Jahre zum Gegenstand literaturwissenschaftlicher Betrachtungen geworden. Der Philosoph und Buchautor Rüdiger Safranski charakterisiert die beiden Kontrahenten wie folgt: „Settembrini, dieser stolze Sohn der Aufklärung, ein Freigeist, Humanist von unendlicher Beredsamkeit, ein Mensch des geistvollen Fortschritts; und Naphta, der scharfsinnige Jesuit mit dem düsteren Menschenbild, Großinquisitor des Geistes, der sich auf das abgründig Irrationale versteht und die Leute durch Schrecken zur Selbstbesinnung bringen will.“
Ihr ständiger Streit endet mit einem Pistolenduell, auf das Naphta unbedingt besteht. Settembrini schießt jedoch in die Luft, was Naphta so sehr empört, daß er den anderen als Feigling beschimpft und sich selbst in den Kopf schießt.
Was letztendlich aus Hans Castorp wird, läßt Thomas Mann offen, deutet aber an, daß er, der letztendlich in den Krieg zieht, nicht überleben wird. „Fahr wohl – du lebst nun oder du bleibst! Deine Aussichten sind schlecht; das arge Tanzvergnügen, worein du gerissen bist, dauert noch manches Sündenjährchen, und wir möchten nicht hoch wetten, daß du davonkommst.“
Im „Zauberberg“ erzählt Mann schließlich von sich
„Der Zauberberg“ ist in sieben Kapitel und weitere Unterkapitel unterteilt. Ein auktorialer Erzähler führt durch die Handlung, bei deren Wiedergabe er immer wieder auf das einnehmende „Wir“ zurückgreift und so die Leser mit einbezieht.
Bis auf das zweite Kapitel verläuft der Ablauf der Geschichte chronologisch. Dieses Kapitel unterrichtet den Leser über den Werdegang Hans Castorps. Zwischen seinem fünften und siebten Lebensjahr verliert er seine Eltern. Seine Mutter stirbt an einer Embolie und sein Vater erliegt einer Lungenentzündung. Für kurze Zeit lebt er bei seinem Großvater, den ebenfalls eine Lungenentzündung dahinrafft, und letztendlich findet er bei seinem bestellten Vormund Konsul James Tienappel ein Zuhause.
Thomas Mann unterbricht die Arbeit am „Zauberberg“ während des Ersten Weltkrieges, verfaßt in jenen Jahren unter anderem den 600seitigen Essay „Betrachtungen eines Unpolitischen“ und nimmt die Geschichte des Hans Castorp erst 1919 wieder auf. Des Hans Castorp? Die Frage stellt sich und läßt sich, wenn man sich Thomas Manns Biographie vor Augen führt, mit „sowohl als auch“ beantworten. Der im vorigen Jahr verstorbene Schriftsteller Martin Walser zum Beispiel meinte dazu: „Der Roman erzählt, je länger er dauert, desto weniger von Castorp und desto mehr von Thomas Mann.“