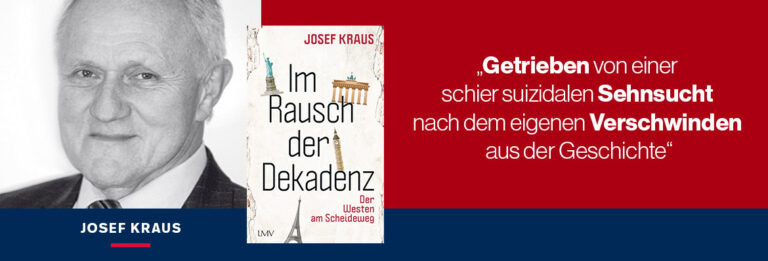François René de Chateaubriand (1768 -1848), hierzulande kaum bekannt, gilt Franzosen als großer Zeitzeuge und Begründer ihrer Romantik. Die freilich hat wenig gemein mit dem deutschen Pendant. Doch mag Chateaubriands Leben den polemischen Romantikbegriff eines Carl Schmitt illustrieren. „Romantischer Okkasionalismus“ meint hier jene parasitäre Subjektivität, die Gott und Welt zum Anlaß vagabundierenden Erlebniskonsums degradiert. Chateaubriands Freunde pointierten dies so: „Er will die verschiedenartigsten Sensationen haben, um seine Langeweile loszuwerden, das ist das Ziel seines Lebens.“ Tatsächlich zeigte er Egomanie, Eitelkeit und Hang zur Selbstinszenierung. Legendär wurden läppische Bonmots wie: „Ich und Napoleon“, „mein spanischer Krieg“, „ich brachte die Bourbonen zurück“ und „öffnete dem französischen Volk die Kirchen“. Nie überwand der grandiose Snob seine mentale Seekrankheit. Die freilich entsprang der Zeitkrise, war vom Schicksal aufgezwungen. So mischten Spiegelfechterei und Weisheit sich und offenbarten sein Lebensgesetz: „Ich hatte in meiner Person die Ideen, Ereignisse, Katastrophen, das Heldenlied meiner Zeit darzustellen. (…) Ich habe mich zwischen zwei Jahrhunderten wie in dem Zusammenfluß zweier Ströme befunden, bin in ihre aufgewühlten Gewässer getaucht.“ Der 1768 Geborene aus bretonischem Adel wurde 1786 Offizier, erkundete „rousseauistisch“ Amerika (1791), wurde in der Emigrantenarmee 1792 verwundet und verbrachte die Jahre 1793 bis 1800 im englischen Exil, von wo aus er literarisch debütierte. 1797 erschien sein flauer Revolutionsessay und 1801 die Novelle „Atala“, die exotisch Urwald, Indianer, Liebe, Tod und Glauben motivisch verschmolz und einen empfindsamen „Werther-Kult“ auslöste. Zum Coup wurde sein „Genius des Christentums“ 1802, bedeutsam für Kirchenpolitik wie die Autorenkarriere selbst. Chancen kamen mit den Bourbonen (1815). Als Pair führte er die royalistischen Ultras und pendelte doch zwischen Restauration und Konstitutionalismus. „Wenn ein Staatsmann nicht gegen die Sturzflut des Jahrhunderts angehen kann, so ist es noch sinnloser, sich ihr blind auszuliefern. Da wir der monarchischen Ordnung aus Vernunft anhängen, halten wir die konstitutionelle Monarchie für die bestmögliche Regierungsform.“ Er gründete das erste konservative Organ (Conservateur, 1818-20), avancierte diplomatisch und führte als Außenminister 1822 den zwischen christlicher Allianz und französischem Hegemoniestreben schillernden Interventionskrieg in Spanien. 1824 kaltgestellt, zog der Vicomte sich 1830 aus der Politik zurück. Das „Bürgerkönigtum“ verdroß ihn: „Als Republikaner von Natur, als Monarchist aus Vernunft, als Bourbone aus Ehre hätte ich mich viel besser in einer Demokratie eingerichtet als in dieser Zwittermonarchie.“ Er vollendete noch sein Hauptwerk, die autobiographischen „Erinnerungen von jenseits des Grabes“ (1850). Nach deren Neuausgabe 1994 erscheint jetzt auch das Religionswerk seit 1844 erstmals wieder deutsch. Wie Chateaubriand selbst schillert auch dieser Text zwischen sentimentalem Ichkult und überpersönlicher Treue. Doch kam der Band zur rechten Zeit: Napoleon wollte konsolidieren, der Autor reüssieren, das Publikum die unpolitische Gefühlspause. Ins frische Konkordat platzte der „Genius“ herein – mit ungeheurem Erfolg. Erstmals reagiert die französische Literatur auf die „Tabula rasa“ Gottes nach Aufklärung und Revolution. Der Autor weiß, daß man neu ansetzen und für die Religion werben muß. Die Gottesfrage wird zu der nach religiöser Plausibilität an sich. Herkömmliche Argumente versagen. So sucht Chateaubriand posttheologisch vom historischen Befund aus, christliche Wahrheit nun als Wesen Europas zu erweisen. Zeigen müsse man, daß der Glaube aufklärungskompatibel sei, „endlich aber sein hohes Alter und seine Heiligkeit samt Größe und Erhabenheit anschaulich machen“. Der Autor beabsichtigt eine deskriptive Erscheinungslehre des Christentums, keine moderne Religionstheorie. Man findet eindrucksvolle Schilderungen, auch Splitter echter Intuition: „Wer die Religion wegwirft, hat das Mittel zerstört, das in den toten Teilen des Herzens die Empfindung wiederherstellen kann.“ Chateaubriand demonstriert die „Zweckmäßigkeit“ Gottes aus der Natur und „Nützlichkeit“ der Religion in der Geschichte. Statt auf die „Kriminalgeschichte des Christentums“ (Deschner) richtet er den Fokus auf den Segen christlicher Einrichtungen. Sein „dogmatisches“ Verfahren indes, Material aufzuhäufen, statt Probleme auszuarbeiten, hochherzige Appelle statt analytischer Argumente zu geben – das kühne Projekt einer „historischen Theologie“ konzeptionell nicht zu durchdringen, bezeichnen die Schwäche des Werks, das zwar nicht dem Erkenntnisstand von 1800, dafür jedoch französischem Bedürfnis nach „Vernünftigkeit“ und „Sentiment“ in hohem Maße entsprach. Kritischem Vorbehalt zum Trotz ist das Verdienst hervorzuheben, uns diesen zentralen Text zum Religionsdiskurs erneut vorzulegen, dazu mustergültig aufbereitet und in sorgfältigster Gestalt. Jörg Schenuit (Hrsg.): François René de Chateaubriand: Geist des Christentums – Génie du Christianisme. Morus Verlag, Berlin 2005, gebunden, 779 Seiten, 49,80 Euro Foto: François de Chateaubriand
- Ausland