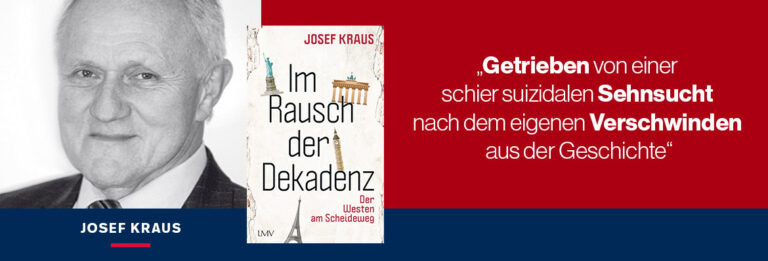Zur Eröffnung des Schlesischen Museums hätte die Stadt Görlitz das tun können, was ihr die Verfassung des Freistaates Sachsen nachdrücklich einräumt: die Farben Schlesiens zeigen. Sie hat es nicht getan. Überhaupt hielt man sich ausgerechnet am Tag, an dem die in der Bundesrepublik lebenden alten Schlesier, aber auch die in Oberschlesien verbliebenen Deutschen und die nach 1990 in die alte Heimat Zurückgekehrten auf die Stadt an der Neiße schauten, auffallend bedeckt. Die Görlitzer Kommunalpolitiker, die sonst stets die Rolle ihrer Stadt als „Tor nach Schlesien“ rühmen, taten alles, um die Beziehungen zur jenseits der Neiße liegenden Oststadt, dem heutigen Zgorzelec, nicht zu gefährden. Auch die Ausstellungsmacher haben sorgfältig alles vermieden, was noch heute deutsch-polnische Kontroversen auslösen könnte. Das Ergebnis: Das Kapitel der Vertreibung von 3,2 Millionen Schlesiern aus ihrer angestammten Heimat kommt derart nüchtern daher, daß es den Erwartungen der Erlebnisgeneration gewiß nicht gerecht wird. Auf die Erzählungen von Zeitzeugen in Form von kurzen Videosequenzen wird – obwohl überall sonst Multimedia im Einsatz ist – bewußt verzichtet. Auch die Koffer, Taschen und Haustürschlüssel, die Vertriebene dem Museum überlassen haben, werden anders als bei einer früheren Sonderausstellung nur sehr zurückhaltend zur Schau gestellt. Und Museumsdirektor Markus Bauer hat den Gegenständen der deutschen Vertriebenen die von einem aus Ostpolen vertriebenen und in der Görlitzer Oststadt angesiedelten Polen mitgeführte Kupferpfanne entgegengesetzt. Ein Prozent der Ausstellung für die Heimatvertriebenen Bauer hat in den vergangenen Jahren die Gelegenheit genutzt, in mehreren Ausstellungen zum Thema Schlesien in Görlitz die deutsch-polnischen Empfindlichkeiten zu testen. Und diese sind noch immer enorm – insbesondere was die Landsmannschaft Schlesien betrifft. Daß deren Bundesvorsitzender Rudi Pawelka, der auch Aufsichtsratsvorsitzender der Preußischen Treuhand ist, Mitglied im Stiftungsrat des Schlesischen Museums ist, bereite ihm schon Probleme, sagte Bauer auf entsprechende Nachfragen polnischer Journalisten. Andererseits habe der Stiftungsrat keinen Einfluß auf die inhaltliche Ausgestaltung des Hauses gehabt. Bauer würdigt natürlich auch das Engagement der Landsmannschaft Schlesien, die die Entstehung des Museums seit den 1980er Jahren entscheidend vorangetrieben hat. Deren Ehrenvorsitzender Herbert Hupka gilt Bauer sogar als eigentlicher „Vater des Museums“. Hupka habe den entscheidenden Anstoß gegeben. Nach der Wiedervereinigung Deutschlands wurde das geplante Landesmuseum für die vertriebenen Schlesier allerdings nicht wie geplant in Niedersachsen, sondern in der letzten zur Bundesrepublik Deutschland gehörenden schlesischen Stadt, in Görlitz errichtet. Auch die Aufgabe hat sich geändert. Es soll jetzt nicht mehr „eine Art Heimatstube sein, die sentimentale Assoziationen weckt“, sondern eine zentrale museal-wissenschaftliche Einrichtung für die Kulturgeschichte Schlesiens, die schlesisches Kulturgut sammelt, bewahrt und präsentiert. Für das Schicksal der deutschen Heimatvertriebenen bleiben da gerade mal zwanzig von insgesamt zweitausend Quadratmetern Ausstellungsfläche übrig. Gewiß ist die Nachkriegszeit nur ein Kapitel in der 900jährigen schlesischen Geschichte, aber keines hat so entscheidende Auswirkungen gehabt. Nach der vier Jahrhunderte währenden Herrschaft der polnischen Piasten habe sich der Kreis nach dem Zweiten Weltkrieg auf dramatische Weise geschlossen, sagte der polnische Historiker Andrzej Tomaszewski in seiner Festansprache vergangenen Sonnabend. Der frühere Landeskonservator räumte ein, daß der „Propagandamythos vom Ewigen Polentum“ eine Manipulation des kommunistischen Regimes gewesen sei und die Polen gegenüber Europa und den Deutschen die Schuld für einen „schweren Kulturverlust“ tragen, als in den ersten Nachkriegsjahren beträchtliche Mengen historischer Bausubstanz im Rahmen der „Entprussifizierung der Kulturlandschaft“ vernichtet wurden. Die Dauerausstellung des Schlesischen Museums weiß davon nichts zu berichten. Auch das Elend der Vertreibung, die Morde und Massenvergewaltigungen an der deutschen Bevölkerung habe man explizit nicht thematisieren wollen, sagt Bauer. „Greuelgeschichten“ habe man nicht im einzelnen dargestellt, einige der damaligen Ereignisse aber „in einiger Deutlichkeit“ zum Ausdruck gebracht. Kulturgeschichte statt politischer Botschaften Damit meint der Museumsmann, der selbst keine schlesischen Wurzeln hat, den in einer Vitrine ausgestellten Bericht Heinz Essers über die schrecklichen Ereignisse im Internierungslager Lamsdorf, das ab Juli 1945 existierte. Durch Seuchen, unmenschliche Behandlung und Gewaltexzesse seien dort Hunderte Deutsche ums Leben gekommen, heißt es im Begleittext. Dieser wurde – als einziger in der ansonsten konsequent in deutscher und polnischer Sprache ausgeschilderten Schau – nicht übersetzt. Soviel geschichtliche Wahrheit wollten Bauer und sein Team den Nachbarn dann doch nicht zumuten. Eine Vitrine weiter heißt es unkommentiert, daß die Aussiedlung der Deutschen in „ordnungsgemäßer und humaner Weise“ erfolgen sollte. Über die tatsächlich gehandhabte Praxis erfährt der Ausstellungsbesucher kein Wort. Dabei könnten sogar die alten Görlitzer viel über das brutale Vorgehen der polnischen Milizen nach der deutschen Kapitulation erzählen, gegen deren Übergriffe die Bürger der Neißestadt sogar russische Soldaten um Schutz baten. Das Kriegsende sei von vielen Schlesiern als Befreiung empfunden worden. Absicht des Museums sei es auch, die „Erfahrungen von Vertriebenen zu korrigieren“ – was von Angehörigen der Vertreibungsgeneration als „Ohrfeige“ empfunden wird. Ebenfalls ausgeklammert wird die Situation der heute in Oberschlesien lebenden Deutschen. Lapidar heißt es: „Seit Errichtung des demokratischen Polens erhielten die im Land verbliebenen Deutschen kulturelle Autonomie und eine politische Vertretung im Sejm.“ Das Schlesische Museum hat aber aktuell noch ein weiteres Problem. Im fehlen die Ausstellungsstücke. Auf den zweitausend Quadratmetern Fläche sind gerade einmal tausend Kunstgegenstände aus Schlesien zu sehen. „Wir mußten in ganz kurzer Zeit wichtige Objekte zusammenraffen“, sagt Bauer. Unterstützung leistete dabei der Bund, der von zahlreichen westdeutschen Museen Leihgaben für Görlitz zurückforderte, was „uns nicht gerade Freunde gemacht hat“, wie der Direktor einräumt. Da dem Museum der polnische Antiquitätenmarkt aufgrund von Ausfuhrverboten verschlossen ist und sich viele kleine deutsche Heimatmuseen nicht von ihren Schätzen trennen wollen, wurde das Kulturhistorische Museum Görlitz zum wichtigsten Leihgeber. Weitere wertvolle Gegenstände – vor allem Porzellan, Münzen und Gemälde – wurden von alten Schlesiern zur Verfügung gestellt. Das Glanzstück der Ausstellung, eine um 1410 in Schlesien entstandene geschnitzte Mondsichelmadonna aus Lindenholz, ist wiederum eine Leihgabe der Bundesrepublik. Welche Botschaft letztlich vom Schlesischen Museum zu Görlitz ausgehen wird, ist noch ungewiß. Bauer selbst scheint sich uneins zu sein: Aufgabe sei es nicht, politische Botschaften zu vermitteln, sondern Kulturgeschichte zu dokumentieren. Dennoch fügt er hinzu: Die Botschaft sei die schlesische Toleranz, die in einer europäischen Landschaft entstanden ist, in der sehr unterschiedliche ethnische und konfessionelle Kulturen zusammen und gegeneinander gelebt haben. Dann wieder spricht Bauer auch von einem Signal, das von dem Museum ausgehe: „Man kann von der Vertreibung nicht schweigen, wenn man von Schlesien spricht.“ Das Schlesische Museum zu Görlitz, Brüderstraße 8, ist täglich geöffnet von 10 bis 17 Uhr. Der Einritt kostet 3 Euro, ermäßigt 1,50 Euro. Internet: www.schlesisches-museum.de Foto: Museumsmitarbeiter Martin Kügler sortiert eine Sammlung von Rübezahlfiguren: Kaum Exponate