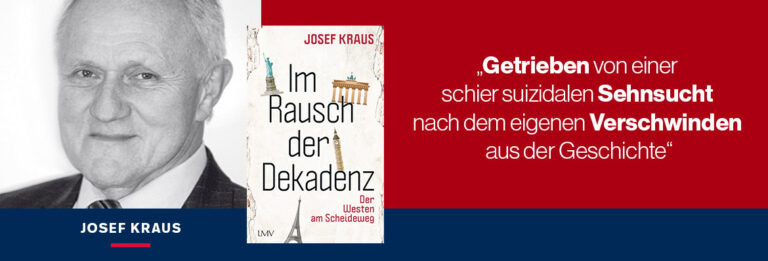Es sind genau zwei Mißgriffe, die sich dieses Buch leistet. Sie betreffen reine Äußerlichkeiten, Titel und Titelbildgestaltung. Das ist deshalb bedauerlich, da es sich hierbei um eine der brisantesten, diskussionswürdigsten Neuerscheinungen dieses Jahres handelt. „Die Helden der Familie“, titelt der hundertseitige, essayistische Text des Kommunikationstheoretikers Norbert Bolz, und der Umschlag zeigt ein grobgerastertes Paßfoto von Bolz in Schwarzweiß; Denkerfalte, Fischgrätsakko, Krawatte. Das mag leidlich seriös wirken, aber auch als Einfallstor für Kritik, die ohnehin heftig sein wird: Die Antimodernität seiner These wird die breite Schneise sein, auf der die Einwände gegen Bolz losrattern werden. Des weiteren geht es Bolz gar nicht um die „Helden der Familie“, sondern allenfalls um die Familie als eigentliche Helden unserer Zeit. Dabei würde selbst dies ein Pathos suggerieren, das dem Autor fremd ist. Norbert Bolz ist kein Schwärmer, der Predigerton ist ihm fremd. Sein Zugriff – hier: auf die Bedeutung der Familie im politisch korrekten, feministischen Wohlfahrtsstaat – führt einen gänzlich anderen Ton als den seiner Kollegen aus der Meinungsmacherriege. Als solche haben jüngst FAZ-Mitherausgeber Frank Schirrmacher und Welt-Chef Christopher Keese affirmativ und appellartig, nach Gemeinplätzen und Verkaufsrängen heischend, über gesellschaftlichen Zusammenhalt und Verantwortlichkeit referiert. Bolz pflegt das gleiche Thema in deutlich veränderter Stimmlage: nüchtern, illusionslos, hart an der Anthropologie, scharf in der Analyse. Im Chor der allbekannten Klagen (über: Kindermangel, Vereinbarkeitsprobleme, Generationengerechtigkeit) sind seine Thesen bislang unerhörte. Das sollte sein Buch zur Pflichtlektüre für Mitredner machen. Bolz ist ein Meister der Zuspitzung, relativierende Annäherungen sind nicht seine Sache. Und so geht es auch hier gleich in die vollen. Die alten Bilder idyllischen Familiengeistes, stellt er fest, seien „aus der Bastelstube unserer Lebensstile“ verschwunden. Als tiefgreifende und nach wie vor gültige Analyse zieht er Oswald Spenglers These „Über die Unfruchtbarkeit des zivilisierten Menschen“ heran. Nicht als Individuum, aber als Typus habe sich der Mensch aufgegeben. Der Gedanke an das Aussterben seiner Familie schrecke ihn nicht mehr. Auf die Frage „Wozu Kinder?“ findet er keinen Grund – und hat deshalb auch keine. Bolz konstatiert eine Verschärfung des Spenglerschen Szenarios innerhalb der letzten fünfzig Jahre: Sexuelle Freizügigkeit, antiautoritäre Erziehung, den unaufhaltsamen Aufstieg des Feminismus, die Erfindung der Pille, die „Eroberung der Kulturbühnen und Straßen der Metropolen durch Homosexuelle“ sowie weitgehende wohlfahrtsstaatliche Maßnahmen hätten zur Auflösung der Familie beigetragen. Eine simple, schwer zu widerlegende Feststellung, doch für Bolz noch kein Grund zum Lamento: Vielmehr gelte es zu fragen, inwieweit die Hoffnung „sozialdemokratischer Soziologen“ begründet ist, in dieser Zersetzung eine Chance zu sehen. Es trägt zur Klasse von Bolz‘ Argumentation bei, daß er nichts per se verklärt: die Liebe nicht, auch nicht Ehe und bürgerliches Küchenidyll, nicht einmal Elternschaft an sich. Darum kommt sein Band nicht als Philippika daher, sondern als kalte Rechnung der Logik. Nie zeternd, allenfalls mit verhaltener Lakonie, beschreibt Bolz den Ist-Zustand und legt dar, warum es so kommen mußte. Zum Beispiel in bezug auf Rollenbilder, auf das also, was wir unter weiblicher und männlicher Identität fassen. Je schwächer und weniger einleuchtend die „sexuelle Arbeitsteilung“ (also die Zuordnung der Frau zum reproduktiven, des Mannes zum produktiven Bereich) geworden sei, desto schwächer sei natürlicherweise die ökonomische Reziprozität zwischen Mann und Frau – und desto schwächer die Gefühle, die sie aneinander binden. Der frühere männliche Wettbewerb um die Frau habe sich in einen Wettbewerb mit der Frau verkehrt. Zugleich trete eine „Maskulinisierung des Zuhause“ (durch Outsourcing der Erziehungsaufgaben; Bolz nennt diesen „Kulturkampf um Kinder“ einen „Betreuungswahn“) sowie eine „Feminisierung des Arbeitsplatzes“ (durch die Neubewertung von soft skills wie Kommunikation, Verständnis, Teamgeist) zutage. Solche Rollenambiguität mache unglücklich, zumindest aber unsicher – ein zur Familiengründung denkbar schlecht geeigneter Boden. Ein weiteres Beispiel für das Schwinden von „Leitunterscheidungen“ liefert der derzeit populäre Entwurf der „jungen Alten“. Für die Generation der 68er und ihrer jüngeren Geschwister sei der Sinn des Lebens nicht mehr Reproduktion, sondern – allenfalls – Produktion; der Lebensinhalt Konsum statt Kinder und das Ziel ein quantitatives: länger zu leben. Es gelte nicht mehr, den Jahren Leben hinzuzufügen, sondern dem Leben Jahre: „Seit sich das Leben des einzelnen nicht mehr rundet, erscheint die Endlichkeit des Lebens ohne Sinn.“ Mit Lösungen für das Dilemma, das uns die Masse der sogenannten Dinks, der Singles und der Best Ager bereitet, hält sich Bolz freilich zurück. Das Schrauben an Symptomen ist nicht sein Metier – ohnehin könne man in Deutschland „über Bevölkerungsproblematik nicht reden, ohne die Linken, die Frauen und die Rentner zu provozieren“. Die klassische Familie als gesellschaftliches Orientierungsschema habe ausgedient, „nur Narren können glauben, es gäbe einen Weg zurück“. Wer heute eine Familie gründe, tue es „trotzdem“ und angesichts der Umstände mit fast heldenhaftem Mut. Bolz, den man aufgrund seiner breiten Medienpräsenz und seines Hangs zu herausfordernden Interventionen – zuletzt als Autor eines „Konsumistischen Manifests“- bisweilen als blasierten „Theorie-Dandy“ schimpfte, ist zweifelsohne ein Provokateur – ein Schwätzer aber ist er nicht. Der Wagemut seiner Thesen hebt ihn wohltuend ab von seinen Kollegen, die betulich und quotensicher am Zeitgeist entlang-surfen und, offen für mannigfaltiges Wenn-und-Aber, haarscharf am eigentlich Notwendigen vorbeischreiben. Das Private ist wieder politisch geworden. Die demographische Debatte bringt es mit sich, daß an jenem eigentlich konservativen Gebot der Trennung von öffentlicher und persönlicher Sphäre gerüttelt wird. Das beschneidet nicht die Freiheit der privaten Lebensgestaltung. Und doch gilt das Bolzsche Diktum, daß, wer keine Kinder hat, kein existentielles Interesse an der Zukunft beanspruchen könne. Es sei nicht sinnvoll, zu erwarten, daß einer von seiner eigenen Person abstrahiere, wo es um „Fragen der Identität, des Glücks und des Lebenssinns“ gehe. Bolz selbst, Jahrgang 1953, ist „verheiratet mit einer Frau, die auf amtliches Befragen ‚Hausfrau‘ als Beruf angibt, und Vater von vier schulpflichtigen Kindern“. Norbert Bolz: Die Helden der Familie. Wilhelm Fink Verlag, München 2006, kartoniert, 119 Seiten, 9,90 Euro