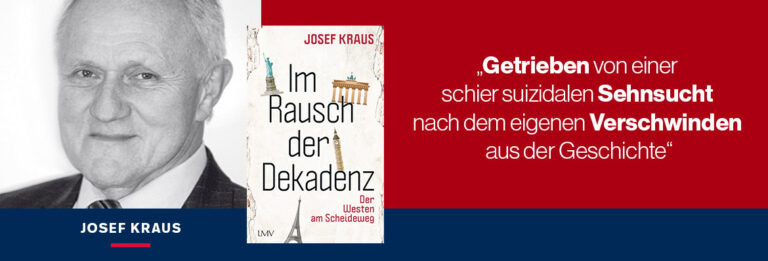Als die Reste der eingeschlossenen 6. Armee im Stalingrader Kessel am 31. Januar beziehungsweise am 2. Februar 1943 kapitulierten, war der Name der Stadt bereits zum deutschen und russischen Mythos geworden. Die Deutschen sollte der tragische Ausgang dieser Schlacht an die heldenhafte Aufopferung für ein gemeinsames Ziel erinnern und sie zu höherer Anstrengung bei der Erzwingung des „Endsieges“ veranlassen. Für die Sowjetbürger wurde Stalingrad zur nationalen Heiligstätte erklärt, die für immer mit der Wende im „Großen Vaterländischen Krieg“ verbunden sein sollte. Während in Rußland bis heute an dieser kollektiven Interpretation aus der Stalin-Ära kaum gerüttelt wird, war der deutsche Mythos nach der Kapitulation 1945 obsolet geworden. So setzte sich rasch nach dem Krieg die Auffassung durch, daß Stalingrad einen der besten Beweise dafür böte, wie der einfache Soldat ohne jedes Bedenken von seiner militärischen und politischen Führung „verheizt“ worden sei. Dieses einseitige Bild hat sich mittlerweile durch die populären Beiträge in den Medien und durch Filme, wie etwa Josef Vilsmeiers Leinwanddrama „Stalingrad“ von 1994, zum allgemeinen Gedankengut in den Köpfen vieler Deutscher etabliert. Auch das pünktlich zum 60. Jahrestag der sowjetischen Umklammerung vom 22./23. November 1942 vorliegende Werk von Kurt Pätzold „Stalingrad und kein Zurück – Wahn und Wirklichkeit“ orientiert sich an der verbreiteten These des „sinnlosen Sterbens“. Gerade deswegen überrascht aber, mit welcher Vehemenz der zur obersten Nomenklatur der DDR-Historiker zählende, bis 1992 an der Humboldt-Universität zu Berlin lehrende Autor seine Thesen in einen schroffen Gegensatz zu aktuell verbreiteten Auffassungen zu rücken versucht. So geht Pätzold davon aus, daß das heutige Bild von Stalingrad immer noch weitestgehend mit dem der jungen Bundesrepublik vor 45 Jahren in Übereinstimmung steht; einer Phase, in der das Ziel der raschen Wiederbewaffnung einige taktische Konzessionen hinsichtlich der gängigen Auffassungen von der Offiziers- und Soldatenrolle ermöglichte. Dies war allerdings in Mitteldeutschland nicht anders, wo die allgemeine Militarisierung der Gesellschaft noch weitaus tiefgreifender war, wenn auch dort solche Widersprüche aufgrund einer zentralistisch ausgerichteten Monopolpresse und der Unterdrückung öffentlicher Auseinandersetzungen besser kaschiert werden konnten. So reibt sich der Leser verwundert die Augen, wie Pätzold in kaum nachvollziehbarer Art und Weise gegen den bei der jüngeren und mittleren Generation größtenteils in Vergessenheit geratenen Roman des Vielschreibers Heinz Konsalik „Der Arzt von Stalingrad“ aus dem Jahr 1958 wütet. „Dieses Machwerk“, das an die „Nazipropaganda gegen die Bolschewisten“ anknüpfe, so Pätzold, war „hochgradig kitschig“ und „paßte in die Zeiten des kalten Krieges“. Dem Geist dieser Epoche entspringen allerdings weitaus eher die eigenen Ausführungen des Autors zum angeblich immer noch präsenten „Helden- und Opfermythos“ Stalingrads. Dieser sei „von den faschistischen Machthabern zum Zwecke der Massenmobilisierung“ gepflegt worden, habe „in Westdeutschland überdauert“ und werde noch heute „von einer Minderheit zwischen Saar und Oder gepflegt“. So erscheint die gedankliche Nähe zu den Installateuren der „sogenannten Wehrmachtsausstellung“ (Pätzold) nahezu zwangsläufig, denen er im Vorwort eine Empfehlung zur Erweiterung seines Buches gibt: Die Geschichte der Stalingrader Schlacht müsse durch eine zweite mit dem Titel „Die Verbrechen deutscher Militärführer am deutschen Volk“ ergänzt werden. Allerdings wird in diesem Zusammenhang nicht auf die Option einer Aufgabe der Kampfhandlungen im Kessel von Stalingrad eingegangen, wohlweislich, daß damit auf das Schicksal der etwa 118.000 Soldaten nach der Kapitulation eingegangen werden müßte, von denen bis auf 6.000 Heimkehrer alle in der sowjetischen Gefangenschaft jämmerlich zugrunde gegangen sind. Als bessere Herangehensweise gegenüber den kritisierten westdeutschen Werken betrachtet der Autor die zentrale Abarbeitung der Frage: „Was hatten wir (die Deutschen) in Stalingrad zu suchen?“ Es handelt sich dabei allerdings um einen simplen psychologischen Trick, denn erwartungsgemäß vermag der Autor darauf keine Antwort zu finden. Da er bei den deutschen, im Gegensatz zu den sowjetischen Truppen keine militärpolitischen Optionen, sondern nur die aus der DDR-Historie bekannten wirtschaftlichen Faktoren anerkennt, wie die Eroberung von Rohstoffen und Industrien für „imperialistischen Interessen“, ist für Pätzold die Frage hinsichtlich von Alternativen nach der Schließung des Kessels auch rein hypothetisch. Immerhin erkennt er die Bereitschaft von vieler hoher Offiziere außerhalb des Kessels an, einen anfangs noch möglichen Entsatz der Eingeschlossenen zu starten. Wie vergeblich alle diese Versuche waren, hat schon Generalfeldmarschall Erich von Manstein in seinem Erinnerungsbuch „Verlorene Siege“ (1954) anschaulich geschildert. Für Pätzold sind diese Fakten allerdings nur marginale Details. Vielmehr versucht er, mit Hilfe von Feldpostbriefen zu belegen, daß die Ereignisse an der südlichen Ostfront vom Frühjahr 1942 bis Anfang 1943 auf die Zwangsläufigkeit des Untergangs der politischen und militärischen Verantwortungsträger und den von ihnen Geführten verweisen; eine Position, die wohl einer emotionalen Lagebeurteilung der Eingeschlossenen teilweise nahekommen könnte, doch kaum den Ansprüchen einer seriösen Geschichtsschreibung entspricht. Inhaltlich bringt die weitestgehend chronologische Schilderung wenig Neues, auch wenn sie teilweise sehr interessante Details nicht ausspart, wie zum Beispiel die Bewältigung der Niederlage in der deutschen Propaganda. Ein längeres Kapitel widmet Pätzold der bis heute umstrittenen Frage, inwieweit die Stalingrader Schlacht eine tatsächliche Wende im Zweiten Weltkrieg herbeiführte. Hier verweist Pätzold als Begründung in erster Linie auf die psychologische Ebene. Außer der endgültigen Zerstörung des Nimbus vom „unbesiegbaren Führer“ war die Wirkung der Niederlage vor allem in den mit Deutschland verbündeten Staaten, wie Kroatien, Rumänien oder Italien verheerend. Selbst wenn die Kampfkraft der verbündeten Truppen, die gegenüber verbreiteten Wochenschau-Darstellungen von Offizieren, aber auch in Tischgesprächen Hitlers aus den Jahren nach 1941 wohl berechtigterweise als nicht allzu hoch eingestuft wurde, so konnte Deutschland doch aufgrund seiner personell weitaus überlegenen Gegner auf jedes mögliche Hilfskontingent keineswegs leichtherzig verzichten. Eine ebenso unerwünschte Begleiterscheinung war die prompte Beendigung des finnischen Krieges gegen die UdSSR vom 3. Februar 1943, von der ein Domino-effekt befürchtet wurde. Irritation oder Verärgerung lösen neben den bereits erwähnten Schwachpunkten immer wieder die unverhohlene Sympathie des Autors mit Thesen und Termini der klassischen DDR-Gesellschaftswissenschaft, wie der „Verwirklichung imperialistischer Ziele“ oder „Expansionsstreben deutscher Monopole“ sowie die kategorische Vermeidung des Begriffes „Nationalsozialismus“ aus, was mittlerweile doch als etwas überholt gelten sollte. So hinterläßt Pätzolds Buch einen mehr als zwiespältigen Eindruck, der die Vorteile des flüssigen und gut lesbaren Schreibstils sowie der gelungen Darstellungsform bei weitem überdeckt. Kurt Pätzold: Stalingrad und kein Zurück – Wahn und Wirklichkeit. Militzke Verlag, Leipzig 2002, 208 Seiten, 17,90 Euro
- Ausland