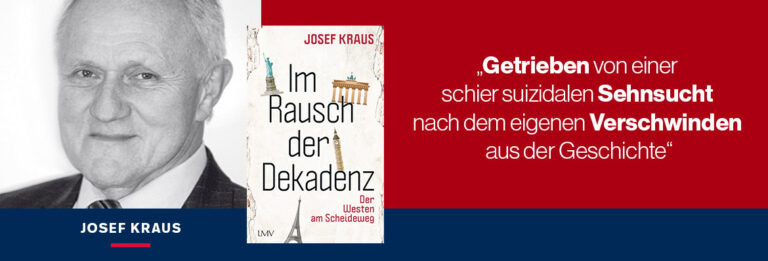Die selbstgebastelte Bombe war angebracht, die Lunte ausgelegt. Jetzt fehlte nur noch ein Streichholz. Dietrich Deutsch kramte in seiner Manteltasche.
Während er nach der Streichholzschachtel suchte, dachte er noch einmal darüber nach, was ihn um 3 Uhr morgens hierhergebracht hatte. Eigentlich war er kein Gewalttäter, hatte einen anständigen Beruf, führte eine glückliche Ehe und war Vater dreier liebenswerter Kinder. Aber vielleicht war auch genau dies der Grund für seine wachsende Unzufriedenheit mit den Zuständen, für diese innere Unruhe, die sich nicht mehr unterdrücken ließ.
In den Außentaschen seines Mantels wurde er nicht fündig. Jetzt versuchte er sein Glück in den Innentaschen. Dabei brummte er grimmig das „Ischias“-Lied.
Schon immer hatten ihn diese Türme aufgeregt; nein, nicht die Minarette, die in der Schweiz bereits verboten sind. Die muselmanischen Gebetstürme waren hierzulande ohnehin dünn gesät. Sein Groll richtete sich vielmehr auf die Säulen einer weltweiten Freßreligion, die auch dieses Land heimsuchte. Wie riesige römische Feldzeichen ragten die Türme empor.
Symbol kultureller Unterdrückung
Deutsch nannte sie „Mäst-Masten“. Passenderweise prangte auf ihnen ein großes, geschwungenes „M“. Wenn Deutsch durch das Land reiste, begegneten ihm diese Fremdkörper überall. Sie waren weithin sichtbar, besonders in der Nacht, wenn sie hell erleuchtet waren. Früher zeigten Kirchtürme an, daß man sich einer Ansiedlung näherte. Heute waren es diese Mäst-Masten. Auf Deutsch wirkten sie wie ein Spieß im Fleisch seines Landes.
Ein schwerer Lastwagen näherte sich. Deutsch sprang schnell hinter den Mast und machte sich klein. Der Brummi rauschte vorbei. Wo waren bloß die Streichhölzer?
Als Dietrich Deutsch seiner Lokalzeitung entnommen hatte, daß ein solcher Mäst-Mast auch im Gewerbegebiet seiner Gemeinde errichtet werden sollte, war für ihn das Maß voll. Sollte er jeden Tag an diesem Symbol kultureller Unterdrückung vorbeifahren müssen? Ihn schauderte. Für Deutsch stand fest: Der Mast mußte gesprengt werden, sobald er stand.
Im Mantel war keine Streichholzschachtel. Vielleicht war sie im Auto geblieben?
Mit Grausen erinnerte sich Deutsch an seinen ersten und letzten Besuch im Freßtempel. In diesen Abfütterungsanlagen durften die Gäste nicht mit Messer und Gabel essen. Die Angestellten durften nicht hinter der Theke hervorkommen. Sie hießen „Front Office Assistant Manager“, die „Face-to-face-Marketing“ betrieben, wenn sie die gebackenen Kartoffelstreifen hinschoben.
Niemand war gezwungen, in die Freßtempel zu gehen
Die Speisekarte war so gewählt, daß das Essen zwar dick, aber nicht satt machte. Einheimische Spezialitäten suchte man vergeblich. Den Salat, den seine Frau bekam, zierte eine verschimmelte Tomate. Darauf angesprochen entfernte der Angestellte das Gemüse und meinte, die Sache sei damit erledigt, denn der Rest sei ja einwandfrei und könne verzehrt werden. Deutsch wurde es übel, wenn er sich daran erinnerte.
Endlich hatte Deutsch die Streichholzschachtel gefunden. Sie hatte sich in der hinteren Hosentasche versteckt. Er zog die Schachtel heraus, wog sie prüfend in der Hand und betrachtete sie lange. Dann steckte er sie wieder ein.
Nun war ihm klar geworden: Niemand war gezwungen, in die Freßtempel zu gehen. Deutschland war geteilt: Die einen hatten ihre Identität aufgegeben und waren zum Spielball der Konsumverführer geworden. Die anderen hielten mehr oder weniger bewußt und mehr oder weniger stark an Sitten und Gebräuchen fest und bewahrten sich so eine gewisse innere Freiheit.
Dietrich Deutsch packte die Rohrbombe ein und machte sich auf den Weg nach Hause. Plötzlich bekam er Hunger. Er freute sich auf ein warmes Essen: am besten Bratkartoffeln mit Speck.
Irgendwann, so dachte er, irgendwann würde sich das deutsche Volk schon eines Beßren besinnen – wenn es dann noch da ist.
Die Handlung ist frei erfunden. Jede Ähnlichkeit mit wirklichen Personen oder Unternehmen wäre rein zufällig.