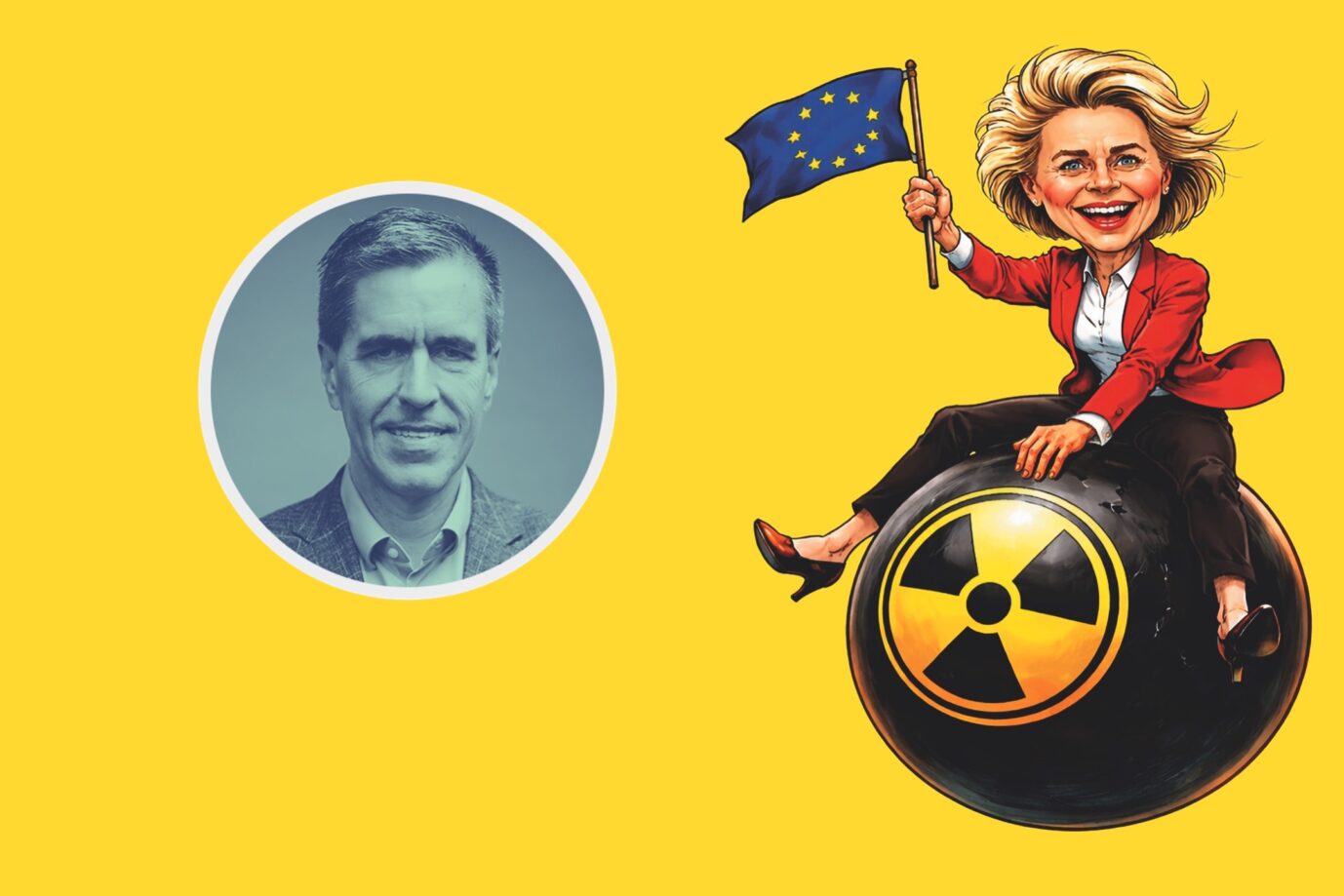Es klingt merkwürdig, aber ohne Joseph („Joschka“) Fischer und Daniel Cohn-Bendit gäbe es vermutlich keine CDU-Politikerin Erika Steinbach. Die „revolutionären Kämpfer“ der frühen 1970er Jahre hatten den Frankfurtern einiges zugemutet: Straßen wurden blockiert, Autos gingen in Flammen auf. Für die damals junge Informatikerin und ehemalige Violinistin Steinbach ein Schlüsselerlebnis. Sie schloß sich der CDU an, wurde Stadtverordnete, Chefin der lokalen Frauenunion („ohne feministischen Touch“) und zog 1990 erstmals in den Bundestag ein.
Schon als Kulturpolitikern warnte sie vor einem selektiven Umgang mit der Geschichte, sie geißelte die Ignoranz der politischen Klasse gegenüber dem Schicksal der deutschen Heimatvertriebenen. Ihre Wahl zur Präsidentin des Bundes der Vertriebenen (BdV) 1998 bescherte dem fast totgesagten Opferverband wieder öffentliche Resonanz: allein durch die von Steinbach initiierte Stiftung „Zentrum gegen Vertreibungen“. Gemeinsam mit dem Egerländer Peter Glotz (SPD) trommelte die im westpreußischen Rahmel, wo ihr Vater als Soldat stationiert war, geborene Unionspolitikerin einen Kreis namhafter Unterstützer zusammen.
Anfeindungen aus Polen
Herausgekommen ist nach langen Querelen in Berlin das Projekt eines „sichtbaren Zeichens“, die vom Bund getragene Stiftung „Flucht, Vertreibung, Versöhnung“, eingebettet in einen „europäischen Kontext“ – um Polen und Tschechen nicht zu nahe zu treten. Das Konzept wurde so verwässert, daß es der politischen Korrektheit nicht widerspricht. Glotz ist tot und die Ideengeberin Steinbach wurde vom Stiftungsrat ferngehalten, auf ihre eigene Partei konnte sie sich wie so oft nicht verlassen.
Eine Kapitulation vor den Attacken vornehmlich aus Polen. Warschauer Gazetten scheuten vor nichts zurück. Für sie war die BdV-Präsidentin, die 1991 gegen die Anerkennung der Oder-Neiße-Linie votiert hatte, die „blonde Bestie“, einige Blätter zeigten sie in SS-Uniform.
Selbst angesehene Politiker wie der frühere Außenminister Wladiyslaw Bartoszewski beteiligten sich an der Verteufelung. Steinbach sei eine „falsche Vertriebene“, höhnte Bartoszewski. Daß der Vater der Politikerin aus Niederschlesien stammt, wurde negiert, ebenso die Tatsache, daß Steinbach mit Mutter und Schwester das Schicksal von Millionen von Haus und Hof verjagter Ostdeutscher teilte.
Steinbach plädierte für einen „Heilungsprozeß“
Linke Deutsche und nationalistische Polen zogen an einem Strang. Sie ignorierten, daß die als „Revanchistin“ und „Nationalistin“ Geschmähte sich im christlich-jüdischen Dialog und in der Deutsch-Israelischen Gesellschaft engagierte, und als BdV-Präsidentin durch osteuropäische Hauptstädte tourte, um ihre Botschaft zu verkünden: Den Vertriebenen gehe es nicht um Eigentumsansprüche, sie erwarteten vielmehr, daß menschenrechtsfeindliche Gesetze und Dekrete, zum Beispiel die von Edvard Beneš, aufgehoben würden.
Steinbach plädierte für einen „Heilungsprozeß“, sie legte Prag und Warschau „symbolische Gesten“ nahe. Es gelang ihr, den damaligen Bundeskanzler Gerhard Schröder (SPD), der die Vertriebenen als „Randgruppe“ abgetan hatte, für eine Rede zum Tag der Heimat 2000 zu gewinnen. Jetzt, beim Baubeginn für das Dokumentationszentrum, sprach Bundeskanzlerin Angela Merkel von einer „breiten gemeinsamen Einigung“. Eine feine Umschreibung für den kleinsten gemeinsamen Nenner.
Entscheidend sei, gab die BdV-Chefin zu Protokoll, daß das Projekt überhaupt zustande komme. Es hat sie viel Kraft gekostet, die CDU-Dame mußte viele Anfeindungen ertragen. Am 25. Juli vollendet Erika Steinbach ihr 70. Lebensjahr. Sie tritt bei der Bundestagswahl noch einmal an; in einem Frankfurter Wahlkreis und auf Platz 5 der Landesliste. Ihr Wiedereinzug ins Parlament scheint gewiß. Der Bund der Vertriebenen ist damit, vielleicht zum letzten Mal, auf höchster legislativer Ebene präsent.
JF 30-31/13