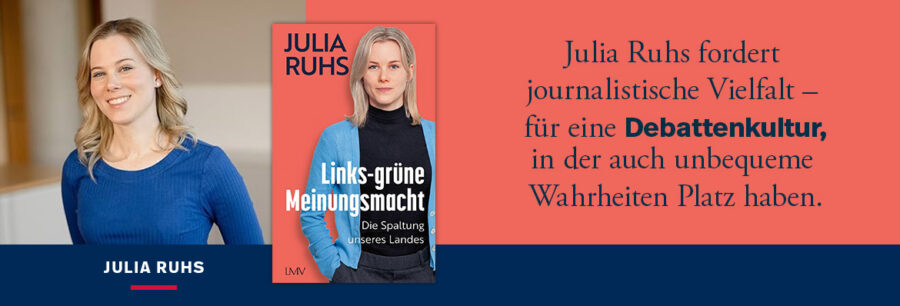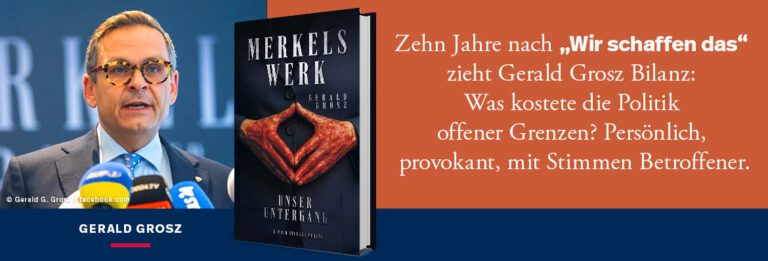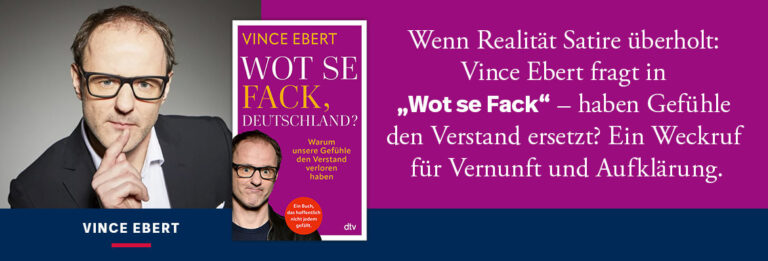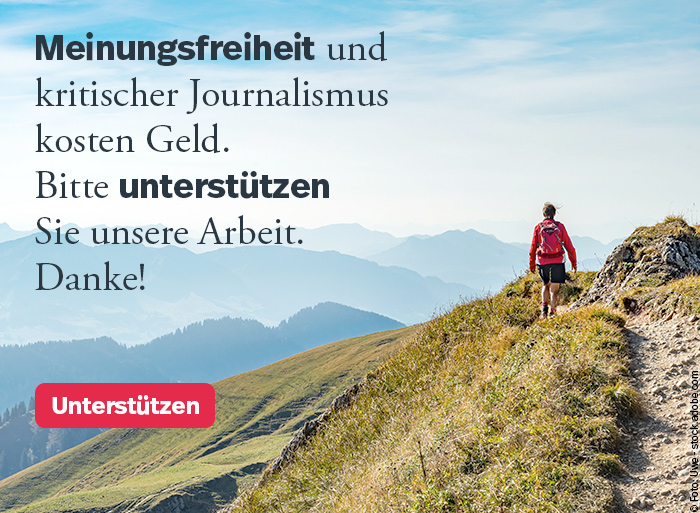Das einstige Wirtschaftswunderland wird zur Zentralverwaltungswirtschaft umgebaut. Wie weit dies bereits fortgeschritten ist, läßt sich aus dem 30. Subventionsbericht der Bundesregierung herauslesen. Detailliert listet das 637seitige Papier auf, wofür der Staat Finanzhilfen gezahlt und Steuervergünstigungen gewährt hat: Kommendes Jahr werden es fast 78 Milliarden Euro sein. Das sind 33 Milliarden mehr als noch 2023. Allein die direkten Finanzhilfen des Bundes für Firmen und Branchen sind 2024 auf über 59 Milliarden Euro gestiegen. 2019 waren es lediglich 10,5 Milliarden Euro gewesen.
Bei den Steuervergünstigungen – die eigentlich keine echten Subventionen sind, denn hierbei langt der Fiskus nur etwas weniger hin als anderswo – erhöht sich das offizielle Volumen 2025 gegenüber 2024 um gut eine Milliarde Euro auf 19,4 Milliarden. 2026 soll diese willkürlich ausgewählte Summe wieder auf 18,4 Milliarden sinken. Nicht berücksichtigt sind dabei Staatshilfen, die die EU auszahlt, für die aber der deutsche Steuerzahler zu einem Großteil – Stichwort Nettozahler – ebenfalls aufkommen muß. Wer zählt nun zu den „Begünstigten“ des staatlichen Geldregens, der überwiegend steuer-, aber auch zunehmend kreditfinanziert ist? So stiegen die Subventionen im Bereich Verkehr von 5,5 auf 8,2 Milliarden Euro.
Doch dabei geht es nicht um neue Straßen oder Brückensanierungen, sondern um „Finanzhilfen zur Errichtung von Tank- und Ladeinfrastruktur“ und die „Zuschüsse für die Anschaffung von Nutzfahrzeugen und Bussen mit alternativen, klimaschonenden Antrieben“ – sprich: E-Mobile, die teuer sind und sich nicht rechnen, sollen so in den Markt gedrückt werden.
Wohnungssubventionen fürs Klima – nicht für die Bürger
Die Subventionen für das Wohnungswesen steigen von 13,6 auf veranschlagte 16,6 Milliarden Euro im Jahr 2026. Dabei geht es aber nicht nur um eine Aufstockung bei den Bundesmitteln für den sozialen Wohnungsbau, um die Folgen der Massenzuwanderung erträglicher zu machen, sondern auch um die gezielte Förderung von „Maßnahmen der Energieeffizienz und erneuerbarer Energie“ – sprich: dies soll die teure Dämmung und die Wärmepumpe etwas bezahlbarer machen.

Makaber ist, was zu den Steuervergünstigungen zählt, die im Berichtszeitraum 2023 bis 2026 von 6,5 auf 5,1 Milliarden Euro sinken sollen: Dabei geht es vor allem um den „ermäßigten“ Mehrwertsteuersatz von sieben Prozent „für kulturelle und unterhaltende Leistungen“ wie Bücher, Eintrittskarten oder Zeitungen sowie die Gastrobranche und die Steuerbefreiung der gesetzlichen oder tariflichen Zuschläge für Sonntags-, Feiertags- und Nachtarbeit. Das heißt wohl: Die „Begünstigten“ sollen sich dafür bedanken, daß nicht nicht wie andere Bereiche mit 19 Prozent belastet werden bzw. weil sie arbeiten gehen, wenn andere sich ausruhen.
E-Mobilität allein frißt Milliarden
Haupttreiber der enorm gestiegenen Subventionen sind allerdings die Energiepreisstützen, die Unternehmen und Verbraucher entlasten sollen. Zu beachten dabei ist, daß die energieintensiven Branchen nicht von der jüngsten Stromsteuersenkung profitieren, weil sie schon zuvor von den Stromkostenerhöhungen ausgenommen worden waren. Warum die Subventionen um die gigantische Summe von rund 45 Milliarden Euro steigen, begründet das Bundesfinanzministerium letztlich mit den Kosten für die Umlage zur Förderung der erneuerbaren Energien (EEG), die der Bund seit 2024 übernimmt. Im vergangenen Jahr betrug der entsprechende Etatposten 18,5 Milliarden Euro.
Zuvor wurden die EEG-Kosten direkt über die Stromrechnung bezahlt. Nun wird das verschleiert: Die Ökostrom-Finanzierung kommt aus dem Steuerhaushalt und den Erträgen des Brennstoffemissionshandelsgesetzes (BEHG) von Angela Merkel, das Benzin, Diesel, Gas und Heizöl seit 2021 jährlich verteuert. Die auf das EU-Mindestniveau abgesenkte Stromsteuer für Unternehmen zählt selbstverständlich auch zu den Subventionen, denn die spült Lars Klingbeil jährlich etwa 2,5 Milliarden Euro weniger in seinen Bundesetat. Die im Wahlkampf versprochene Stromsteuersenkung für alle Haushalte hätte laut Finanzministerium weitere 5,4 Milliarden Euro „gekostet“ – dabei hätte es ausgereicht, die Milliardenförderung der E-Mobilität um zwei Drittel zu reduzieren.
Denn die „Förderschwerpunkte“ waren dem Subventionsbericht zufolge der „ökologische und digitale Wandel und soziale Aspekte“. Dazu gehörten Maßnahmen zur Dekarbonisierung des Verkehrs und Gebäudebestands, zur Förderung des Wasserstoffhochlaufs, der Mikroelektronik und des sozialen Wohnungsbaus. Rund 90 Prozent des Finanzhilfevolumens trage 2025 zu den Umwelt- und Klimaschutzzielen bei – sprich: Ohne Energiewende, Klimaideologie und Massenzuwanderung könnte der Bundeshaushalt von 503 Milliarden Euro um zig Milliarden Euro kleiner ausfallen.
Es könnte noch schlimmer kommen
Andererseits bestehen tatsächlich „massive Investitionsbedarfe mit Blick auf den Erhalt und die Modernisierung öffentlicher Infrastruktur“, wie der 30. Subventionsbericht zu Recht feststellt. Andererseits müsse der Haushalt konsolidiert werden: „Die Subventionspolitik steht im Spannungsfeld zwischen Investitionsbedarf und Konsolidierungserfordernis.“ Insbesondere die Subventionen müßten daher überprüft werden. Hier seien alle Ministerien aufgefordert, ihren Beitrag zu notwendigen Einsparungen zu leisten.
Das Bundeswirtschaftsministerium hat diesbezüglich am Montag schon geliefert: In den „Zehn Schlüsselmaßnahmen zum Monitoringbericht zur Energiewende“ stehen Vorschläge, die nicht nur den grünen Klimaideologen kaum gefallen dürften. So solle das „künftige Förderregime für erneuerbare Energien“ marktorientiert sein. Das bedeute: die konsequente Abschaffung der fixen Einspeisevergütung sowie die vollständige Beendigung der Vergütung bei negativen Strompreisen. Oder anders ausgedrückt: Die EEG-Subventionen sollen drastisch reduziert werden. Außerdem solle eine Verpflichtung zur Direktvermarktung für neue Photovoltaik- und Windkraftanlagen eingeführt werden. Die privilegierten Solar- und Windbarone sollen auf den rauhen Strommarkt gedrängt werden.
Aber es könnte für sie noch schlimmer kommen: „Wir bauen nur so viel zu, wie wir tatsächlich brauchen und es ökonomisch effizient ist. Wir vermeiden so ineffiziente Überkapazitäten. Ausbaupfade für erneuerbare Energien und Netzinfrastruktur sollen sich an realistischen Strombedarfsszenarien orientieren.“ Das klingt fast nach AfD oder BSW, stammt aber direkt aus dem Ministerium von Katherina Reiche (CDU). Und: „Alle Fördermaßnahmen und Subventionen werden auf ihren volkswirtschaftlichen Nutzen hin überprüft und auf das unbedingt nötige Maß reduziert.“ Würde das umgesetzt, könnte der 31. Subventionsbericht in zwei Jahren tatsächlich erfreulicher aussehen.