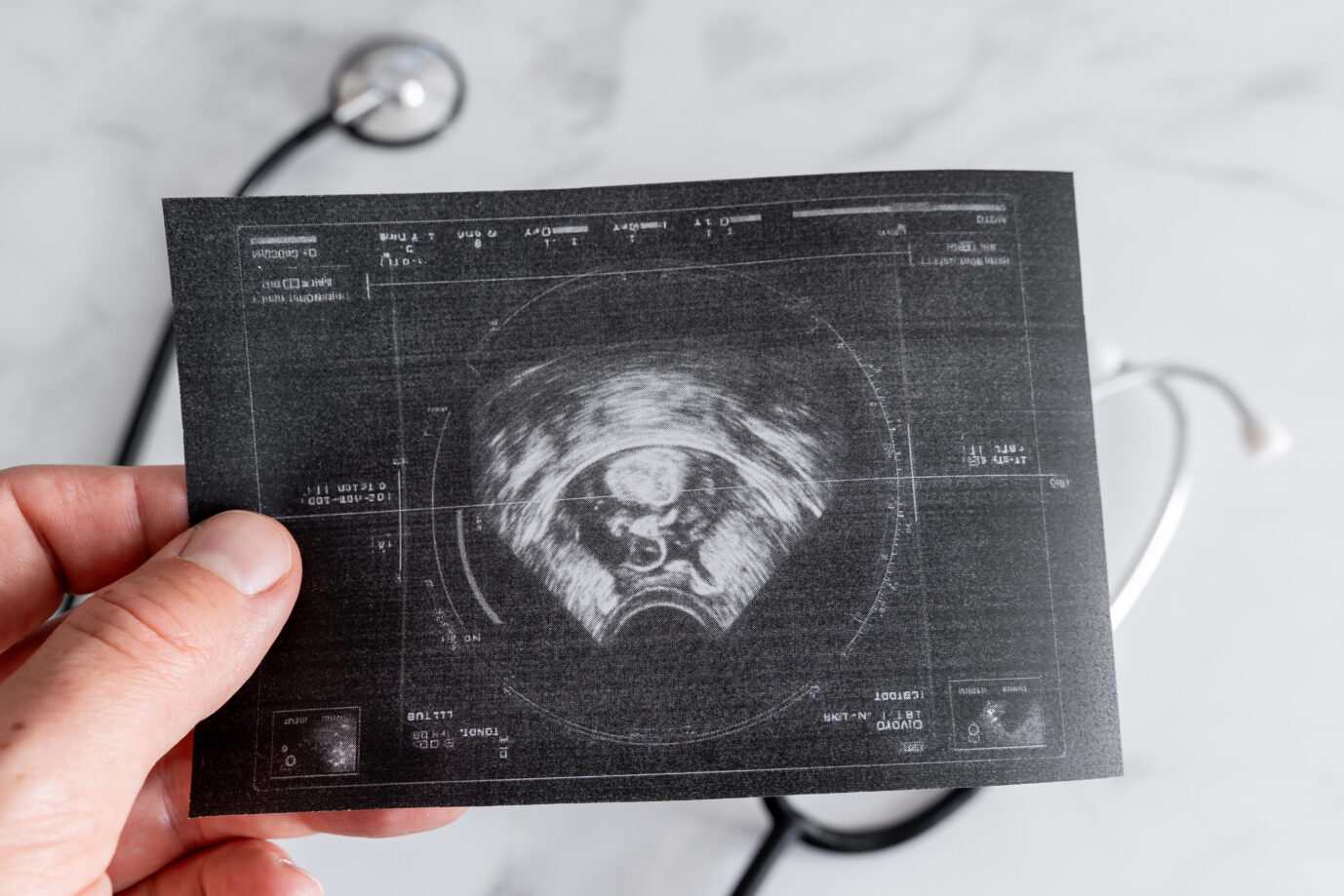Mit der Streichung des Paragraphen 219a StGB, die das Kabinett am 9. März auf den Weg gebracht hat und die von Bundestag und Bundesrat noch gebilligt werden muß, wollen SPD, Grüne und FDP den ersten Schritt zur Beseitigung des Lebensrechts ungeborener Kinder vollziehen. Die Marschroute zur vollständigen Beseitigung dieses Lebensrechtes ist im Koalitionsvertrag 2021 im Kapitel über die „reproduktive Selbstbestimmung“ vorgezeichnet: Schwangerschaftsabbrüche gehören nach Meinung der Ampelkoalition zu einer „verläßlichen Gesundheitsversorgung“. Sie sollen Teil der ärztlichen Aus- und Weiterbildung werden.
Deshalb sollen auch „Regulierungen für den Schwangerschaftsabbruch außerhalb des Strafgesetzbuches“ geprüft werden. Versuche von Lebensrechtsgruppen, abtreibungswilligen Schwangeren vor Abtreibungseinrichtungen Hilfen anzubieten, im Koalitionsvertrag „Gehsteigbelästigungen“ genannt, müßten durch „wirksame gesetzliche Maßnahmen“ verhindert werden. Die in der Corona-Pandemie eingeführte Schwangerschaftskonfliktberatung „online“ soll dauerhaft ermöglicht werden. Alle strafgerichtlichen Urteile gegen Ärzte auf Grund des Paragraphen 219a StGB oder seiner Vorgängervorschriften seit 1990 sollen rückwirkend aufgehoben werden.
Werbung für eine Straftat soll erlaubt werden
Paragraph 219a StGB verbietet Werbung für einen Schwangerschaftsabbruch. Er wurde erst 2019 von der Großen Koalition reformiert, um Ärzten die Möglichkeit zu geben, darauf hinzuweisen, daß sie Abtreibungen unter den Voraussetzungen des Paragraphen 218a Absatz 1 bis 3 StGB vornehmen. Man könnte meinen, der Paragraph sei nur ein kleines Steinchen im Wall, der das Leben ungeborener Kinder schützt; einem Wall, der nach den Urteilen des Bundesverfassungsgerichts von 1975 und 1993 verfassungsrechtlich geboten ist, weil sich das Grundrecht auf Leben in Artikel 2, Absatz 2 Grundgesetz auch auf das ungeborene Leben erstreckt.
Der Schwangerschaftsabbruch ist mithin eine Straftat, die unter den Voraussetzungen des Paragraphen 218a StGB straffrei bleibt. Paragraph 219a StGB verbietet also die Werbung für eine Straftat. Bundesjustizminister Buschmann behauptet, dieses Verbot behindere den Zugang zu fachgerechter medizinischer Versorgung und beeinträchtige „das Recht auf sexuelle und reproduktive Selbstbestimmung der Frau“.
Implizite Botschaften und fragwürdige Annahmen
Seine Beseitigung ermögliche es abtreibungswilligen Ärzten, „sachliche Informationen über das Spektrum ihrer Angebote und Leistungen auch öffentlich bereitzustellen“. Das Werbeverbot für Abtreibungen sei „kein tragender Pfeiler des grundrechtlich gebotenen Schutzkonzepts für das ungeborene Leben“. Seine Aufhebung schwäche den Schutz des ungeborenen Lebens nicht nur nicht, sie trage vielmehr dazu bei, zwei Ziele der Ampelkoalition zu erreichen, die so umschrieben werden: „Ein gesundes Leben für alle Menschen jeden Alters gewährleisten und ihr Wohlergehen fördern“ sowie „Geschlechtergerechtigkeit erreichen und alle Frauen und Mädchen zur Selbstbestimmung befähigen“.
Sieht man einmal von den impliziten Botschaften ab, daß ungeborene Kinder für die Ampelkoalition offenkundig nicht zu den Menschen gehören und daß sie ihre Tötung für ein geeignetes Mittel hält, „gesundes Leben“ zu ermöglichen und Frauen zur Selbstbestimmung zu befähigen, so sind zwei Annahmen des Bundesjustizministers in Frage zu stellen: erstens die Annahme, das Werbeverbot für Abtreibungen sei „kein tragender Pfeiler des grundrechtlich gebotenen Schutzkonzepts für das ungeborene Leben“ und zweitens die Annahme, Ärzte, die Abtreibungen vornehmen, seien die Experten, die Frauen „Zugang zu sachgerechten fachlichen Informationen über den sie betreffenden medizinischen Eingriff“ geben würden.
Keine Dienstleistung, sondern eine Tötungshandlung
Wenn Abtreibung die Beseitigung eines Menschen im frühesten Stadium seiner Existenz ist, dann ist sie keine medizinische Dienstleistung, sondern eine Tötungshandlung. Das bliebe sie selbst dann, wenn die Ampelkoalition ihre Absicht wahrmacht, sie nicht mehr strafrechtlich, sondern zivilrechtlich zu regeln.
Mit der Beseitigung des Paragraphen 219a StGB soll dem Arzt Werbung für das Angebot einer Abtreibung erlaubt werden wie für Zahnimplantate oder neue Hüftgelenke. Unsachlicher oder gar anpreisender Werbung soll durch eine Änderung des Heilmittelwerbegesetzes begegnet werden. Informationen über Dienstleistungen gegen Honorar gelten aber rechtlich immer als Werbung. Ein Staat, der die Tötung ungeborener Kinder als Teil der Gesundheitsversorgung betrachtet und Ärzten eine dementsprechende Werbung erlaubt, verleugnet sein rechtsstaatliches Fundament.
Devise: nur nicht vom Kind reden
Daß Ärzte, die Abtreibungen anbieten, sachgerecht über diesen Eingriff informieren, dafür ist Kristina Hänel, auf die sich der Bundesjustizminister in seinem Gesetzentwurf bezieht und die in diesen Tagen in allen Nachrichten, die über den Gesetzentwurf berichten, zu sehen ist, das ungeeignetste Beispiel. In den Informationen zum Schwangerschaftsabbruch, die sie auf ihrer Homepage anbietet, kommt das Kind, die Hauptperson einer Abtreibung, nicht vor.
Statt dessen ist von „Schwangerschaftsgewebe“ und von der „Fruchtblase“ die Rede, die bei einer Abtreibung „ausgestoßen“ würden. Diese Verschleierung im Gewand einer Aufklärung entspricht der Strategie der Abtreibungslobby, die im Kampf für die Legalisierung der Abtreibung der Devise folgt: nur nicht vom Kind reden.
So nachvollziehbar es sei, „mit gewollt Schwangeren bereits von ihrem Kind zu sprechen“, schreiben Aktivistinnen der Abtreibungslobby in ihrem Manifest „Kulturkampf und Gewissen“ (Berlin 2018), „in der politischen Arena sollten wir diesen Sprachgebrauch unbedingt vermeiden, da er der Ideologie der ‘Lebensschutz’-Bewegung in die Hände spielt“. In der Debatte um den Paragraphen 219a StGB geht es mithin nicht um Aufklärung, sondern um den ohnehin nur minimalen Schutz des Lebens ungeborener Kinder. Eine Abtreibung ist keine medizinische Dienstleistung wie eine Lungenfunktionsprüfung oder ein EKG. Sie bleibt ein Tötungsdelikt.
Prof. Dr. Manfred Spieker ist emeritierter Professor für Christliche Sozialwissenschaften an der Universität Osnabrück.
JF 12/22