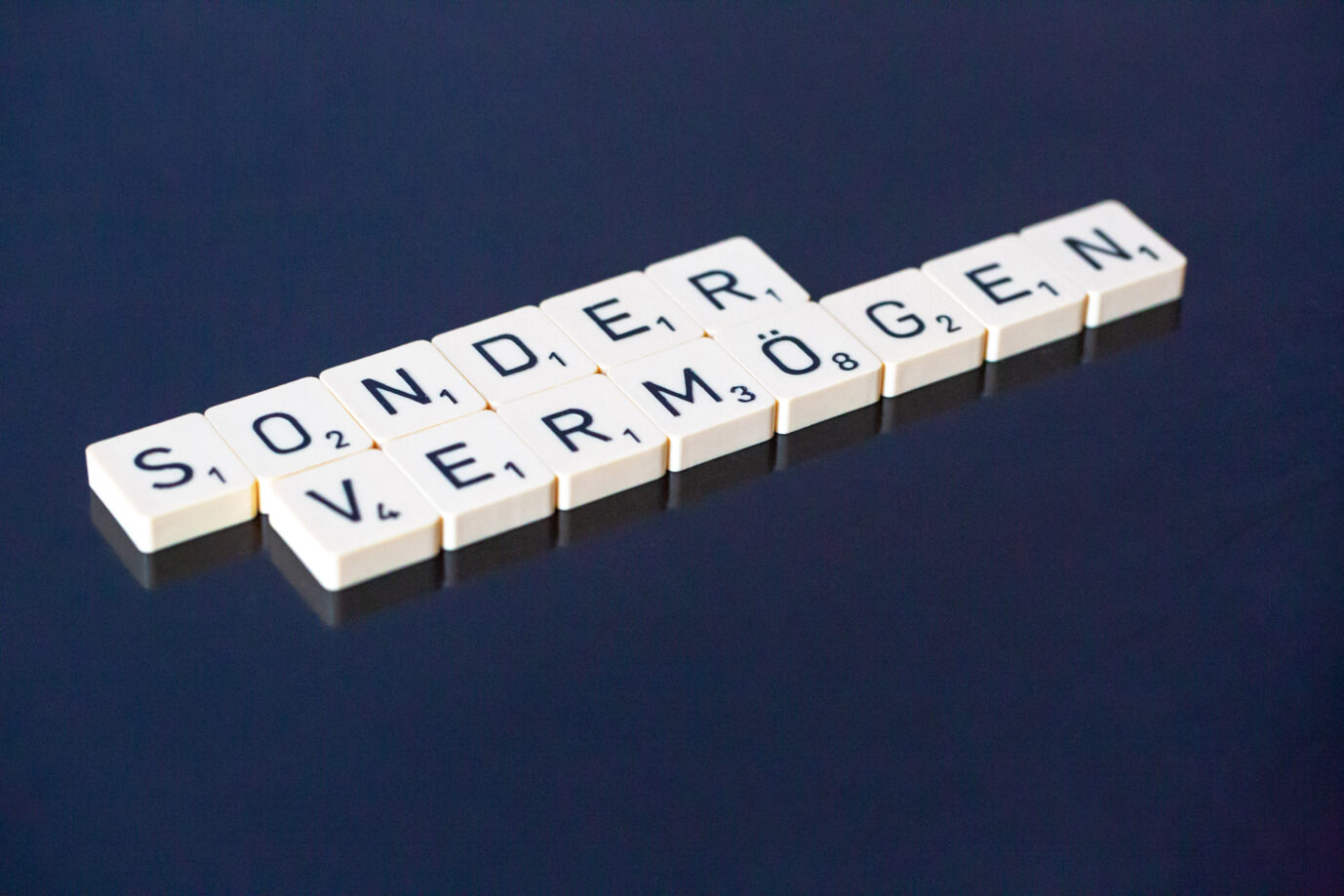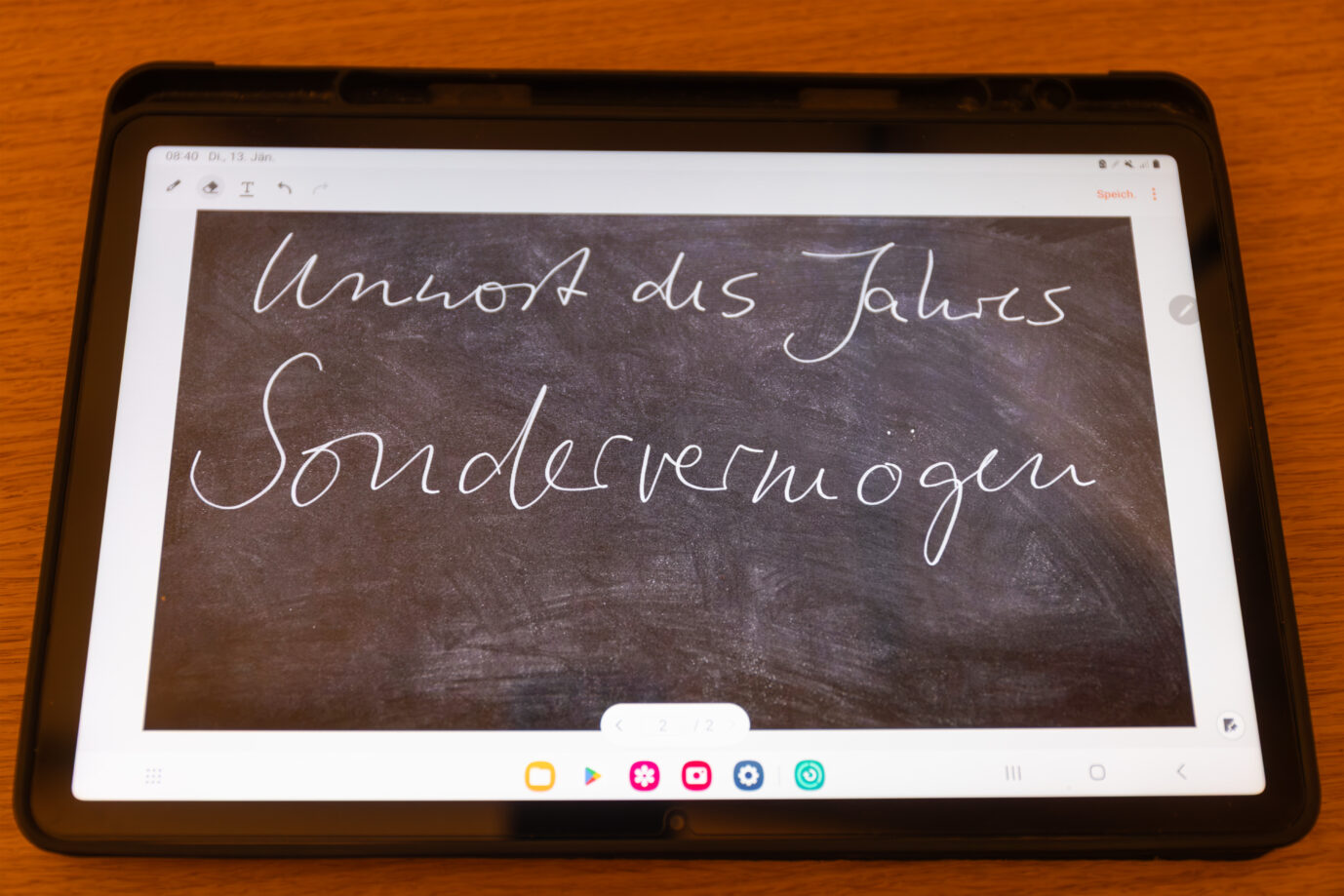Während Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) um die Welt reist, um Rüstungsallianzen zu schmieden und den Kanadiern Milliarden aus dem „Sondervermögen“ verspricht, sollten diese deutsch-norwegische U-Boote kaufen, fordern die Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann (Baden-Württemberg), Olaf Lies (Niedersachsen), Boris Rhein (Hessen), Markus Söder (Bayern) und Hendrik Wüst (NRW) in einem Brief an Friedrich Merz nationale Beschaffungen in der Rüstungsindustrie. Damit ist speziell der Düsseldorfer Dax-Konzern Rheinmetall gemeint, der zum Hauptlieferanten der Bundeswehr aufgestiegen ist.
Doch das Bundesamt für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr (BAAINBw) hat einen Auftrag an Patria vergeben. Der halbstaatliche finnische Rüstungsproduzent wird den Nachfolger des Fuchs-1-Transportpanzers bauen. Bei der ersten Tranche des Patria 6×6 geht es um 25 Millionen Euro – der Fuchs 2 von Rheinmetall hatte das Nachsehen. Im weiteren Verfahren sollten „vorrangig Produkte der nationalen Verteidigungsindustrie“ berücksichtigt werden, „nicht nur aus wirtschafts-, sondern auch aus technologie- und sicherheitspolitischen Aspekten“, heißt es in der an den Kanzler gerichteten Intervention. Es gehe um „inländische Produktion mit inländischer Wertschöpfung“.
Länderchefs aus dem Osten haben das Schreiben nicht unterzeichnet, denn die wenigen Firmen, die von dort Rüstungsgüter liefern könnten, würden vom Beschaffungsamt der Bundeswehr weitgehend außen vor gelassen, beklagt Sachsens Wirtschaftsminister Dirk Panter (SPD). Doch Sonder-Milliarden müßten „auch im Osten aufschlagen“. Klartext spricht der Bautzener CDU-Politiker Marko Schiemann: „Bei der Vergabe kommt man hier nicht mehr rein. Der Westen ist eine geschlossene Gesellschaft.“ Serdar Kaya, Chef des Militärfallschirmhersteller Spekon in Seifhennersdorf, konstatiert: „Die ganze Welt bestellt in Sachsen, aber nicht die Bundeswehr.“
Voigt: „Wir genießen Weltruf in der Raumfahrttechnologie, bei Optik und Photonik“
In Thüringen sind laut einer Umfrage des Branchenverbandes Automotive zwar drei Viertel der Verbandsunternehmen offen für künftige Rüstungsaufträge, aber als bei einem von der IHK organisierten Managertreffen „Thüringer Zuliefer- und Informationsforum Defense“ mit Ministerpräsident Mario Voigt der Bundeswehr-Professor Michael Eßig fragte, wer schon für die Bundeswehr liefert, hätten nur sechs oder sieben die Hand gehoben, berichtete der MDR. Die Landesregierung sehe sich als „Door-Opener für Matchmaking-Prozesse“, verspricht Wirtschaftsministerin Colette Boos-John (CDU). Doch vor der Tür stehen nicht deutsche, sondern südkoreanische Firmen. Kang Kyung-hoon, Vizechef der Hanwha Aerospace in Changwon, will in den nächsten fünf Jahren weltweit 18 Milliarden Dollar investieren – einen Teil davon vielleicht inThüringen: „Wir genießen Weltruf in der Raumfahrttechnologie, bei Optik und Photonik“, betont Ministerpräsident Voigt.
Aber nicht allein das BAAINBw bestimmt, was gekauft wird. So beliefert Artec, ein Gemeinschaftsunternehmen von Rheinmetall und KNDS (Amsterdam), 150 Schakal-Schützenpanzer im Wert von 3,4 Milliarden Euro an die Bundeswehr. Beauftragt wurde sie von der europäischen Rüstungsorganisation OCCAR in Bonn. Auch für die Artillerie-Radhaubitze RCH 155 soll Artec Hauptauftragnehmerin werden. Der Spähpanzer Luchs 2 soll dagegen von der spanischen GDELS geliefert werden, einer Tochter des US-Konzerns General Dynamics. Es geht um 3,5 Milliarden Euro.
Das erste 100-Milliarden-Sondervermögen für die Bundeswehr wird vor allem für kostspielige Projekte wie die F-35-Kampfjets, Chinook-Helikopter sowie das Arrow-3-Flugabwehrsystem ausgegeben. Letzteres schützt aber erst ab 2030, die Transporthubschrauber kommen zwischen 2027 und 2032. Irritationen löst auch die Bindung an Lockheed Martin aus, während die Ukraine mit deutschem Steuergeld die schwedische Saab-Gripen ordert oder Airbus, Dassault und Indra das EU-Kampfflugzeug der Zukunft (FCAS) entwickeln. Rheinmetall-Chef Armin Pappberger schwärmt dagegen von der Kooperation mit Lockheed Martin und Northrop Grumman als einem „Leuchtturm-Projekt transatlantischer Verteidigungskooperation“, darf er doch in Weeze Rumpfteile für die F-35 bauen.
Es braucht schnell Waffen und Infrastruktur
Vor Großprojekten warnt Klaus-Heiner Röhl, Verteidigungsexperte am Institut der deutschen Wirtschaft (IW): Die Milliarden sollten für eine schnell zur Verfügung stehende Einsatz-Reserve für Fahrzeuge und Waffen genutzt werden, für mehr Soldaten und ausreichend Munition. Immerhin scheint zumindest die Versorgung der Soldaten mit Kampfstiefeln und Uniformen gesichert. Erstere liefert das bayerische Unternehmen HAIX, Kampfanzüge, Feldblusen, Gefechtshemden und Spezialbekleidung der hessische Bekleidungshersteller Leo Köhler. Die Lizenz auf die Materialien, die bei Regenjacken, Tarnponchos und Kälteschutzkleidung eingesetzt werden, liegt allerdings beim US-Konzern W. L. Gore & Associates in Delaware. Die ballistische Schutzkleidung von Mehler Vario Systems aus Fulda ist aber „Made in Germany“. Bei Schlafsäcken, Isomatten und Kälteschutzanzügen setzt die Bundeswehr auf die österreichische Marke Carinthia.
Nach dem ein Pilotprojekt, die Truppenküchen in Bayern versuchsweise an Dussmann auszulagern, mit einem Desaster endete, kocht die Bundeswehr im Inland wieder selbst. Für Auslandseinsätze wird bei der international tätigen Supreme Group eingekauft. Und damit der Soldat die Konserve aufbekommt, besitzt er ein Victorinox-Taschenmesser aus der neutralen Schweiz, die zu allen Zeiten deutsche Armeen zuverlässig beliefert hat.
Die bürokratische Wunderwaffe ist das Bundeswehrbeschaffungsbeschleunigungsgesetz (BwPBBG). Noch schneller ist nur Pistorius persönlich. Nachdem ruchbar wurde, daß die Kanadier statt deutscher lieber zwölf südkoreanische U-Boote ordern wollten, flog der Minister nach Nordamerika, um den Multi-Milliarden-Auftrag für Thyssenkrupp bzw. den gerade ausgegründeten Marinehersteller TKMS zu retten. Um das Blatt zu wenden, versprach er den milliardenschweren Kauf des kanadischen Führungs- und Waffeneinsatzsystems für die deutsche Marine, den Erwerb von 18 Bombardier-Flugzeugen, eine Beteiligung Kanadas am deutsch-norwegischen U-Boot-Vorhaben 212 CD einschließlich des Baus kompletter U-Boote in einer noch zu errichtenden Werft an der kanadischen Küste. Also doch kein „Made in Germany“.